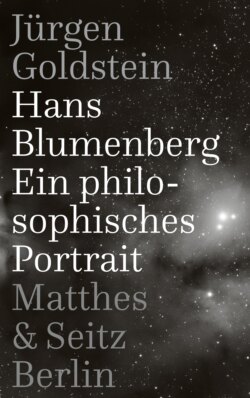Читать книгу Hans Blumenberg - Jürgen Goldstein - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Destruktionen Frühe Einstimmung:
Das Schweigen der Welt
ОглавлениеWann jemand begonnen habe zu philosophieren, führte Hans Blumenberg in einer seiner Vorlesungen aus, könne nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. Nur wann er aufgehört habe, Philosophie zu betreiben, lasse sich mit Sicherheit bestimmen: mit seinem Tod. Dieser letzten Eindeutigkeit steht die Unschärfe des Anfangs gegenüber. Schwellen machen das Leben aus: Niemand zweifelt aufgrund der Prägnanz der Differenzen an der sinnvollen Unterscheidung von Kindheit, Jugend, Erwachsenenleben und Alter, auch wenn die Übergänge so unmerklich sind wie der Wechsel von Tag und Nacht mit dem Zwischenreich der Dämmerung. Harte Zäsuren sind die Herausforderung der biographischen Kontinuität und Identität. Sie kommen vor, stellen aber den Grenzfall des Lebens, nicht dessen normalen Fluss dar.
Es mag daher durchaus erinnerbare Anfänge und klar bestimmbare Auslöser für das Philosophieren geben. Allgemein vorauszusetzen ist aber doch eher ein diffuser Anfang des Nachdenkens, des Fragens und Antwortens, der irgendwann einen bestimmten Grad der Ernsthaftigkeit erreicht. Den ersten Gedanken eines Philosophen gibt es nicht, und die dokumentierten Äußerungen, seien sie veröffentlicht oder als private Niederschrift erhalten, sind bereits ein spätes Stadium einer sich im Ungefähren verlierenden »Geistesfrühe«.1 Warum ist das von Bedeutung? Warum begnügen wir uns nicht damit, etwa die erste Publikation eines Philosophen als Startpunkt seiner denkerischen Biographie anzusetzen? Wir wissen von Blumenberg nicht, wann er begonnen hat zu philosophieren. Aber bevor jemand Autor wird, ist er ein Leser. Damit erhellt sich der biographische Schritt zum eigenen Philosophieren zwar nicht auf wünschenswerte Weise, aber frühe Lektüren eines Philosophen sind von Bedeutung, wenn sie im späteren Werk ein Echo gefunden haben und somit eine Gedankenspur noch vor die biographisch ersten Niederschriften führt. Das ist bei Hans Blumenberg der Fall.
Nun mag man im Rückblick manches erwarten, was zu den eindrücklichen Leseerfahrungen des heranwachsenden Blumenberg gehört haben könnte: Klassiker der Antike, Wegmarken der neueren Geistesgeschichte oder Gegenwartsautoren der Philosophie. Hannah Arendt, zum Vergleich, hat als Jugendliche Kants Kritik der reinen Vernunft gelesen und war für die Philosophie gewonnen. Ernst Mach studierte als 15-Jähriger Kants Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die auf ihn einen gewaltigen und unauslöschlichen Eindruck gemacht haben. Für Blumenberg dagegen war eine andere frühe Lektüre atemberaubend: Bei seiner Lieblingstante, »in einem nie beheizten ›Herrenzimmer‹«, las er als Kind »auf dem Fußboden liegend und zitternd – nicht vor Kälte – vor Aufregung«2 das zweibändige Werk des Polarreisenden Fridtjof Nansen In Nacht und Eis. Die Norwegische Polarexpedition 1893–1896. Diese »Nansen-Lektüre mit 9 Jahren« habe »lebenslang«3 auf ihn gewirkt.
Diese Auskunft ist bemerkenswert. Blumenberg ist zu Lebzeiten in nur einer einzigen Veröffentlichung, drei Jahre vor seinem Tod, auf Nansen zu sprechen gekommen.4 Und doch behauptet er eine lebenslange Nachwirkung? Bei genauerer Betrachtung finden sich in seinen Büchern gedankliche Echos der frühen Lektüre, von den weltanschaulichen Tönungen ihrer Entstehungszeit gereinigt, aber für den Leser, der Blumenberg mit Nansen abzugleichen unternimmt, erkennbar.
Fridtjof Nansen, 1861 in der Nähe von Oslo in Norwegen geboren, war eine der führenden Gestalten der Polarforschung des ausgehenden 19. Jahrhunderts. 1888 führte er die erste Durchquerung Grönlands auf Skiern und stellte mit seinem zwei Jahre später erschienenen Buch Auf Schneeschuhen durch Grönland ein erstes Mal seine Doppelbegabung als Expeditionsleiter und Autor unter Beweis. Nansens Bücher über seine Vorstöße in die unwegsame Natur waren literarische Ereignisse. Wie kein anderes hat sein zweibändiges Werk In Nacht und Eis seinen literarischen Ruhm begründet. Ein Jahr nach der norwegischen Fassung war es 1897 als deutschsprachige Ausgabe im Brockhaus-Verlag mit über zweihundert, die Anschaulichkeit steigernden Abbildungen, vier Karten und acht »Chromotafeln«, also damals sehr aufwendigen Farbdrucken, erschienen. Es erzählt von Nansens Vorstoß zum seinerzeit noch unerreichten Nordpol.
Nansens Vorhaben war tollkühn. Er hatte den riskanten Plan gefasst, mit einem eigens dafür konstruierten Schiff in die Arktis aufzubrechen.5 Die »Fram« – der Name des Schiffes bedeutet »vorwärts« – war so gebaut, dass sie die Möglichkeit bot, sich im Packeis einfrieren zu lassen, ohne von den Eismassen zerdrückt zu werden. Nansen hatte die Idee, die Eisdrift im nördlichen Polarkreis auszunutzen und sich auf diese Weise dem Pol zu nähern. Am 24. Juni 1893 brachen sie auf, beladen mit Proviant für fünf Jahre. Rasch ließen sie die norwegische Küste hinter sich, fuhren westlich entlang der sibirischen Küste und trafen gut einen Monat nach ihrem Aufbruch auf erstes Packeis. Am 17. September nahmen sie Kurs auf den Nordpol. Zwei Wochen später war die Fram eingefroren, unbeweglich im Eis. Das Schiff überstand in den folgenden drei Jahren alle Eispressungen. Nansens Konstruktionsidee war aufgegangen. Aber die Eisdrift nahm einen anderen Verlauf als erwartet. In einem zermürbenden Zickzackkurs näherten sie sich nur mühsam dem Pol. Am 12. Dezember 1894 erreichten sie zwar mit 82 Grad und 30 Minuten eine nördlichere Breite als jedes andere Schiff zuvor, aber noch trennten sie etwa 780 Kilometer von ihrem Ziel. Nansen traf die Entscheidung, zusammen mit Hjalmar Johansen von Bord zu gehen, um sich mit Schlitten, Kajaks, Hunden und Proviant auf das Wagnis einzulassen, über das Eis den Pol zu erreichen. Otto Sverdrup übernahm das Kommando auf der Fram. Der Aufbruch von Nansen und Johansen im März 1895 hatte etwas Ungeheuerliches an sich: »Nie hat irgendjemand je die Brücke hinter sich so entschieden abgebrochen. Wenn wir umkehren wollten, wir hätten absolut nichts, wohin wir uns wenden könnten, nicht einmal eine öde Küste. Es wird unmöglich sein, das Schiff wiederzufinden, und vor uns liegt das große Unbekannte.«6
Auf Nansen und Johansen wartete ein unbeschreiblicher Kampf. Schonungslos und minutiös hat Nansen in seinem Tagebuch, der Grundlage für sein späteres Werk In Nacht und Eis, die Entbehrungen und Strapazen dieses Versuchs festgehalten. Immer wieder mussten sie die mit Kajaks beladenen Schlitten über Eisrinnen und Hügelketten hinweghieven. An manchen Tagen kamen sie kaum einen Kilometer durch das zerklüftete Eis voran. Am 8. April 1895 erreichten sie mit 86 Grad, 13,6 Minuten ihren nördlichsten Punkt. Kein Mensch war jemals so hoch in den Norden vorgestoßen, doch aufgetürmte Eismassen vereitelten jedes weitere Vorankommen. Der Pol schien zum Greifen nah und war unerreichbar. Sie kehrten um.
Der Rückweg erwies sich als die eigentliche Tortur. Ohne Aussicht auf Wiederkehr zur in der Eisdrift sich entfernenden Fram hatten sie sich auf eigene Faust zu retten. Ihr Ziel war das Franz-Josef-Land, eine heute zu Russland gehörende Inselgruppe, die beinahe 1000 Kilometer weiter südlich gelegen war. Um zu überleben töteten sie nach und nach ihre Schlittenhunde. Da sie nicht schnell genug vorankamen und zunehmend die Orientierung verloren, mussten sie den arktischen Winter in einer kleinen, selbstgebauten Hütte überstehen, die so niedrig war, dass sie in ihr kaum sitzen konnten. Immerhin gelang es ihnen, die Innentemperatur um den Nullpunkt zu halten. Nach ihrem erneuten Aufbruch war es reiner Zufall, dass sie am 23. Juni 1896, über ein Jahr, nachdem sie die Fram verlassen hatten, am Kap Flora am südlichen Franz-Josef-Archipel auf den Anführer einer britischen Polarexpedition stießen. Das war die Rettung. Wenige Wochen nach ihrer Rückkehr traf auch die Fram mit der restlichen Mannschaft unversehrt in Norwegen ein.
Nansens In Nacht und Eis stellt einen Höhepunkt der Expeditionsliteratur dar. Sein Bericht ist von großer erzählerischer Kraft und fesselt die Aufmerksamkeit des Lesers. Darüber hinaus – und darauf kommt es hier an – ist er mit jenen intellektuellen Stimmungen angereichert, die das europäische 19. Jahrhundert in seinen letzten Jahrzehnten ausmachten und die mit ihren Pessimismen bis in das folgende ausstrahlen sollten. Nansen war ausgebildeter Zoologe und mit jener Disziplin vertraut, die durch Darwin in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer Leitwissenschaft aufgestiegen ist – Nansen lässt nicht unerwähnt, dass er während der langen Abende an Bord der Fram zu Darwins Über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl gegriffen hat. Die traditionell seit zwei Jahrtausenden unter christlichen Vorzeichen verbürgte Stellung des Menschen im Weltganzen war durch die Annahme einer Evolution aller Lebewesen erschüttert worden. Damit nicht genug: Die 1867 von Rudolf Clausius veröffentlichte Lehre von der ›Entropie‹ als dem Endpunkt allen Energieaustausches ließ das Ende der Welt in einem Zustand der Erstarrung denkbar werden. Das Ergebnis dieses Prozesses, wie Carl Friedrich von Weizsäcker ausführt, ist der »Wärmetod«: Er besteht aber »meist nicht darin, daß die Gestalten aufgelöst werden, sondern darin, daß sie erstarren. Wenn keine Energie mehr umgesetzt wird, so können Gestalten von nun an weder entstehen noch vergehen.«7
Nansen lieferte dazu die plastischen Beschreibungen: Das arktische Eis, so führt er in einer längeren Passage aus, verweist auf die »Welt, die kommen wird! … Langsam und unmerklich nimmt die Wärme der Sonne ab, und in derselben langsamen Weise sinkt die Temperatur der Erde. Tausende, Hunderttausende, Millionen von Jahren entschwinden, Eiszeiten kommen und gehen, und die Wärme nimmt immer mehr ab; ganz allmählich dehnen sich die treibenden Eismassen weit und immer weiter aus, immer weiter dringen sie nach südlichen Breiten, ohne daß jemand es bemerkt, bis endlich alle Meere der Erde eine einzige Eismasse sind. Das Leben ist von der Erdoberfläche verschwunden und nur noch in den Tiefen des Ozeans zu finden. Aber die Temperatur fährt fort zu sinken; das Eis wächst, es wird dicker und immer dicker, die Herrschaft des Lebens verschwindet. Millionen von Jahren rollen vorüber, bis das Eis den Meeresgrund erreicht. Die letzte Spur von Leben ist verschwunden, die Erde ist mit Schnee bedeckt. Alles, wofür wir gelebt haben, besteht nicht mehr, die Früchte all unserer Mühen und Leiden sind schon vor Millionen von Jahren hinweggelöscht, begraben unter einem Leichentuch von Schnee.«8
Der zeitgeistsensible Leser wurde in diesem dramatischen Stück Futurologie – so unstimmig die Illustrationen aus heutiger astrophysikalischer Sicht auch sein mögen – auf das Ende der Welt vorbereitet. Das war – jenseits der antiken Weltbrandszenarien und jenseits der christlichen Apokalyptik – ein neuer Gedanke. Der Physiker Walther Nernst geriet 1938 regelrecht in Zorn, als ihm der junge Carl Friedrich von Weizsäcker nach seiner Entdeckung des Kohlenstoff-Zyklus als Energiequelle der Sonne eröffnete, »die Welt könne ein Ende haben«.9 Die kosmische Endlichkeit als Destruktion aller menschlichen Hoffnungen auf Fortdauer. Jahrzehnte nach seiner frühen Nansen-Lektüre ist bei Blumenberg zu lesen, es stelle die »bitterste aller Entdeckungen, die empörendste Zumutung der Welt an das Leben« dar, »daß die Welt dieselbe wäre, wenn es uns selbst nie gegeben hätte, und alsbald dieselbe sein wird, als ob es uns niemals gegeben hätte«.10 Erst das Prinzip der Entropie habe »allen Illusionen über die Frontseite der Evolution, über die Zukunft der Gattung Mensch und ihrer Werke, ein Ende gesetzt«.11 Derartiges ließ sich auch ohne die Lektüre Nansens formulieren, keine Frage. Aber von einer rezeptionsgeschichtlichen Abhängigkeit ist hier auch nicht die Rede, eher von einer Empfänglichkeit für spätere Gedanken und ihre intellektuelle Temperierung durch frühe Lektüren.
Die Empörung gegen die Auslöschung des Humanen durch eine so empfundene Rücksichtslosigkeit der Welt lässt einen weiteren Aspekt in die Reichweite der frühen Lektüre Nansens zurückprojizieren, den modernen ›Heroismus‹. An Nansens Bericht beeindruckt die schier unfassliche Kraftanstrengung, sich in einer lebensfeindlichen Natur erhalten zu haben. Inbegriff der humanen Selbstbehauptung Nansens – in diesem Fall: der Sinnzuschreibung des Sinnlosen – ist allein schon die Idee, in einer abweisenden Eislandschaft einen geographischen und somit rein ideellen Pol erreichen zu wollen. Nur für den Menschen ist dieses Ziel überhaupt als bedeutsames formulierbar. Einem sich den menschlichen Bedürfnissen verweigernden Erdteil wird so eine Intention entgegengesetzt, die noch der Ödnis einen Ort im Bedeutungskosmos des Menschen zuweist. Eben diese Fähigkeit, »aus einer Fremdnatur eine Eigenwelt zu machen«,12 hat der von Blumenberg herangezogene Giambattista Vico mit dem Attribut des ›Heroischen‹ versehen. Damit ist für Blumenberg die Leistungskraft des Menschen bezeichnet, sich angesichts der Weltfremdheit Beheimatungen zu stiften: »Leben mit dem, was wir nicht gemacht haben und nicht machen konnten, ist unsere Kunst und ist alsbald die Kunst.«13
Nansens In Nacht und Eis ist ein Dokument einer jener »großen Proben, was der Mensch aushalten kann«.14 Es ist ein Zeugnis des menschlichen Behauptungswillens angesichts der Ausgesetztheit in einer Welt, die sich als stumm erweist gegenüber unseren Sinnbedürfnissen. Inmitten der Welt aus Eis stellt die Fram eine Enklave des kulturellen Überlebens dar: »Ich schaue in die weite Ferne«, schreibt Nansen, »über die große, öde Schneeebene, eine unbegrenzte, stille, leblose Eismasse in unmerklicher Bewegung. Man hört keinen Ton außer dem schwachen Murmeln des Luftzuges in der Takelung, vielleicht, in der Ferne, das dumpfe Getöse des sich zusammenschiebenden Eises. Inmitten dieser leeren weißen Wüste nur ein kleiner dunkler Fleck, das ist die ›Fram‹!«15 Das Schiff ist ihm der Inbegriff einer »kleinen Oase« inmitten dieser »ungeheuern Eiswüste«.16 Fast ein Jahrhundert später wird Blumenberg in seinem Buch Die Genesis der kopernikanischen Welt diesen Blick auf die fragile Sphäre des menschlichen Lebens in einer lebensfeindlichen Umwelt mit den nahezu identischen Worten im astronomischen Kontext erneuern. Vom stummen Weltall aus gesehen sei die Erde eine »kosmische Oase«, ein »Wunder von Ausnahme … inmitten der enttäuschenden Himmelswüste«.17 Näher sind sich Nansen und Blumenberg im Werk des Letzteren nie gekommen.
Über diese punktuell aufblitzenden Nachwirkungen seiner frühen Empfänglichkeit für die Fragilität des Menschen hinaus gibt es einen späten Beleg für die lebenslange Prägung durch die Lektüre Nansens. 1993, hundert Jahre nach dem Aufbruch der Expedition zum Nordpol, gedachte Blumenberg dieses Abenteuers und unausdrücklich seiner eigenen frühen Lektüre in einem Zeitungsartikel unter dem Titel »Vorstoss ins ewige Schweigen«. Darin erinnert er eben an jenes Schweigen der Eiswelt, »das Nansen drei Jahre lang wie im Nichts der Ungewissheit hatte verschwinden lassen«.18
Blumenbergs Blick zurück auf Nansen verbietet sich jede Nostalgie. Mit wenigen Strichen wird die zeitgeschichtliche Distanz markiert und somit Nansens Erfahrungswelt als Teil des untergegangenen späten 19. Jahrhunderts situiert. Die Melancholie des Polarforschers wird eingebettet in die zeitüblichen Reflexionen über die entdeckte Endlichkeit der Dauer der Strahlkraft der Sonne als Bedingung des Lebens. Seit dieser Einsicht habe ein »düsteres emotionales Moment … über dem menschlichen Selbstverständnis«19 gelegen. Nansens »eschatologische Banalitäten«20 sind für Blumenberg eher Zeit- als Wissenschaftsgeschichte. Überhaupt sei dessen Nachdenken während der Eisdrift der Fram »nicht originell für dieses Jahrzehnt; nur hebt es sich vom zumeist in bildender Absicht Geschriebenen dadurch ab, dass es nicht bloss aus dem Wissensertrag des Jahrhunderts hervorgeht, Wissenschaft zu Wissen verbreiternd, sondern aus der Anschauung des gerade überlebten ersten Polarwinters auf oder in der ›Fram‹«.21
Das Grundmotiv, das Blumenberg in seiner Erinnerung an den Polarforscher schon im Titel seines Artikels hervorhebt, ist aber nicht in erster Linie die Kälte, das Eis oder die Finsternis, sondern etwas, von dem Nansen wiederholt berichtet, ohne es ins Zentrum gestellt zu haben: das Schweigen der Eiswelt. »Alles ist so seltsam still und ausgestorben«,22 heißt es bei ihm. Durch die Akzentuierung dieser Erfahrung akustischer Entbehrungen wird Nansen assoziativ in einer geistesgeschichtlichen Linie verortbar: Pascal hatte davon gesprochen, das ewige Schweigen der kosmischen Räume mache ihn schaudern,23 Camus hat das Absurde beschrieben als den »Zusammenstoß zwischen dem Ruf des Menschen und dem vernunftlosen Schweigen der Welt«,24 und Blumenberg schließlich hat auch festgestellt, die wissenschaftlich verobjektivierte Welt sei »stumm geworden auf die Frage, welche Stellung der Mensch in ihr einnimmt«.25
Damit ist ein erstes Leitmotiv für Blumenbergs diskrete Anthropologie gewonnen: Der Mensch ist in einer ihm nicht gewogenen Wirklichkeit ein Sonderwesen. Gegen den Absolutismus dieser sinnwidrigen Welt hat er sich zu behaupten. So sehr Blumenberg die weltanschauliche Tönung des 19. Jahrhunderts zu kritisieren wusste, so vertraut ist sie ihm doch auch geblieben. »Nicht nur, weil er Abenteuer der Grenzdurchbrüche wie die Driftfahrt der ›Fram‹ sucht, ist der Mensch ein riskantes Wesen. Er ist es schon kraft seiner biologischen Herkunft aus der schmalen Zone der letzten Zwischeneiszeit, aus der harten Schule zwischen den Eisrändern vorrückender Gletschermassen der im Wechsel ihres Vorrückens und Zurückgehens sich mühselig heranziehenden und behauptenden Lebenstüchtigkeit: das Naturwesen gegen die Natur …«26 Der Mensch ist das Wesen, das sich auf Zeit seine kulturellen Oasen zu erhalten vermag, um über Zonen des Überlebens zu verfügen.
Die Erfahrung der Fragilität und Vergänglichkeit des schützenden Raumes hatte Blumenberg schon als junger Mensch machen müssen. Er hatte Nansens In Nacht und Eis als Neunjähriger im Herrenzimmer seiner Lieblingstante auf dem Fußboden liegend verschlungen. »Zwölf Jahre später gab es das Zimmer, die Tante und den Nansen nicht mehr.«27