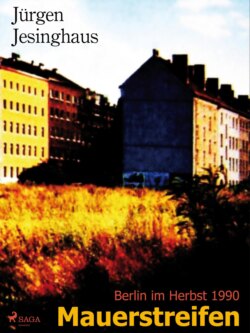Читать книгу Mauerstreifen - Jürgen Jesinghaus - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.
ОглавлениеEr war um vier aufgestanden und hatte ohne Frühstück das Haus verlassen. Um sechs wartete er an der Pforte des Ministeriums. Es dauerte noch 20 Minuten, bis der Bus eintraf, der seit der Vereinigung einen Umweg über das Regierungsviertel nahm. Pünktlich 7.30 stiegen die Passagiere am militärischen Teil des Konrad-Adenauer-Flughafens aus und reihten sich in eine Schlange, die zur Abfertigungshalle kroch. Bundeswehrsoldaten, voll teilnahmsloser Würde, hielten Wache an wackeligen Abfertigungstischen, über den gebeugten Köpfen stempelnder Beamter, die beim Überreichen der Bordkarte nur flüchtig aufblickten. Es begann zu nieseln. Die aufgespannten Schirme stießen sich. Die Stimmung war schon um 7.45 gefroren. Brosheim stand eingehüllt im Regen, wie in einem kalten Glaspanzer, und dachte an die vergangene Woche, während er das Gerede der Umstehenden hörte, ohne einen Sinn zu erfassen.
Er hasste den Vorgesetzten, der die Dienstreise angeordnet hatte (vermutlich in dem Glauben, der Flug werde als Belohnung aufgefasst, als incentive, wie es im Neusprech heißt, als Ersatz vielleicht für aufgeschobene Beförderungen). Nein, ‚hassen‘ ist übertrieben, ja, er hätte ihn geohrfeigt, wenn Ohrfeigen im öffentlichen Dienst ein anerkanntes Mittel wären, seinen Unmut auszudrücken. Er ärgerte sich, dass er nie weiter gekommen war, es nicht einmal zum Unterabteilungsleiter gebracht hatte. Wäre er UAL, dürfte er Dienstreisen selbst bestimmen und von höherrangigen Beamten nur formell abzeichnen lassen. Stattdessen die butterweiche Anordnung:
„Sie sollten einmal hinfliegen und nach dem Rechten sehen. Wir müssen die Hand drauflegen, bevor alles in irgendwelchen Kanälen versickert. Stellen Sie möglichst heute noch einen Reiseantrag, sonst kriegen Sie die Donnerstags-Maschine nicht.“
„Alles? Sickert in Kanäle?“
„Naja, das Ganze halt, alles, was der Bundesrepublik zugefallen ist, eben alles, wofür Sie und ich jetzt verantwortlich sind, obwohl wir kein zusätzliches Personal haben.“
„Nicht? Die Leute drüben?“
„Achherrje, bis die Indianer das geschnallt haben! Würden Sie denen über den Weg trauen? Deshalb sollten Sie hin. Ich weiß, Sie haben hier noch was anderes zu tun. Denken Sie daran, sich ein Zimmer zu bestellen.“
Die schiere Unmöglichkeit, nicht einmal für 300 Mark unter den Linden. Die teuersten am Kudamm waren am schnellsten weg, die 500-Mark-Zimmer. Aber den Auftrag in einem Tag zu erfüllen, das sei nicht zu leisten. Dabei wusste er aus alten BRD-Zeiten, dass man morgens bequem mit einem halbleeren Linienbus zum Flughafen fährt, eine viertel Stunde zum Einchecken benötigt, eine knappe Stunde später ist man in Tegel und wird von einem Senatswagen abgeholt. Damals hätte man einen Job gut und gerne am selben Tag erledigen können!
„Erkundigen Sie sich im Haus nach jemandem, mit dem Sie ein Doppelzimmer teilen.“
Genau das hatte er nicht getan, sondern geschwindelt, er habe bereits eine Unterkunft gefunden.
Der Eintritt in das Abfertigungsgebäude der Bundeswehr, die neuerdings über Tupolew, Iljuschin und sogar Migs verfügte, ließ seine Stimmung nicht etwa hochschnellen, weil er endlich den Regen verlassen durfte, sondern verhinderte nur den Absturz in eine Depression oder, was bei seiner Stimmungslage schwer vorauszusagen war, den Ausbruch eines Wutanfalls, der angesichts der Soldatengesichter, an denen Gefühle abprallten, in Frust ersterben würde, in einer seelischen Kreuzigung durch die beiden Nägel Wut und Schwermut. Endlich stand er über dem Scheitel einer Person, die Namen aus Listen suchte und behauptete, er werde in der Primär-Liste nicht geführt. Dann fliege ich eben nicht, mein Gott! In der Sekundär-Liste, die heute früh aus Münster gekommen war, fand man ihn doch verzeichnet, und so durfte er passieren.
Er bewegte sich unter vielen Beamten, die ihre neuen Dienststellen in Ostberlin als Kommissare besuchen würden, beneidet, gehasst, verachtet von den Eingeborenen, die alle Verstecke verraten, alle Schätze abliefern und dann am Ende einer Schamfrist in einem abgelegenen Büro oder arbeitslos in der billigen Platte verschwinden mussten. Aber welch ein klägliches, frierendes Invasionsheer, diese Beamten! Sie sahen aus wie politische Gefangene, die in einem Nebengebäude des Flughafens, einem Unterstand für Feuerwehrautos, unter Arrest gestellt worden waren. In einer Ecke gab es heiße Getränke, natürlich zu überhöhten Preisen. Trotzdem kaufte Brosheim einen Plastikbecher voll Kaffee, weil ihm nach Heißem zumute war. Punkt neun eroberte er sich einen Platz auf einem Klappstühlchen. An Lektüre war nicht zu denken. Er hatte das Buch vergeblich eingesteckt (wie so oft). Er vergaß regelmäßig, dass man in Bussen nicht lesen kann, weil bei der Federung Augen und Buchstaben nicht in Phase schwingen, auch in den Zügen der Bundesbahn nicht, denn das Geschepper aus den Kopfhörern verleidet die Lektüre, und in Flugzeugen sitzt man so eingeklemmt, dass man am besten die Augen zumacht und versucht, an nichts mehr zu denken. Nur in leeren Straßenbahnen lohnt es sich, ein Buch herauszuholen, wenn man lange genug fährt. Er wurde müde. Er war fünf Stunden unterwegs, hatte die ganze Zeit über herumgestanden oder herumgesessen und sich geärgert. Die Tupolew fiel aus. Warum, das interessierte ihn nicht mehr. Es würde heißen, sowjetische Maschinen seien reparaturanfälliger oder älter oder werweißwas, oder die Herren von der fliegenden Truppe könnten noch nicht korrekt mit ihr umgehen. Er sollte das zum Vorwand nehmen, seine Dienstreise für gescheitert zu erklären, aufzustehen und fortzugehen! Er würde eine halbe Stunde verplempern, wenn er zum zivilen Teil marschierte, entnervt ein Taxi besteigen, 50 Mark zahlen, gegen Mittag zu Hause sein, sich für den Rest des Tages krank melden und die ganze Wiedervereinigung gründlich vergessen. Aber er blieb. Eine halbe Stunde Fußmarsch durch den Regen, 50 Mark aus eigener Tasche, der Tadel des Vorgesetzten – keine Perspektive. Er rückte sein Gepäck eng an die Beine, um den Druck zu spüren, dann schloss er die Augen und balancierte seinen Kopf aus.
Als man ihn anstieß, wachte er auf. Seinen Kopf fand er auf der Schulter einer Sekretärin des Innenministeriums, einer ältlichen, offenbar gütigen Dame, bei der er sich umständlich entschuldigte. Brosheim erklärte ihr, dass er seit vier auf den Beinen sei. Dabei sollte er wissen, dass es den meisten nicht anders erging. Er sorgte dafür, dass er von ihr getrennt wurde. Sie fuhr mit dem zweiten Pendelbus zur Maschine, die weit draußen auf dem Rollfeld stand, wie ein Schiff auf der Reede. Er nahm den dritten, stieg als erster ein und als letzter aus. Da im Passagierraum kein Sitz mehr frei war, geleitete ihn eine Stewardess in die Funktionärskabine, wo DDR-Arbeiter einst ein Bett, einen Tisch und zwei Sessel eingebaut hatten, so dass er sich bequem ausstrecken konnte; 11.37 hob das Flugzeug ab.
50 Minuten später. Die Iljuschin befand sich im Landeanflug auf Schönefeld. Er blinzelte und fragte sich stets dasselbe, wenn er knapp über den Wolken dahinflog: Was hätte Hesekiel oder Dante dazu gesagt, wäre ihm in seinen Visionen ein Anblick erschienen wie dieser, für den es nur abgeschmackte Wörter gibt, weil sich die Sprache auf keine Metapher hat vorbereiten können, denn selbst der Vergleich mit dem Polargebiet, einem Schnee- und Eisgewoge, von einem Luftschiff aus gesehen, wäre erst seit 60 Jahren glaubhaft zu nennen. So bleibt der Anblick, den heute jeder Beamte im Berlin-Tourismus zu sehen bekäme, wenn er nicht schliefe oder in den Akten läse, am besten unvergleichbar.
Schönefeld liegt in der ehemaligen DDR. Die Abgrenzung zur Gegenwart durch das Attribut ‚ehemalig‘ diente kurz nach der Fusion einer genauen zeitlichen Einordnung von Ereignissen: „Nachdem ich am 2. Oktober die DDR verlassen hatte, kehrte ich am 3. Oktober in die ehemalige DDR zurück“. Sauber. In fünf Jahren, spätestens in fünfzig, würde man auf das Ehemalige verzichten, denn niemand sprach vom ehemaligen römischen Reich, auch nicht vom ehemaligen Preußen, obwohl es Preußen de jure noch vor 45 Jahren gegeben hatte. Der Zentralflughafen Berlin-Schönefeld lag also in der ehemaligen DDR und hatte darum ärmlicher zu sein als der Konrad-Adenauer-Airport. Brosheim fragte sich, was der Rotarmist hier suche. Er sollte sich mit Russen die Macht über die zugefallenen Provinzen teilen? Noch lebten sie in ihren zur Heimat gewordenen deutschen Kasernen. Die Kosten für eine sowjetische Heimat und die Übersiedlung würde man zweckmäßigerweise in der neuen deutschen Währungseinheit ausdrücken: Milliarden DM, kurz MDM, denn eine Verwechslung mit Millionen DM war von nun an, seit der kurzen Revolution, der sich die SED, ihrer selbst überdrüssig, gerne gebeugt hatte, nicht mehr zu befürchten.
Hier stand er und wartete auf einen Fahrer des ehemaligen DDR-Außenministeriums, der einige ministerielle Außenstellen anfahren sollte (Genscher also auch zuständig für Außenstellen). Brosheim schüttelte für sich den Kopf. Er musste sich auf allerlei Schwierigkeiten gefasst machen. Es begann schon in Schönefeld. Der Fahrer kam, wollte aber nicht eher mit dem Barkas abfahren, als bis die zweite Maschine im Gefolge der Iljuschin gelandet wäre, „weil ich weitere Damen und Herren aus Bonn erwarte“. Brosheim hätte ihm gerne einen Befehl erteilt, aber die Berliner Art, die er aus frühen Kudamm-Zeiten kannte und die auch am Alexanderplatz zu herrschen schien, hielt ihn davon ab, und schließlich auch seine Überzeugung, dass sie gleichberechtigte Menschen seien, die einander nicht zu kommandieren hätten. Er ärgerte sich trotzdem, entfernte sich von ihm und schaute in die Auslagen der Shops, die schon so hießen und vollgestopft waren mit Gütern aus dem Westen: Marlboro, Playboy und Sony. Eine Dreiviertelstunde kam ihm nicht zu lange vor, weil er sich auf einen vergeudeten Tag eingestellt hatte. Der Kleinbus füllte sich. Einige Mitfahrende kannte er vom Sehen, und er sorgte dafür, dass ihn keiner ansprach, weil er sich auf keine Verabredung einlassen wollte, denn ihm stand das Schwierigste noch bevor: Die Suche nach einem Hotelzimmer in der wiedervereinten Stadt, die von Menschen überschwemmt wurde.
Kurz nach zwei erreichten sie die Außenstelle Unter den Linden. Er stellte sein Gepäck beim Pförtner ab, der erst nach gutem Zureden und einem langen Blick auf den Dienstausweis darin einwilligte, immer noch misstrauisch. Brosheim sagte geschäftsmäßig, er habe außerhalb dienstlich zu tun und werde sein Gepäck später abholen. Nur die Hängetasche warf er über die Schulter und ging. Er war so vorsichtig gewesen, einen Kamm und eine Zahnbürste als ständige Utensilien hineinzuwerfen. Es zog ihn nach Westen, möglichst weit weg (aber nicht zu weit, sonst stieße er wiederum an die Grenze zur – ehemaligen – DDR). Dort wollte er eine Pension suchen, wie in den alten Zeiten, als West-Berlin noch die Insel der Seligen war, von Mauern umgeben, geschützt gegen den real existierenden Sozialismus, aber auch gegen das Ladenschlussgesetz der BRD. Es hätte keinen Zweck gehabt, in den Seitenstraßen Unter den Linden vor die Schalter der Hotelrezeptionen zu treten, um nach einem Zimmer zu fragen. Also überließ er alles dem Zufall, in den er viel Vertrauen setzte.
Er ging zur Friedrichstraße und fuhr mit der S-Bahn weit nach Westen, stieg dann in ein Taxi, nur um den Fahrer zu fragen, ob er keinen Geheimtipp wisse. Selbst der wusste keinen.
„Dann fahren Sie mich zu der nächsten seriösen Bar, die bis morgens offen hat.“
„Seriös?“
„Es darf nichts kosten, der Bedienung in den Ausschnitt zu kucken.“