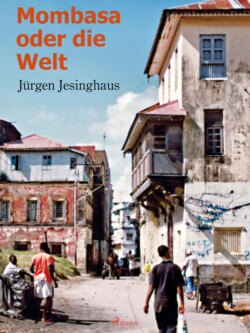Читать книгу Mombasa - Jürgen Jesinghaus - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9.
ОглавлениеAls Sozialist verachtete Fritz Radebusch die Kirche, aber er besaß eine übertriebene Vorstellung von ihrer Moralität, von ihrem Gebot zur Nächstenliebe, das einzuhalten sie nur zu schwach sei. Insgeheim aber wies er ihr die Aufgabe zu, die sie vielleicht in den Anfängen wahrgenommen hatte: zu helfen, wo Not am Menschen ist. Wie dem auch sei. Man erzählte sich nach dem Krieg (wobei sich ein Informant auf den anderen berief), Radebusch, nicht Hartkopf, habe den Anstoß gegeben, nur um zu beweisen, dass Kleriker nicht täten, was ihre Pflicht ist: nämlich Urbanski, den polnischen Katholiken, zu verstecken und unbeschädigt über den Krieg zu bringen.
Der Abt war ein junger Mann. Die Leute in Oplyr, die an hohen Festtagen die Gottesdienste des Klosters Weiberberg besuchten, hielten ihn für vierzig, obwohl das Ornat, das er bei solchen Gelegenheiten trug, die Altersschätzung erschwerte. Der Pfarrer des Ortes wollte wissen, der Abt habe nicht nur Theologie und die beiden Rechte studiert, sondern auch Volks- und Betriebswirtschaftslehre, was ihn vor den anderen Mönchen auszeichne, ein angesehenes Kloster zu leiten. Gustav Hartkopf hatte sich im Ort nach den Eigenschaften des Mannes erkundigt und nie eine andere Information erhalten, als dass er gescheit sei und mit Geld umzugehen verstehe. Das beruhigte Hartkopf. Wirtschaftswissenschaften sind reell, handfester als das fromme Gesülze. So traten er und Radebusch dem Gedanken näher, wegen Urbanski mit dem Kloster zu sprechen.
Das Nächstliegende wäre, sich dem Pfarrer anzuvertrauen und ihn zu bitten, den Kontakt zum Kloster herzustellen. Radebusch riet davon ab: Der Pfarrer habe zu oft unter Hakenkreuzen posiert. Er sei eine Schaltstelle des Tratsches, außerdem habe er bei der Verschleppung Jabotinskys und Doktor Schöns nichts zu ihrer Hilfe unternommen. Mit dem Kloster zu telefonieren, erschien ihnen zu gefährlich. Es war nicht ausgeschlossen, dass alle Telefonate überwacht wurden. Es war auch nicht ausgeschlossen, dass man das Kloster bespitzelte. Viele Personen kamen als Spitzel in Betracht. Sie würden unentgeltlich denunzieren, nur um sich als treue Volksgenossen zu erweisen. Wie also den Kontakt aufnehmen mit einem Mann, der Ökonomie studiert hatte und von Amts wegen (wahrscheinlich) kein Nazi war? Aber sind denn die Männer der Wirtschaft immun gegen das „Braunfieber“? Es gab ja unter ihnen genug willfährige. Das Großkapital hatte schließlich diesem Gefreiten an die Macht verholfen (so Radebusch im vertrauten Kreis). Trotzdem, ein Ökonomie-Abt ist besser als die meisten Geisteswissenschaftler, viel besser als Juristen und Lehrer - das kleinere Übel.
Eines Morgens fuhr Radebusch mit zwei Arbeitern in dem Dreirad, dem T2, durch das Dorf. Der T2 war beladen mit Kies, Sand und Bitumen, einigen Hacken, Steingabeln und Reiserbesen. Auf der Ladung saßen die Arbeiter und verzehrten ihr Frühstücksbrot. Sie tranken aus Feldflaschen, die noch aus dem ersten Krieg stammten. Eine Weile hielt sich Radebusch auf der Hauptstraße. An der alten Kiesgrube sah er starr nach vorn, um kein misszuverstehendes Interesse an diesem Ort zu bekunden, obwohl die Vorsicht überflüssig war, denn erstens saß außer ihm niemand in der Fahrerkabine und zweitens hatte die Presse diesen Ort niemals erwähnt, weil Masrat so dämlich gewesen war, den Tatort zu verlassen und dann doch abzukratzen. Radebusch grinste bei dem Gedanken und schüttelte den Kopf. Am Heiligenhäuschen bog er nach links auf die „Pass-Straße“, wie er die schmale Straße nannte, die in sanfter Steigung am rechten Ufer des Mühlenbachs auf das Plateau führte, zur Ruine der alten Ziegelei. Der Vorberg begrenzt im Westen die Ebene, wo der Rhein Unmengen Kies und Schluff angeschwemmt hatte. Einen winzigen Teil davon, ein Staubkörnchen, schleppte das ächzende, tuckernde Tempo-Dreirad hinauf. Der Zweitakter verlor den Faden, „die Nähmaschine steppte nicht mehr“. Radebusch hielt und befahl den Männern abzusteigen und zu Fuß weiterzugehen. Fritz fuhr nun im Schritt-Tempo. Der T2 begann zu schlingern wie nur ein Dreirad auf einem mit Schlaglöchern übersäten Sträßchen. Die Arbeiter und der T2 erreichten fast gleichzeitig die Abzweigung zum Kloster. Fritz stoppte und stieg aus. Von dieser Stelle konnte man das Kloster gut überblicken. Es lag am Ende des Mühlenbachs. Die Mauern umschlossen das Quellgebiet, „heiligen Boden“, der seit Jahrhunderten den Dominikanern gehörte. Radebusch sah prüfend hinüber und rief den Männern zu:
„Hier ist es. Fangt an. Repariert den Klosterweg. Lasst euch Zeit. Macht es gründlich!“
Er zerstreute die Bedenken seiner Arbeiter, das bisschen Sand auf dem T2 reiche höchstens für fünf Meter, und begann, an einigen Stellen Asphaltreste zu beseitigen, mit übertriebenen Verrenkungen, als wollte er die Spitzhacke mit aller Kraft in den Weg schlagen, dass keiner außer einem Gottberufenen sie je wieder herausziehen könnte.
„Du spinnst, Fritze, machst mehr kaputt, als wir in einem Jahr reparieren können.“
Nach einer viertel Stunde wurde Radebusch ungeduldig. Er stellte seine Arbeit ein und vertiefte sich in den Anblick des Klosterkomplexes. Seine Männer arbeiteten langsam, in einer wiederkäuenden Weise. Es wurde ihnen heiß, sie lehnten sich an den Ladeverschlag. Sie hatten gar nicht bemerkt, dass aus der Pforte jemand herausgekommen war – erst, als er über die Hälfte der Strecke zu ihnen zurückgelegt hatte.
Der Mönch näherte sich. Er ging nicht, er lief nicht, er schlurfte nicht, sein Gang versteckte sich unter der Kutte, die fast über den Boden schleifte, aber nur fast, darum sah es so aus, als bewegte er sich auf Schienen. Der Mann blieb vor den Arbeitern stehen und machte zwei wortlose Verbeugungen wie ein Mandarin. Dann sagte er:
„Guten Tag, meine lieben Herren.“
Radebusch erwiderte:
„Guten Tag, lieber Herr.“ Er meinte es nicht ironisch, er fand die Anrede passend für einen Mönch, den er sonst nicht anzureden gewusst hätte.
„Ihr lieben Herren, wir verfolgen Ihre Aktivitäten seit geraumer Weile und können doch nicht glauben, dass Sie uns von Gott geschickt worden seien, um die Zufahrt zu reparieren, obwohl es fast den Anschein haben möchte, wenn ich in Augenschein nehme, was Sie bisher vollbracht haben.“
Er nickte dreimal. Die Männer sahen sich an (der redet vielleicht komisch). Radebusch behauptete nun:
„Wir haben vom Kloster den Auftrag.“
„Einen Auftrag durch das hiesige Kloster? Ja, ich bin wohl nicht informiert, meine Herren. Ich weiß davon ja gar nichts.“
„Ich kann es erklären und würde mich freuen, mit Ihrem Chef darüber zu sprechen.“
„Der Prior delegiert solche Aufträge an die Brüder, die dazu auserkoren sind.“
„Aber das Missverständnis ließe sich bald beheben, wenn ich mit dem Prior persönlich spreche, falls Sie nichts dagegen haben.“
Radebusch fixierte den Mann in der Kutte und machte dabei so beredte Augen, dass der in den ungewöhnlichen Vorschlag einwilligte. Radebusch verließ seine beiden Helfer und ging in Begleitung des Bruders Pförtner zum Kloster hinauf.
Der Gastpater ließ ihn in einer getünchten Kammer zurück. Ein schwarzes Holzkreuz ritzte die Wand neben der Tür. Die Hauptperson, bereits vom Leiden erlöst, hing nicht mehr am Kreuz, daher erschien es wie ein Symbol der Auferstehung. Es stach Radebusch in die Augen. Er wandte sich zum vergitterten Fenster. Auch lauter Kreuze: Ein Querbalken langte zum nächsten, ein Stamm stand auf dem anderen. Radebusch sah seine Kumpane. Sie schippten träge vor sich hin. Als es nichts mehr zu schippen gab und einer von ihnen mit dem Besen über die Straße wischte, öffnete sich ein Seitentürchen, herein trat ein junger Mann in Kutte und erkundigte sich, nachdem er zivil gegrüßt hatte, ob er, Radebusch, die Angelegenheit nicht mit ihm klären wolle, denn der Prior sei stark in Anspruch genommen. Fritz beschied knapp:
„Ich möchte mit dem Chef persönlich sprechen.“
Dabei schaute er dem Mann bedeutungsvoll in die Augen, so dass dieser rot wurde und sich schnell zurückzog. Im Hinausgehen murmelte er, man werde sehen, was sich tun lässt, und zog die Tür ins Schloss. Diesmal dauerte es nicht lange. Radebusch wurde in einen großen Raum geführt. Die Wände waren mit dunklem Holz verkleidet. Das Mobiliar im Bauhausstil hob sich von der Umgebung ab, ohne deplatziert zu wirken. Radebusch blinzelte umher. Er würde das obligatorische Kreuz schon entdecken. Gleichzeitig mit dem Eintritt des Priors sah er es, schräg abgestellt, in einer Ecke hängen. Der Prior, wie die anderen in eine Kutte gehüllt, trug eine Brille. Er warf mit einem Schwung die Tür hinter sich zu, ohne sie knallen zu lassen, und schritt ausholend (erkennbar schreitend, trotz Kutte) auf Radebusch zu, streckte ihm die Hand entgegen und rief:
„Seien Sie willkommen. Sie sind einem Irrtum aufgesessen, höre ich?“
Radebusch war eingeschüchtert, auch weil er nicht wusste, wie man einem Abt oder Prior begegnet. Er stellte sich vor und rückte endlich damit heraus, dass die Straßenarbeiten eine Finte seien, um unauffällig in einer wichtigen Sache, einer sehr wichtigen, mit ihm, dem Abt, den er vermutlich vor sich habe, sprechen zu können. Radebusch vergaß nicht herauszustreichen, dass er kein Katholik sei, überhaupt keiner Kirche angehöre, dass aber „in diesen Zeiten“ Sozialisten und Christen zusammenhalten müssten. Er wolle das aber nicht zum Hauptgegenstand des Gespräches machen. Es gehe vielmehr um Leben und Tod. Dann folgte, ohne dass der Prior ihn unterbrochen hätte, die Geschichte von Urbanski und der Hausdurchsuchung in der Hartkopfschen Kiesfabrik. Und schließlich:
„Wir haben uns gedacht, dass Sie Ihrem Glaubensbruder helfen könnten.“
Der Prior wies mit dem Arm auf die Stühle, was einer späten Aufforderung gleichkam, sich zu setzen.
„Sie bringen mich in eine unangenehme Lage“, bemerkte er und hob gleichzeitig beide Hände in eine Abwehrhaltung, die besagen sollte, dass ein Einwand Radebuschs noch zu früh sei.
„Zuerst müsste ich mich Ihrer vergewissern“, er lächelte, „ich weiß von Ihnen nicht mehr, als dass Sie vorgeben, einen Auftrag von uns zu haben, und nun behaupten, einen Menschen bei uns verstecken zu müssen.“
„Wer ich bin, können Sie in der Firma Hartkopf erfahren.“
„Wenn ich Sie richtig verstanden habe, verträgt Ihre Mission keine fernmündlichen Absprachen.“
Natürlich, Fritz ärgerte sich über sich selbst und antwortete schnell:
„Ich kann Ihnen keine Beweise meiner Vertrauenswürdigkeit geben. Ich wüsste nicht wie.“
„Hat Herr Urbanski, Sie sagten doch Urbanski, etwas mit dem Mord zu tun?“
„Nein, ganz sicher nicht.“
„Aber er wurde bei Ihnen gesucht. Es bestand also ein gewisser Verdacht?“
„Nur weil er Zwangsarbeiter ist und zur fraglichen Zeit nicht im Büro war.“
„Er war zur Zeit des Attentats nicht bei Ihnen, obwohl er normalerweise dort hätte sein müssen?“
„Er war zur Zeit der Hausdurchsuchung nicht bei uns, sondern auf einer unserer Baustellen.“
„Woher soll ich wissen, dass er mit dem Mord nichts zu tun hat? Wenn ich einen Mörder decke, sind meine Brüder in Gefahr. Das Kloster selbst, die Heimstätte von zwanzig Menschen, mit Gebäuden, Ländereien steht auf dem Spiel. Es wäre nicht das erste Mal in den letzten Monaten, dass der Staat Kirchengüter einzieht, Menschen vertreibt oder in Lager sperrt.“
Der Prior sah Radebusch durch die randlose Brille an. Sie macht ihn jünger als er vermutlich ist, dachte Fritz, ein Bürokratentyp, ein Beamter – wäre normalerweise nicht mein Fall.
„Urbanski war es nicht. Ich könnte es beschwören.“ Radebusch hörte sich selber zu. „Er kann es nicht gewesen sein. Er hat Frau und Kinder. Er kommt aus der Krakauer Gegend.“
Der Prior hatte den Kopf nach hinten gelegt, die Beine übergeschlagen, sein Kinn wurde von einem Daumen gestützt. Der Zeigefinger war damit beschäftigt, gegen die Nasenflügel zu klopfen. Wie würde die Aufzählung der Tatsachen: a) verheiratet, b) Vater und c) Krakauer die Unschuld Urbanskis beweisen?
„Ich habe Masrat umgelegt.“
Radebusch kannte sich selbst nicht mehr. Wie kam er dazu, dem Mann vor ihm etwas zu gestehen, was er nicht einmal seiner Frau, die es verdammt nochmal etwas anging, zu sagen gewagt hatte! Der Klostervorsteher erhob sich abrupt, indem er seine Hände auf die Schenkel stützte und sich hochkatapultierte. Er drehte sich zum Fenster und spielte hinter seinem Rücken nervös mit den Fingern. Radebusch war einen Augenblick lang unsicher, ob die Ursache für die Nervosität des Mannes nicht im Innenhof oder auf der Straße zu suchen wäre, so angestrengt blickte der Mönch hinaus.
„Wenn er geschnappt wird, dann müssen Sie sich melden.“
„Ja“, sagte Fritz, „das müsste ich wohl.“
„Sie erhalten den Auftrag zur Beseitigung der Schlaglöcher. Schicken Sie Urbanski her.“
Daniel drehte den Stoffbären mit beiden Händen von einer Seite zur anderen. Dann schien er ihn mit der Handfläche wiegen zu wollen. Dabei schaute er Frau Radebusch fragend an. Sie hatte ihm den Bären wie beiläufig zusammen mit den Lebensmitteln und den Büchern auf den Tisch gepackt.
„Wussten Sie“, fragte die Frau, „dass ‚Teddybär‘ von Theordore Roosevelt kommt? Jemand hat ihn aus Verehrung des Präsidenten der Vereinigten Staaten so benannt, des Präsidenten vor dem letzten Krieg, noch zu Kaisers Zeiten.“
Sie flüsterte, als wäre diese Mitteilung von äußerster Wichtigkeit und als könnten sie hier belauscht werden.
„Mein Mann und ich haben sie im Feindsender gehört, die Geschichte des Teddybären. Das Abhören ist strafbar. Es soll Todesurteile setzen.“
Frau Radebusch verhielt sich so, als deutete allein der Besitz eines Teddybären auf das heimliche Abhören alliierter Sender hin und als müsste darum ein Teddybär so schnell wie möglich aus dem Gesichtskreis zufälliger Besucher in Radebuschs Wohnung verschwinden.
Verrückt! Die glaubt doch nicht wirklich, ein Kinderbär sei bereits ein Indiz für angloamerikanische Umtriebe oder das Symbol deutscher Spione im Dienst der Alliierten? Sie hat vor Jahren ein Kind verloren. Warum gibt sie jetzt den Teddy aus der Hand, mit dieser überspannten Begründung? Die Tierpuppe, ziemlich schwer, lange Schnauze, engstehende Glasaugen, sah so aus wie die Bären im Kölner Zoo. Daniel wusste, dass man gebrauchte Stofftiere und Puppen nur aus Liebe verschenkt oder als Vorschuss auf Liebe, die entstehen und sich bewähren soll. Die blaue Schleife saß adrett um den dicken Nacken. Die Naht am Rücken verlief sauber gestochen, wie neu. Daniel untersuchte sie in der Annahme, dass in dem Tier etwas für ihn versteckt sei. Aber er konnte keine Öffnung finden, die ihm darin Recht gegeben hätte, und er wollte von sich aus den Teddy nicht aufschlitzen. Er war eine Erinnerung an das tote Kind und ihm, Daniel Spielstein, anvertraut worden. So beschloss er, ihn sorgfältig aufzuheben, legte ihn auf Zeitungspapier und schob ihn unter sein Feldbett. Kann sein, dass Frau Radebusch etwas verrückt ist, leicht durcheinander, oder die Welt ist verrückt geworden - oder du selbst. Frau Radebusch war eine praktische Frau. Wenn man Daniel Spielstein, den Juden, entdeckte, dann würde ihn niemand und nichts retten – ob man bei ihm die Pistole fände, wäre dann schon egal.
Luise Radebusch, die Frau von Fritz und Philipps Mutter, starb am 4. Dezember 1944 auf einem Pfad entlang der Eisenbahn. Sie suchte nach Resten Grünkohl auf den Feldern, als Tiefflieger einen Zug durch Oplyr angriffen. Außer ihr starben an diesem Weg zur selben Zeit noch achtzehn Menschen, darunter ein Kind.