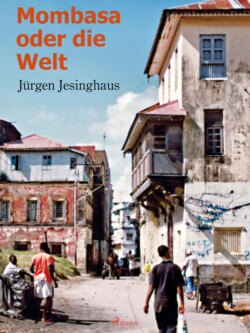Читать книгу Mombasa - Jürgen Jesinghaus - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.
ОглавлениеImmer häufiger kam er auf die Dernauer Verwandtschaft zu sprechen, und eines Tages wusste er genau, was er wollte: nach Amerika auswandern, zunächst alleine, um seiner Familie den Boden zu bereiten. Um 1930 stand ihm dieser Entschluss klar vor Augen. Drei Jahre des Kampfes um Entschlüsse und Zukunftspläne waren für Daniel und seine Mutter eine schwere Zeit. Dan, der in den glücklichen Jahren der 1920er in der Familie einen festen Platz eingenommen hatte, fühlte sich vernachlässigt. Die Dernauer Verwandtschaft rückte zusehends in den Mittelpunkt der Familiengespräche, die sich nach Feierabend am Küchentisch entspannen. Die Mutter wollte nicht nach Amerika. Je mehr sie ihren Standpunkt verdeutlichte, desto mehr beharrte Prosper auf der seiner Ansicht nach einzigen Lösung, der deutschen Misere zu entfliehen und „drüben“ wohlhabend zu werden.
Die Spielsteins hungerten zwar nicht, aber sie lebten von der Hand in den Mund, und am Ende eines Monats war alles aufgebraucht bis auf ein paar Pfennige. Dieses kupferbraune Häufchen diente der Frau als schlagendes Argument gegen den Auswanderungsplan ihres Mannes, der umgekehrt im Geldmangel die Berechtigung zum Aufbruch in eine bessere Zukunft erkannte und in sich einen Abraham, einen Moses oder Josua erblickte, der allen Widerständen zum Trotz aufbrechen würde in ein gelobtes Land, wo er als Farmer ein patriarchalisches Leben zu führen gedachte. Seine Hoffnung war die Dernauer Verwandtschaft. Sie nahm (wenigstens für ihn) konkrete Konturen an, als er einen Brief aus den USA empfing, der eine allgemein gehaltene Einladung enthielt: Wenn er die Überfahrt würde finanzieren können, sei der Rest kein Problem. Mit einer großen Anstrengung gelang es der Familie, einen Betrag anzusparen, mit dem man die Passage auf einem Schiff bezahlte, an das der Reisende keine Ansprüche stellen durfte. Man bedauerte die Witwe und den jungen Mann, der, obwohl im heiratsfähigen Alter, nichts für die Gründung einer eigenen Familie hatte zurücklegen können. Welcher Art Flucht Prospers Auswanderung war, niemand weiß es genau. Später hieß es, er habe alles kommen sehen. Wenn dein Vater durchgekommen wäre, mit etwas mehr Glück, dann säßest du jetzt in Washington oder New York, und du könntest mir von Zeit zu Zeit eine Ansichtskarte vom Weißen Haus oder vom Empire State Building schicken. Das war so eine Redensart von Heinz Ollet, dem Müllkutscher, die er zu variieren pflegte, wenn Dan und er über sich sprachen (aber davon später mehr).
Der Abschied war auf einen Dienstag anberaumt worden. Die Familie wusste in ihrer Bekümmerung nicht, wie ein solcher Abschied vonstatten ginge. Aber schon am Montag war Prosper verschwunden und wurde nie wieder gesehen. Aus einem nicht mehr nachvollziehbaren Grund ist er aus Le Havre abgedampft. Er hat später nichts anderes darüber geschrieben, als eben die Wiedergabe dieser Tatsache. Vielleicht war sie für ihn so einleuchtend, dass er eine Erklärung nicht für erforderlich hielt, und vielleicht war es tatsächlich nur der niedrige Fahrpreis, der ihn dazu bewog, ein Schiff in Le Havre zu besteigen. Andererseits hielt sich das Gerücht, nachdem es einmal aufgekommen war, dass er unterwegs jemanden aufgelesen und mitgenommen hatte, den großen Unbekannten oder die unsterbliche Geliebte. Daniels Mutter hing der zweiten Deutung an und litt. Dan wiederholte ständig: Es war der Preis, Vater hat sich umgehört und erfahren, dass in Le Havre ein billiger Frachter in die Staaten fährt. Aber warum die vorzeitige Abreise? Warum sagte er nichts? Ja, warum. Prosper hat darüber kein Wort verloren, obwohl man ihm Schreibfaulheit nicht vorwerfen konnte. Er berichtete von erfolgreichen Unternehmungen, und eines Tages, dass er endlich eine Anstellung in Aussicht habe. Diese Mitteilung bedrückte die Familie, weil aus ihr hervorging, dass die erfolgreichen Unternehmungen geschwindelt waren, um die Daheimgebliebenen zu trösten. Die Aussicht, in irgendeinem Lagerverwaltungsbüro in New York (die Briefe kamen alle aus NY) zu arbeiten, hatte ihn so ergriffen, dass er unversehens in einen Ton aufrichtiger Berichterstattung gefallen war und so einen Schimmer der Wahrheit über seine tatsächliche Lage preisgab. In der Dernauer Verwandtschaft war er herumgereicht worden, aber er hatte nirgendwo einen sicheren Unterschlupf gefunden, er war dort der Fremde aus der Heimat, aus der fremden Heimat. Das reichte für freundliche Worte, auch für ein wenig Geld.
1933 traf der teuerste Brief von allen ein, ein dickes Luftpostschreiben aus New Jersey. Mehrere Seiten wurden darauf verwendet, die Empfänger auf die erschütternde Nachricht vorzubereiten und zu schildern, ein wie tapferer, ein wie fürsorglicher Mann Prosper gewesen sei, da er trotz seiner Behinderung versucht habe, für seine Familie und sich, in erster Linie aber für seine Familie, eine neue Existenz in dem demokratischsten Land der Erde aufzubauen, eine Aufgabe, die trotz der zahlreichen Unterstützung, die er in der neuen Welt erfahren habe, eines Samsons würdig gewesen wäre. Die Nachricht selbst: Der Tränenwischer ist im Hafen tot aufgefunden worden mit einer klaffenden Kopfwunde, so dass die Polizei Mord nicht ausschließt. Der Brief deutete an, dass er einige Male aufgelesen worden sei und einmal in ein Männerasyl („zusammen mit Negern“) gesteckt worden war. Monate später kam der amtliche Bescheid: in Yonkers gestorben vermutlich an den Folgen einer alten Verletzung. Der Tote hatte außer den Personalien, die ihn als „a certain Prosper Spielstein“ aus dem Deutschen Reich auswiesen, nichts bei sich. Seine Aufenthaltsgenehmigung war abgelaufen. Die Beisetzung habe in Paterson, NJ, stattgefunden, die Kosten seien von Verwandten beglichen worden.
Daniels Mutter hat ein Wochenende vor sich hin geweint und ist in Erinnerungen geschwommen. Ein paar Fotos wurden zusammengekratzt, Briefe geschrieben. Danach war sie eine alte Frau, von einer Woche zur anderen. Prosper hatte sich ein für allemal einer Erklärung entzogen. Die Kränkung war unheilbar. Daniels Mutter starb am gebrochenen Herzen, so sagt man (wie soll man es besser sagen). Dan lernte, alles der Kriegsverletzung zuzuschreiben, und kein Mensch weiß, ob dieser Glaube nicht sogar den Tatsachen entspricht.
Daniel durfte als Kalfaktor in der Schuhfabrik arbeiten, wo sein Vater einen wichtigen Posten bekleidet hatte. Aber 1933 wurde er entlassen. Man warf ihm vor, das ihm anvertraute Geld eines Kollegen veruntreut zu haben. Als die Firmenleitung nach langen rufschädigenden Untersuchungen die Sache auf sich beruhen lassen wollte, um die Justiz nicht zu bemühen, weil der Vorwurf des Kameradendiebstahls nicht erhärtet werden könne, willigte Daniel angewidert in die Kündigung ein, die trotz mangelnder Beweise ausgesprochen worden war und die er der Judenfeindlichkeit der neuen Regierung ankreidete. Im selben Jahr fing er bei Hartkopf an, vielleicht weil sich die Väter kannten und die Jungen, Daniel und Gustav (der Erbe) sich angefreundet hatten. Daniel selbst datierte seine große Liebe zu Gustavs Halbkusine in das Jahr 1934. In seiner Erinnerung hatte man sogar von einem Verlöbnis gesprochen. Und dann war plötzlich nicht mehr die Rede davon, und der alte Hartkopf pflegte nur noch einen förmlichen Umgang mit Daniel. Aber Dan durfte seine Stelle behalten. Damals war die große Zeit des Kirchgängers Bernhard Hartkopf, der seinen Bedarf an Ausübung religiöser Pflichten für den Rest seines Lebens deckte. Es wird überliefert, er habe mit seinem Kirchgang ein Zeichen dafür setzen wollen, dass mit der „neuen Zeit“ nicht alle Werte verloren gingen. Angeblich hat man ihn deswegen nach Bonn bestellt, wo er die Aussage näher erläutern sollte. Aber erst Gustav Hartkopf, der Erbe, war tatsächlich in einer „politischen“ Angelegenheit in der Gestapo-Zentrale am Kreuzbergweg.
Daniel Spielstein ging 1941 in die „Illegalität“. Er bezog eine Wohnung im Haus, das sein Vater, der Augenwischer, gerne gekauft hätte, aber Bernhard Hartkopf schließlich gekauft hatte. Er nannte sich Spielsin – Spiälsin (Betonung auf ‚äl‘). Das Versagen einer behördlichen Schreibmaschine, nämlich das am Typenhebel hochgerutschte ‚e‘ (der am häufigsten benutzte Vokal hatte den Fliehkräften nicht mehr standgehalten), die Schludrigkeit eines Beamten und die eigene genialisch-schwungvolle Unterschrift gestatteten eine Lesart in seinem Pass, die ihm die vielleicht lebenswichtige Namensänderung vom jüdischen ‚Spielstein‘ ins christlich-polnische ‚Spielsin‘ ermöglichte - Spiälsin („mein Name ist Spiälsin - das konnten Sie nicht wissen“).