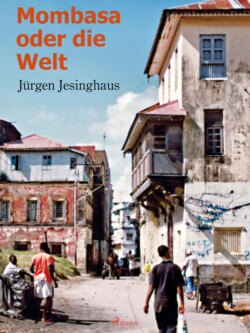Читать книгу Mombasa - Jürgen Jesinghaus - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
12.
ОглавлениеWer sich an die Pfadfinder-Regel hält, nämlich dass Kirchen durch die Ausrichtung ihrer irdischen Hülle der Orientierung des Menschen dienen, der irrt sich hier: Der Chor zeigt nach Norden. Und die Bäume im nahegelegenen Park des Greinschen Hotels verhalten sich neutral: Das Moos bevorzugt keine Richtung. Der Westen ist verstellt durch den Vorberg, in dessen Schatten die Buchen groß geworden sind. Auf den Kompass-Lattich, der zwischen Kirchenchor und Nachbargrundstück wächst, ist auch kein Verlass. Er zeigt, wohin er will, und wer sich im anvertraut, hat auf Gott gebaut. Die Pfadfinder haben es ohnehin schwer, in dieser Gegend jeden Tag eine gute Tat zu vollbringen, um die Zeit im Fegefeuer zu verkürzen, denn die Tragödien spielen sich im Verborgenen ab, im Rücken der Gartenzwerge, vor geblümten Tapeten. Bettler gibt es nicht. Die rüstigen Alten finden allein über die Straße. Für die anderen Alten („unsere lieben Alten“) sorgt der Pfarrer persönlich. Und die Arbeitslosen wenden sich an die Bundesanstalt. So ist das hier (oder so war es). Dass bei der alten Sebastiankirche in Oplyr die wegweisende Regel verletzt wurde und der Chor dem Sonnenaufgang seine Reverenz versagte, liegt an den Eigentumsverhältnissen im alten Ortskern. Das rechteckige Grundstück grenzt mit seiner Längsseite an die Heerstraße entlang dem Vorberg und mit der kurzen Seite an die Querstraße, die hinter der Kreuzung steil bis auf die halbe Höhe des Vorbergs führt. Neben dem gittereisernen Portal zum Greinschen Hotel flacht die Straße ab und streicht in Richtung des Vorbergs, als wäre der direkte Anstieg selbst für eine Straße auf Dauer zu anstrengend, als bedürfte sie einer Verschnaufpause, bevor sie an der Wirtschaft „Alt-Oplyr“ das letzte Stück bis zum Rand des Hochplateaus zurücklegt und von hier oben einen Blick über die Bäume des Hotelparks und über den Turm der sich regelwidrig verhaltenden Kirche hinweg ins Rheintal freigibt. Von hier erkennt man gut das Hartkopfsche Grundstück, die gelben, angerosteten Türme des Kieswerks, die wie Dosen am Rande des Anglerparadieses stehen, dessen Wasserflächen wie Stecknadelköpfe blinken. Der Strom verdunstet unter dem körnigen Mittagslicht.
Der Pfarrer stand im Durchgang zwischen Narthex und Schiff, an dessen linker Wand deutlich ein Riss zu erkennen war. Von der Empore aus hätte jemand seine Hand bis zu den Ballen hineinstecken, die Kälte und den Zug spüren können. Dieser Riss, so hieß es, ließ sich nicht mehr stopfen. Seinetwegen müsse das Schiff der Sebastiankirche abgebrochen werden. Dieser eine Riss hatte den Wunsch aufkommen lassen, nach weiteren Rissen zu suchen, und es waren im feinen Netz des zersprungenen Putzes Linien entdeckt worden, die schwärzer als die anderen gezeichnet waren, als wäre ein Blitz, von der Feuchtigkeit der Wände angezogen, hinter dem Verputz zwischen den Fugen von Stein zu Stein springend in den Erdboden gefahren – als Zeichen drohenden Verfalls, ja (der Pfarrer wusste es so hinzustellen) als Zeichen drohenden Unheils. Der hochwürdige Herr trug einen Trenchcoat, seine Linke stak in der Tasche, mit der rechten Hand wies er zwei Arbeiter an, das Kruzifix im Chor abzumontieren, ein Eichenkreuz, mannshoch und braun gestrichen, mit kleeblättrigen Enden. An ihm hing ein Holz-Christus und bot sein Leiden dar. Der Pfarrer wollte es in der neuen Kirche wieder aufrichten lassen. Das Kreuz war in einem Sandsteinsockel verankert. An den Schrauben hatte seit achtzig Jahren keiner mehr gedreht. Die Schlüssel passten nicht. Sie zerquetschten die Schraubenköpfe. Der Arbeiter im blauen Overall presste zweimal „verdammt“ aus sich heraus, ließ den Schlüssel fallen, erhob sich, griff in die Tasche, riss ein Tuch hervor und presste es auf die Knöchel seiner Hand, die, ein Opfer falscher Berechnung und der eigenen unbändigen Kraft, gegen eine Kante des achteckigen Sockels aufgeschlagen war. Er stopfte das Tuch zurück und steckte die Knöchel in den Mund, um den Schmerz durch Lutschen zu beruhigen und die blutige Haut seinem Blick zu entziehen. Er rief etwas, was der Pfarrer nicht verstand.
„Was sagen Sie, nichts geht?“
„Verdammt, der Schlüssel passt nicht. Keiner weiß, wo die Schraube aufhört und der Stein anfängt. Alles fest zusammengebacken, Eisen, Holzdübel und Stein. Nichts zu machen.“
„Wieviel Schrauben sind es denn?“
„Vier. solche Kaliber. Wir müssen den Stein weghauen - oder das Kreuz absägen. Wie hätten Sie es denn gerne, Hochwürden?“
„Schlagen Sie den Stein weg. Wir zementieren später das Loch zu und setzen neue Schrauben ein.“
Drei Männer, darunter der Pfarrer, verließen in kurzen Abständen die Kirche. Die Arbeiter holten Stemmeisen, Meißel und Hammer. Sie kramten das Werkzeug aus dem Kofferraum ihres PKW und griffen zwei Bierflaschen aus einem Kasten, der auf dem Rücksitz stand. So beladen kehrten sie zurück, setzten sich auf eine Bank in der verstaubten hintersten Ecke des Chores, den (seltsam genug) zwei Kakteen zierten. Die Männer tranken bedächtig glucksend ihr Bier, schauten auf die Verankerung des Kreuzes und ließen im Schwung des Trinkens ihren Blick weiter am Stamm nach oben fahren.
„Hinten rohes Holz.“
„Sieht ja sonst keiner.“
„Die Viereckschrauben, an dem er hängt, sind auch nicht ohne. Ich wollte den nicht abnehmen müssen und zu Grabe tragen.“
„Aber saubere Arbeit! Der hängt bombensicher, lässt sich gut transportieren.“
In einer halben Stunde war der Stamm aus dem Stein gelöst. Sie hatten das Kreuz an den nackten Altar gelehnt, als der Pfarrer zurückkam.
„Am besten, Hochwürden, wir lassen alles, wie es ist, und zementieren ihn in der neuen Kirche wieder ein.“
„Ja, Herrgott, warum haben wir denn nicht alles so gelassen und das Kreuz einfach mit dem Sockel transportiert?“
„Weil Sie ihn abgeschraubt haben wollten. Sie hatten Angst, wir beide könnten ihn nicht mit Sockel alleine transportieren.“
„Zu ärgerlich! Tragen Sie beides jetzt bitte zur neuen Kirche!“
Die Arbeiter nahmen das Kreuz, trugen es wie eine Bahre aus dem dämmerigen Kirchenraum ins Freie zu ihrem Auto, öffneten den Kofferraumdeckel und schoben es - Füße voran - schräg über die Sitzlehnen bis zur Frontscheibe. Der Kofferraum ließ sich nicht schließen, das Haupt des Gekreuzigten ragte über den Rand hinaus, Blick abwärts gerichtet. Der Pfarrer schritt voran, als hätte er mit diesen ungeschickten Arbeitern und dem peinlichen Transport nichts zu tun. Ein Arbeiter lief im Abstand von einigen zehn Metern hinterher, denn der Beifahrersitz war für den Stamm und die mächtigen, mit Holzfetzen und Steinresten umgebenen Schrauben reserviert. Der Fahrer fuhr, mit der Rechten die Schrauben haltend, um den Stamm am Hinausrutschen zu hindern, an dem Pfarrer vorbei, der sich in seiner Würde nicht beirren ließ. Einen Kilometer weiter endete die Fahrt. Das Haupt des hölzernen Christus perlte, als hätte er geschwitzt. Es war verrusst. Als der eine Arbeiter eintraf, zog er abermals sein Taschentuch hervor und säuberte das hölzerne Antlitz.
„Das bekommt dem Material nicht. Wir hätten ihn anders legen müssen.“
Aber die Sorge galt nicht dem Material. Es geschah aus Mitleid mit einem, der seine Nase zwei Minuten, ohne sich rühren zu können, in den nassen Qualm eines Auspuffrohrs hatte halten müssen. Die beiden nahmen das Kreuz, als trügen sie einen verletzten Fußballspieler vom Platz, und schleppten es in die neue Kirche, die von der Straßenbahntrasse durch eine Reihe dünner Tännchen getrennt war.
„Bringen Sie ihn hierher, hierher, und legen Sie ihn dorthin, dorthin. Danke. Meine Köchin braut ihnen gerne einen Kaffee.“
„Später, wir holen zuerst den Sockel, und wenn ihre Köchin dann vielleicht ein Bier hätte?“
Eines Tages flatterten weiß-rote Bänder zwischen Gabeln aus zusammengeschweißten Moniereisen. Sie surrten und ratterten. ‚Fußgänger, andere Straßenseite benutzen!‘ Auf dem Bürgersteig stand ein Container, den eine Holzschütte mit dem Kirchendach verband. Die Schieferplatten, die durch den rechteckigen Holzschlauch flogen, konnte keiner mehr gebrauchen. Keiner wollte damit sein Gartenhäuschen täfeln, niemand sein Dach abdichten, keiner die Theke seines Partykellers verkleiden. Auch von Grein, der Hotelbesitzer, schien keine Verwendung dafür zu haben (er war gefragt worden), so dass nun die Platten in dem eisernen Behälter zerbarsten und auf die städtische Deponie gebracht werden mussten. Das hölzerne Kirchendach wurde entkleidet. Das Schiff sah aus wie ein räudiges Tier, dessen blaugraues Fell mehr und mehr verschliss bis auf die helle Haut. Bevor die letzte Schiefer in die Schnauze der Holzschütte geworfen wurde, hatten die Dacharbeiter (die in ihrer jetzigen Funktion den Namen nicht verdienten) damit begonnen, die Fichtenplanken aufzustemmen und in das Kircheninnere zu werfen. Die Bestuhlung war längst entfernt worden, die Empore abgerissen (einige hölzerne Versatzstücke sind in den Häusern von Gemeindemitgliedern verschwunden). Der Chor wurde als erstes niedergebrochen, so dass der Autofahrer, der Radfahrer oder Fußgänger, der von Norden über die Heerstraße kam, in die gähnende Steinschachtel blicken konnte. Er staunte dann, wie dünn die Wände waren im Vergleich zu dem Raum, den sie wie ein Häutchen umspannten. Er traute ihnen den Widerstand gegen einen Sturm nicht zu und befürchtete, ein Regen würde sie aufweichen. Sie wirkten wie Papier. Im Chor entstand allmählich ein Hügel aus Steinen, für die sich ein Käufer gefunden hatte, der mit dem ehrwürdigen Debris die Betonmauer seines Häuschens verkleiden wollte, um eine altväterliche Bauweise und die Gediegenheit (die man vergangenen Zeiten andichtet) vorzutäuschen. Bald sah das Schiff aus wie eine antike Ruine vor einem neugotischen Kirchturm, denn die steinerne Schachtel war unterteilt in drei Streifen durch zwei Reihen, die aus je vier Säulen mit korinthischen Kapitälen bestanden. Die Säulen hatten die Emporen und die Dachkonstruktion getragen. Erst nach ihrer Zerlegung würde der Bagger in das Haus Gottes einziehen, den Rest der Außenhaut einstoßen und alles mit dem Staub alten Mörtels beweihräuchern.
Schon in der folgenden Woche waren die Säulen in acht Teile zerlegt worden. Ihre Kapitelle teilten sich Stadt und Kirchengemeinde. Zwei davon flankierten den Eingang des Pfarrhauses hinter der Betonkirche, zwei lagen im pfarrherrlichen Garten zwischen Birken und Tännchen auf einem Rasen und muteten dem Gärtner zu, den großen Rasenmäher gegen eine elektrisch betriebene Rasenschere einzutauschen, denn kein Halm und kein Löwenzahn durfte sich mit den Akanthusblättern messen! Die übrigen Kapitelle zu suchen, war (und ist noch) eine lohnende Aufgabe an Sonntagnachmittagen zwischen Kompott und Kuchen.
Die eiserne Birne pendelte im Hause des Herrn. Sie machte kurzen Prozess mit dem Schemel, darauf ER seine Füße setzt. Die dünnen Wände knickten wie Hostien. Die Fensterrahmen verdrehten sich wie der Draht einer Papierklammer unter den Händen eines nervösen Beamten. Das Glas war wertlos, undurchsichtig grau, mit Draht durchzogen. Nur die Oberlichter an zwei Fenstern im Nordosten stammten aus der Bauzeit der Kirche. Das jedenfalls vermutete Ellen Finke, eine Lehrerin am Beethoven-Internat (von ihr wird noch die Rede sein), die sich für die Abbrucharbeiten interessierte und sich vorgenommen hatte, eine Messe zu besuchen, als es längst zu spät war. Da ihr an einem Gottesdienst in der neuen Kirche nichts lag, wartete sie eines Tages das Ende der Messe ab, setzte sich auf eine der Bänke, die den gepflasterten Parkplatz säumten (sie bestanden aus Teilen der zersägten Säulen). Auf je zwei Stümpfen lagen zwei Bretter und formten eine Bank. Ellen sprach die alten Frauen an. Alle konnten sich daran erinnern, dass an den Fenstern vorn rechts und ziemlich oben noch buntes Glas eingelassen war, das der Sonne erlaubte, Strahlenbündel in den grauen Chor zu senden, wo sie manchmal den Leib des Herrn beleuchteten, an schönen Sommertagen, wenn man sich wünschte, wieder draußen zu sein: Da kam das Licht aus der Ecke und war schön blau und rot. Sie hatten oft darauf geachtet.
„Wissen Sie, er war wie eine Sonnenuhr, es hätte ab Mai keine bessere Sonnenuhr geben können. Wenn das blaue Licht seine Achseln erreichte, ob Sie es glauben oder nicht, dann stand die Wandlung kurz bevor, und wenn das rote Licht seine Wunde beleuchtete, dann, dann ereignete sich die Wandlung. Dann fand sie statt. Was habe ich gesagt? Ja. Ich habe mir immer etwas dabei gedacht. Man hätte die Kirche nicht abreißen dürfen!“
„Waren das die einzigen Fenster?“
„Ja, die einzigen. An der Straßenseite waren oben Löcher, einige offen, andere mit Pappe oder Sperrholz zugenagelt, sonst nur uni Glas. Von dort herein kam niemals Licht, nicht so ein Licht, das aussieht, als leuchtete einer mit einer Taschenlampe auf den Altar.“
„Waren die Dreiecke ausgefüllt?“
„Dreiecke? Was für Dreiecke?“
„Ich meine, waren die Spitzbogen oberhalb des Fensters mit buntem Glas gefüllt?“ „Ja, wir glauben das.“
„Haben Sie erkennen können, welche Motive verarbeitet waren?“
„Welche Motive?“
„Was zeigten die Glasfenster?“
„Einen Teufel. Wir haben uns auch gewundert.“
„Haben Sie das von Ihrem Platz aus sehen können?“
„Nein. Meine Augen sind zu schwach, aber das Kind sagt, es ist der Teufel. Wir wissen es zwar nicht, aber die Kinder sagen es. Ich glaube es eigentlich nicht, denn ein Teufel gehört nicht in die Kirche.“
Ellen bat den Pfarrer darauf zu achten, dass beim Abbruch das Fensterglas im Nordosten nicht beschädigt werde, es könne wertvoll sein.
„Es ist leider zerborsten, aber wir glauben nicht, dass es wertvoll gewesen ist, sehen Sie, es hält keinen Vergleich mit den Fenstern von Chartres aus, nicht wahr, das haben Sie auch nicht erwartet. Ich glaube vielmehr, die Arbeiter haben Zielwerfen geübt. So etwas lässt sich kaum vermeiden. Die meisten Fensterflächen waren nicht zu gebrauchen und völlig ohne Wert. Völlig.“
„Es sollen noch Figuren erkennbar gewesen sein?“
„Ja, die Kinder glauben, in einer Figur den Teufel erkannt zu haben. Sehen Sie, um so besser, dass die Fenster entzwei sind. Nun, es war gewiss der gehörnte Moses, der den Alten Bund symbolisiert. Die Hörner verdankt er einem Übersetzungsfehler. Wie Sie wissen, hat ein Mönch vor vielen hundert Jahren das lateinische Wort coronata zu cornuta verfälscht, und seitdem gefallen sich die Künstler darin, Moses mit Hörnern darzustellen, und der unsrige hatte geradezu ein Geweih auf dem Schädel, so dass einige Herren früher in ihm den heiligen Hubertus zu erkennen meinten, der ihnen den Jagdschein entgegenhält. Das sollte ein kleiner Scherz gewesen sein.“
Nachdem Holz, Steine und alles Eisen fortgeräumt worden waren, wurde die klaffende Öffnung in der Nordseite des Turms zugemauert - in einem Halbkreis, der den Eindruck hervorrief, als hätte sich der Chor dicht an den Turm geschmiegt. Als dieses Werk des Kirchenbaus vollbracht war, wurde der lehmige Untergrund, auf dem das Schiff gestanden hatte, aufgekratzt und abgetragen, mit Sand gefüllt, zubetoniert und asphaltiert. Wochen später malten Anstreicher mit blütenweißer Farbe ein Gitternetz auf die Fläche, zogen einen Gitterdraht und schnitten eine Öffnung hinein, groß genug für Autos. Jetzt erst, nachdem das große ‚P‘ auf dem Schild die Bestimmung des Ortes enthüllte, trauten sich die Autofahrer ihre Autos dort zu parken, wo einige von ihnen noch die heilige Kommunion empfangen hatten, und heute der Parkplatz Nr. 8 ein wichtiges wirtschaftliches und kulturelles Bedürfnis in Oplyr befriedigt.
Nur der Turm des Baumeisters Adam Rüppel blieb also erhalten. Kies und Beton der neuen Kirche stammte aus dem Hartkopfschen Werk. Daniel Spielstein, der nicht mehr in seiner Löwengrube hausen musste, sondern in einem Gebäude der ehemaligen Reichsbahn, der heutigen Bundesbahn, Daniel, der wieder oder immer noch bei Gustav Hartkopf arbeitete, hatte alle Fuhren koordiniert, die Einnahmen verbucht, Steuererklärungen gemacht, mit einem Wort: die Büroarbeiten verrichtet. Ihm durfte man sie nicht zur Last legen - die Katastrophe. Am Freitag (einem 8. nebenbei bemerkt) um 17 Uhr 3 brach der Baldachin aus Beton über dem Portal der neuen Kirche herunter und verteilte sich so auf dem Vorplatz, dass der Pfarrer nur mit Mühe seine Kirche durch den Haupteingang betreten konnte. Niemandem war etwas passiert. Das Architekten-Konsortium wusste sich fein herauszureden. Die Betonkonstruktion „als solche“ (als Konstruktionsprinzip) sei bewährt, sogar Architekten der Ostzone, der sogenannten DDR, beherrschten diese Technik. Der Einsturz könne auch nicht durch Depassivierung verursacht worden sein, Kohlendioxid oder Chlorid-Ionen dürften nicht haftbar gemacht werden, denn die Kirche sei nicht einmal konsekriert worden.
„Was für eine Logik“, Gustav Hartkopf tobte, „ich mache keine Chlorid-Ionen haftbar, ich mache diese Architekten haftbar! Idioten! Nicht konsekriert! Stürzen nur konsekrierte Kirchen ein? Das Bonner Münster steht heute noch! Das waren wenigstens noch Architekten. Die kannten ihr Material!“
Trotzdem, man schob es auf den Kies, den Grundstoff, denn für Korrosion sei noch gar keine Zeit gewesen. Seinen Ruf in der Baldachin-Affäre konnte Hartkopf allerdings dadurch retten, dass er zweimal vor der Presse und einmal vor einem Ratsausschuss die markigen Sätze formulierte: „Oplyrscher Kies ist Qualitätsware“ und: „Ich selbst stamme aus dem Grund und Boden der Heimat.“ Daniel war milde verärgert darüber: „Die Presse wird uns vorwerfen, den Grund und Boden der Heimat jahrzehntelang verkauft zu haben. Du stehst mit deinem Nazi-Spruch bescheuert da, und sie sagen dir glatt: Kein Wunder, dass der Kirchen-Baldachin einstürzt.“ Hartkopf darauf: „Der ganze Quatsch kotzt mich an, ich verkaufe.“ Die Öffentlichkeit Oplyrs registrierte das stolze Bekenntnis Hartkopfs zur steinigen Silizium-Heimat mit Wohlwollen, und fortan wurde nach anderen Ursachen für die Katastrophe am Kirchenneubau gefahndet. Und erst als sich die Gerüchte von einem Gottesurteil häuften und der stellvertretende Stadtdirektor selbst die Möglichkeit eines warnenden Fingerzeigs Gottes nicht ausschließen mochte, da sagte Ellen Finke zu ihrer Mutter: „Sie haben den Schuldigen und müssen ihn decken“. Die halbherzige Rehabilitation Hartkopfs änderte nichts an dem Plan, das Kieswerk zu verkaufen. Es gab nämlich auch andere Gründe dafür.