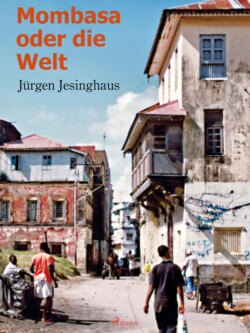Читать книгу Mombasa - Jürgen Jesinghaus - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.
Оглавление1923 zogen die Spielsteins nach Oplyr zur Miete in ein Fachwerkhaus. Der Hauskauf in Bonn war nicht zustande gekommen. Prosper hatte die Stelle in der Schuhfabrik aufgegeben, weil die Ärzte ihm geraten hatten, in seinem Zustand (mit dem Streifschuss am Kopf) ein „vegetatives Leben“ zu führen, ein Leben an der frischen Luft, mit einem Gärtchen, ein wenig Landwirtschaft, ohne Überanstrengung. Der Tränenwischer pachtete also ein Stück Land und unterhielt im Keller seines Hauses eine kleine Schusterwerkstatt. Er hatte gelernt, Schuhe in Handarbeit herzustellen, und bezog aus dieser Kunstfertigkeit, zusätzlich zu seiner Kriegerrente, einen Verdienst, der zum Lebensunterhalt seiner Familie ausreichte.
Für seinen Sohn Daniel waren die folgenden Jahre die glücklichsten des Lebens, trotz der politischen und wirtschaftlichen Krisen, deren Auswirkungen er als normal empfand und die der Entfaltung seines Geistes beiläufig als Hintergrund dienten. Er musste zwar nach dem Umzug die Realschule aufgeben, in die er gerade aufgenommen worden war, denn es gab damals in Oplyr keine vergleichbare Schule. Das war für ihn keine Katastrophe. In der Volksschule Oplyrs galt er zwar als der Jude, weil er nicht am katholischen Gottesdienst teilnahm, aber die Bezeichnung „dä Jud“ hatte nur die Bedeutung von: der Fremde, der Andersgläubige, der Abessinier, der Zugewanderte, der von jenseits des Gebirges. Sie sollte nicht verletzen. Dan erfreute sich einiger Beliebtheit, denn er wurde als „Städter“ und bereits „Einjähriger“ angesehen, nur weil er die gebohnerten Flure einer höheren Schule gerochen hatte und weil man bei ihm mehr verwertbares Wissen vermutete als bei den Dörflern. Und weil Daniel nicht dumm war.
Er machte den Zeitabschnitt des Glücks gegen Ende seiner Kindheit an nur einem Tage fest, einem Tag, den er nicht zu datieren wüsste, der ihm aber für immer vor Augen stand. An jenem Tag, eigentlich an jenem Abend, durfte er später ins Bett gehen als üblich, weil die Erwachsenen in seltener Eintracht einen Gang über das Land machten, denn es war nichts vorgefallen, worüber sich zu streiten gelohnt hätte. Eine Laune, ein kostbarer Zufall: Kein Husten musste kuriert, keine Blutvergiftung ausgebadet, keine Warze besprochen werden. Keine Heimsuchung durch Migräne, keine Sütterlin-Briefe an Ämter. Darum lag die Brille im Futteral, der Tintenstift im Nähkorb. Keine Vorbereitung eines Festes. Kein Auftrag zum Schuhebesohlen. Darum blieben Prospers Hammer und Ahle in den Lederschlaufen am leimverklebten Schustertisch. Die Pumpe am Brunnen hatte nicht versagt. Keiner brauchte Eisenreifen über Holzräder zu ziehen. Die Kartoffeln waren ausgegraben, die Forken gerade gebogen, die Fahrräder geflickt. Kein Tier (außer der Katze) trächtig, das Unkraut gejätet, der Feuerwehrlöschteich umzäunt und der Garten gegen den Wald durch Maschendraht gesichert. Laune und Zufall. Nichts blieb zu tun übrig – außer dem Stopfen und Nähen, dem Nähen und Stopfen. Die Einsicht hatte sich durchgesetzt, dass diese ewige Arbeit auch noch in einem Stündchen gemacht werden könne, denn Stopfen und Nähen haben kein Ende, ob sie schnell oder langsam verrichtet werden. So zogen sie los, um die Krume zu prüfen, die Saat zu besichtigen, das Wetter zu ergründen, denn nichts ist zwecklos und Müßiggang aller Laster Anfang. Der Junge musste, ja er durfte wie auch der Hund, die Erwachsenen begleiten.
Daniel erlebt die anbrechende Sommernacht als Verheißung ewiger Zukunft. Die unzähligen Morgen hinter diesem Abend, wie viele Felder und Hügel und Höfe und Landstraßen und Dörfer und Städte und Kühe und Flüsse hinter diesem schönen Wald mit seiner Kühle am Abend! Der Junge kann nicht denken, ein wie großer Bruchteil seines Lebens schon verbraucht ist. Der Gang durch die warmen Felder, über einen ungepflügten Grasstreifen. Die Schemen der Erwachsenen. Ihre Unterhaltung, obwohl mit gewohnter Kraft geführt, ist kaum vernehmbar, berührt kaum das stille Wasser der Welt. Die Umrisse vor sich und die dunkle Ruhe, um die Sterne sichtbar zu machen, versetzen das Kind in eine Stimmung der Geborgenheit und Weltoffenheit zugleich. Es träumt von einer Zukunft, in der es behangen mit Waffen und Werkzeugen seine Taten verrichtet. Das Motorrad auf der Landstraße reißt die Stille auf längs einer vorgezeichneten Naht. Man kann es lange hören. Das ersterbende Geräusch zwingt Daniel, ihm nachzuhorchen, bis der Ton zu einer Spitze wird und nur die Haut der Stille eindrückt. Noch schreitet der Junge hinter seinen Eltern und fühlt sich festlich geborgen. In Gedanken aber sieht es sich auf dem Motorrad voll Mut und voll Angst an dem schwarzen Wald vorbei brausen, durch den Duft des Asphalts, den berauschenden Duft der Ferne, durch die nachleuchtenden Felder, zu dem weitesten Punkt, den er je mit dem Fahrrad erreicht hat, vorbei an der Ziegelei, in der es spukt, in der ein Mörder haust, in rasender Fahrt vorüber am Schatten des Mörders, der gestikulierend über den Weg zur Landstraße läuft, dem Kind aber nichts anhaben kann, denn es ist schneller und schon längst auf dem Weg zu einem Meer, das nur in den Büchern steht und wo das Kind noch nichts von seiner Zukunft verbraucht haben wird. Erst wenn es selber schaut, wovon die Bücher berichten, fängt das Leben an zu zählen.
Im Nachhinein sah er es so. Die Welt erschien ihm friedlich, trotz der Not, über die seine Eltern jammerten, trotz der Invalidität seines Vaters. Die Nachbarn, die Leute in Oplyr, sind zwar Bauern und Dörfler, aber von einer nachsichtigen Freundlichkeit, als hätte der Strom, an dem sich bedeutende Städte aufreihen, die giftige Beschränktheit hinweggespült. Noch heute kann man erleben, dass Kinder guten Tag entbieten, zwar mit fragendem Gesicht, wie wohl die Erwiderung ausfallen würde, aber ohne Affigkeit. Nein, diese Leute waren damals keine Bedrohung gewesen. Noch nicht. Die Bedrohung kam nicht von außen, sondern von seinem Vater, dem Tränenwischer, der gegen Ende der 1920er immer eigenbrödlerischer wurde und den die politische und wirtschaftliche Entwicklung zunehmend beunruhigte.