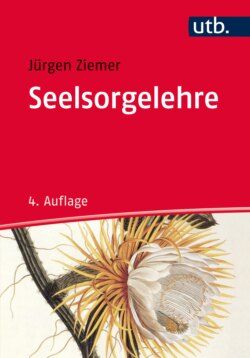Читать книгу Seelsorgelehre - Jürgen Ziemer - Страница 12
1.1Lebensbedrohlicher Sicherheitsverlust
ОглавлениеFragen wir nach einer Kernerfahrung, die das soziale und individuelle Leben in Deutschland (und darüber hinaus wohl auch in ganz Europa) zu charakterisieren vermag, ist wohl zuerst an den spürbaren Verlust an Sicherheit und Gewissheit zu denken. Der Begriff „Verlust“ legt dabei nahe, davon auszugehen, dass es vormals ein Mehr an Sicherheit und Orientierungsgewissheit gab. Ob das objektiv so war, können wir hier dahingestellt sein lassen. Nostalgische Verklärungseffekte sind nie auszuschließen. Subjektiv empfinden viele Menschen in unserer Gesellschaft jedenfalls einen Verlust. Und das ist mehr als nur ein verschwommenes Gefühl. Paradoxerweise muss diese Verlusterfahrung als die Kehrseite von gewachsenen Lebenschancen, neuen Daseinsmöglichkeiten und erhöhtem Freiheitsgewinn angesehen werden. Die „Risikogesellschaft“ (Ulrich Beck) schattet ihre Strukturen und Problemlagen auch in den familiären und privaten Beziehungen des Einzelnen ab. Davon wird noch en detail zu reden sein. Zunächst sei an die überindividuellen Erfahrungen eines Sicherheitsverlustes erinnert.
•Im Bereich der modernen Technologie und der industriellen Warenproduktion erleben wir seit Jahrzehnten einen phantastischen Zuwachs an Lebens- und Erlebensmöglichkeiten. Mit Hilfe der mehr und mehr automatisierten Großproduktion können in nahezu unbegrenzter Quantität Nahrungsmittel und andere Lebensgüter hergestellt werden; digitale Kommunikationsnetze weltumspannender Reichweite lassen räumliche Distanzen zwischen Menschen und Institutionen gegen Null zusammenschrumpfen; neue Forschungsmethoden und präzisere Untersuchungsinstrumentarien erschließen immer mehr die Geheimnisse der Mikro- und Makrowelt des Lebens. Aber zugleich geht diese „gesellschaftliche Produktion von Reichtum einher mit der Produktion von Risiken“. Wir bekommen es zunehmend zu tun mit ganz neuen „Problemen und Konflikten, die aus der Produktion, Definition und Verteilung wissenschaftlich-technisch produzierter Risiken entstehen.“1 Es sind vor allem die ökologischen Risiken, die uns unsicher werden lassen, ob die Luft, die wir atmen, nicht verpestet, ob der Boden, den wir bebauen, nicht verseucht, ob das Wasser, das wir trinken, nicht vergiftet ist. Aber es wächst darüber hinaus auch die Angst vor Katastrophen, die das Leben auf der Erde generell gefährden. Dabei sieht sich der Einzelne, der von den wissenschaftlich-technischen Entscheidungsprozessen viel zu weit entfernt ist, immer weniger imstande zu beurteilen, wie real die heraufbeschworenen Gefahren – etwa im Bereich der Genforschung und deren Anwendung – wirklich sind.
•Auf allen Ebenen der politischen Entscheidungsprozesse werden zunehmend neue Gefahren „produziert“. Paradoxerweise sind diese Gefahren nach der Überwindung des politischen, ideologischen und militärischen Ost-West-Gegensatzes eher gestiegen als gesunken. Die allgemeine politische Situation ist an den Rändern Europas, im Nahen Osten und in der islamischen Welt unberechenbarer geworden. Das Bewusstwerden historischer Ungerechtigkeiten, ethnischer Unterdrückung und die Erfahrungen offensichtlicher und schwerwiegender Chancenungleichheiten schaffen ein Konfliktpotenzial, das mit demokratischen Mitteln schwer unter Kontrolle zu halten ist. Es wäre ganz und gar falsch, den durch die „Wende“ von 1989 erkämpften Freiheitsgewinn auch nur für einen Augenblick zur Disposition zu stellen. Aber die Gefährdungen der Freiheit und des Lebens müssen gesehen und ernst genommen werden. Zygmunt Bauman spricht von neuen Erfahrungen einer „Weltunordnung“: „Seit das große Schisma aus dem Wege ist, sieht die Welt nicht mehr aus wie eine Totalität; sie sieht eher aus wie ein Feld zerstreuter und disparater Kräfte … Niemand scheint mehr die Totalität unter Kontrolle zu haben.2 Schon stellen sich Situationen ein, die höchst gefährliche nationalistische und totalitäre Formen einer „Gegenmodernisierung“3 auf den Plan rufen.
•Ein hohes Maß an Sicherheitsverlust ist mit der gegenwärtigen Arbeitsmarktsituation eng verknüpft. Unabhängig von den Zyklen wirtschaftlicher Progression und Rezession müssen wir heute angesichts der immer geringer werdenden Bedeutung der menschlichen Arbeitskraft in den industriellen Produktionsprozessen davon ausgehen, dass in Zukunft keineswegs mehr für jeden Arbeitswilligen auch ein Arbeitsplatz im Sinne einer Vollbeschäftigung zur Verfügung stehen wird.4 Für einen großen Teil der Bevölkerung stellt dies einen dauerhaften Destabilisierungsfaktor dar – auch wenn man in Rechnung stellt, dass neue Verteilungsmuster einen gewissen Ausgleich schaffen können. Der Einzelne gerät auf dem Arbeitsmarkt ziemlich schnell in eine Konkurrenzsituation, die ihn existenziell und psychisch überfordern kann. In einer solchen Konkurrenzsituation wächst für alle diejenigen die Unsicherheit, die mehr oder weniger aus der Leistungsnorm fallen: die schlecht Ausgebildeten, die Älteren, vielfach auch die Frauen, die Behinderten, die Ausländer und so weiter. Diese Konkurrenzsituation auf dem Arbeitsmarkt könnte von einem Entsolidarisierungseffekt begleitet sein, der die Gefahr verstärkt, dass ganze Bevölkerungsgruppen zu „Verlierern“ werden.
•Zunehmend geraten die Sicherheitsrisiken für unsere persönlichsten Angelegenheiten an einer noch an einer ganz anderen Stelle ins Blickfeld: in der digitalen Welt, in die wir durch das Internet täglichen Zugang haben. Datensicherheit ist im privaten wie auch im öffentlichen Bereich ein unausweichliches Problem geworden. Täglich senden wir eine Fülle von Daten in das elektronische Medium. Wir verschicken persönliche Botschaften, beteiligen uns an Internetforen wie Facebook, nehmen Internetdienste unterschiedlichster Art in Anspruch. Alle diese Daten, so viel Vertraulichkeit auch zugesichert sein mag, sind unserer Verfügbarkeit entzogen. Es werden „Profile“ erstellt, die uns ungebeten maßgeschneiderte Werbung zutreibt. Eine verunglückte Mail, ein peinliches Foto – es entstehen unverwischbare Spuren. Viele haben es noch gar nicht begriffen, aber es entsteht in unserer Welt „eine neue Transparenz, durch die… jeder Mensch in allen Bereichen des Alltagslebens pausenlos überprüft, beobachtet, getestet, bewertet, beurteilt und in Kategorien eingeordnet werden kann.“5 Dabei ist vielfach eine Ambivalenz zu spüren: es gibt einerseits ein schier unbegrenztes Bedürfnis sich virtuellen Adressaten in einen anonymen Raum hinein mitzuteilen, andererseits die Verunsicherung und Beunruhigung darüber, was damit geschehen könnte. Es sind viele Vorkehrungen nötig, um wenigstens ein Mindestmaß man Sicherheit herzustellen. Das betrifft auch solche Dienste wie die Internetseelsorge. Sie sind absolut sinnvoll, aber nicht möglich ohne ein ganzes Arsenal an Regulierungen und Sicherungsmaßnahmen.6
Die auf den vier Ebenen – technologischer Fortschritt, Politik, Arbeitsmarkt, virtuelle Kommunikation – angedeuteten Verunsicherungsprozesse haben in gewisser Weise ihr Pendant in alltäglichen Bedrohungserfahrungen der Einzelnen. Viele Menschen haben Angst, vor allem Angst vor Gewalt. Sie fühlen sich, ihre Würde und Integrität, ihr Eigentum, ihre Gesundheit, ihre Ruhe, ihre Ordnung permanent und massiv gefährdet. Ausdruck dieser Angst ist die in unserer Gesellschaft herrschende und stetig zunehmende Kriminalitätsfurcht und Terrorismusangst. Durch ständige Gewaltinszenierungen im Fernsehen und in der Boulevardpresse wird sie noch gesteigert und gesteuert. Ganze Industrie- und Logistikunternehmen sind im Gegenzug damit beschäftigt, immer neue Schlösser, Verriegelungen und Alarmanlagen zu erfinden und zu produzieren. Ausbildungsinstitutionen bieten Selbstschutztrainings an. Die Sorge um die persönliche Sicherheit erhält einen Eigenwert. Für viele Menschen bedeuten die Verunsicherungen im täglichen Leben eine deutliche Mobilitätseinschränkung und Interaktionsbegrenzung. Aus Angst bleibt man lieber zu Hause. Dabei muss man beachten, dass den Ängsten und Bedrohungen besonders diejenigen ausgesetzt sind, die sich nicht so gut zu wehren vermögen, die in ihre Sicherheit nicht so reichlich investieren können: die sozial Schwachen, die Arbeitslosen, die Ausländer und unter ihnen nicht zuletzt ein großer Teil der Frauen. Für den weiteren Zusammenhang ist darauf aufmerksam zu machen, dass die „tägliche Verunsicherung vielleicht auch vor dem Hintergrund verlorener traditioneller Gewissheiten“7 verstanden werden muss. Mögen die Gefährdungen für die Individuen „objektiv“ nicht größer sein als zu früheren Zeiten, so sind die Menschen, die heute nur noch selten ihren Tag „mit Gott“ beginnen, ihnen doch in gewisser Weise schutzloser ausgeliefert. Insofern hat die Kriminalitätsfurcht etwas Symptomatisches. Es ist die Furcht des seines Lebens nicht mehr sicheren und des durch religiösen oder anderen Zuspruch auch nicht mehr ohne weiteres versicherbaren Menschen. Die besondere Folgegefahr angesichts der alltäglichen Verunsicherungen liegt in der deutlichen Zunahme der Aggressionsbereitschaft und in fragwürdigen, scheinbar komplexitätsreduzierenden Optionen (Fundamentalismus verschiedener Prägungen, Nationalismus, Rechtradikalismus usw.). Die Situation begünstigt die populistischen Vereinfacher jedweden Coleurs.