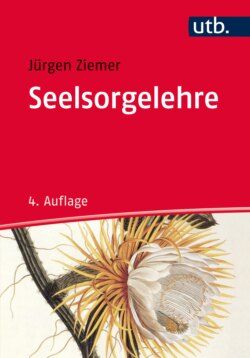Читать книгу Seelsorgelehre - Jürgen Ziemer - Страница 18
2. Seelsorge in der Geschichte 2.1Die Gegenwart der Ursprünge 2.1.1Die Seele und die Geschichtlichkeit der Seelsorge
Оглавление„Die“ Seelsorge gibt es nicht. Wenn wir so sprechen – was ja in manchen Zusammenhängen sinnvoll sein kann – abstrahieren wir von den konkreten Ausprägungen der Seelsorge in den jeweiligen historischen Epochen. Die Geschichte der Seelsorge beginnt nicht erst mit dem Christentum1 und sie endet nicht an den Grenzen christlicher Konfessionen und Denominationen. Seelsorge ist ein Phänomen menschlicher Kommunikation und wie diese zeit- und situationsabhängig. Wo Menschen bewusst miteinander leben, wird sich auch mehr oder weniger wahrnehmbar so etwas wie „Seelsorge“ ereignen. Menschen sind ja in ihrer inneren und äußeren Lebensgestaltung nie völlig festgelegt, sie sind weder völlig determiniert noch primär hormon- oder instinktgesteuert. Sie aber sind steuerbar, von außen durch Erziehung und Bildung, durch konkrete Lebensumstände, von innen her: durch Überzeugungen und Einstellungen und darin nicht zuletzt durch die Regungen ihrer Seele.
Die Seele ihrerseits ist keine von den geschichtlichen Veränderungsprozessen unabhängige Instanz des menschlichen Daseins.2 Zwei Merkmale ihres Wesens sind im jetzigen Zusammenhang von Bedeutung:
•Einmal: „Seele“ eine anthropologische Konstante. Es gehört zur menschlichen Person, eine Seele zu „haben“. Aber man darf sich dessen nicht zu sicher sein. Wer seine Seele „verloren“ hat, ist bodenlos unglücklich, weil etwas Wesenhaften beraubt. Wer seelen-los handelt, wirkt unmenschlich und ist es wohl auch. Die „Seele“ hat etwas zu tun mit Offenheit und Empfänglichkeit, mit Sensibilität und Gewissen, mit Gottesgegenwart und Liebe. Die Seele kann nicht wirklich verloren gehen, aber sie kann „zugeschüttet“ werden. Die Seele ist gefährdet, man muss auf sie achten.
•Zum Andern: Die Seele ist beeinflussbar und bildbar. Sie kann gestärkt und sie kann gebeugt werden. Ihr kann Leid zugefügt werden. Man kann auf fremden Seelen „herumtrampeln“ und man kann schließlich die eigene Seele „verkaufen“, in der Regel eher erzwungenermaßen als freiwillig. Das bedeutet auch, dass die Seele geschichtlichen Einflüssen ausgesetzt und manchmal auch ausgeliefert ist.
Mit diesen Beobachtungen soll nur angedeutet werden, dass die „Seele“ selbst geschichtlich in dem Sinne ist, dass die Signaturen der Zeit in ihr Spuren hinterlassen. Die Seele eines mittelalterlichen Gläubigen regte sich anders als die eines modernen Christen. So liegt es im „Gegenstand“ der Seelsorge selbst begründet, dass sie als „Arbeit“ an und mit der „Seele“ geschichtlich ist. Konkret haben darunter verschiedene Generationen durchaus Verschiedenes verstanden. Dabei beziehen sich die Unterschiede sowohl auf das Verständnis dessen, was für die Seele eines Individuums gut sei und was nicht, wie auch auf die Wege, die zum Menschen und zum Heil und Wohl seiner Seele einzuschlagen wären.
Die Einsicht in die Geschichtlichkeit von Seelsorge ist eine Voraussetzung für das Verstehen der variierenden Gestaltungen seelsorglichen Handelns in den verschiedenen Epochen der Kirchengeschichte.3 Und sie ist wichtig im Blick auf die eigene Seelsorgepraxis und Seelsorgelehre in der Gegenwart.4 Die Wahrnehmung der Geschichtlichkeit von Seelsorge erschließt eine Fülle von Reichtümern, Anreizen und vielleicht auch Provokationen. Sie führt ins Nachdenken, aber sie gebietet auch Zurückhaltung gegenüber einem normativen Seelsorgebegriff. Kein Handlungsfeld der Praktischen Theologie verfügt über einen so offenen Horizont wie die Seelsorge – zwischen Kirchenzucht und Therapie, Freundesgespräch und Beichte, Glaubenshilfe und Lebensberatung. Das ist die Stärke der christlichen Seelsorge und manchmal auch ihr Problem.