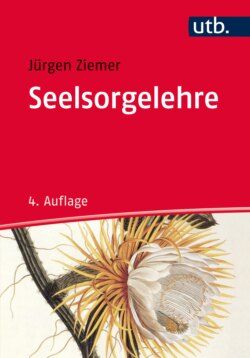Читать книгу Seelsorgelehre - Jürgen Ziemer - Страница 9
Einleitung: Seelsorge – erste Verständigungen
Оглавление1. Seelsorge ist vielen heute ein fremdes Wort geworden
Natürlich hat man von Seelsorge schon einmal gehört. Und es gibt eine ungefähre Vorstellung davon. Seelsorge ist nicht unbekannt, aber doch fremd. Vielen Zeitgenossen klingt das Wort etwas altertümlich und vielleicht auch exklusiv. Es gehört für sie zur Sprache einer Sonderwelt.
Obwohl nur bedingt ein religiöses Wort2, wird es doch schnell dieser Sphäre zugeordnet. Vermutlich würde man es von sich aus auch gar nicht in den Mund nehmen; denn wer es aktiv gebraucht, gibt sich zu erkennen. Auch Gemeindeglieder verwenden das Wort Seelsorge eher selten. Andere Begriffe wie „Gespräch“, „Beratung“ oder „Aussprache“ – im Grunde fast Synonyme für „Seelsorge“ – erscheinen unverfänglicher. Die Verknüpfung mit dem religiös-kirchlichen Kontext scheint dabei nicht so unausweichlich gegeben. Das Wort „Seelsorge“ hat Anteil an der Fremdheit von Glauben und Kirche in unserer Welt?3
2. Das Wort Seelsorge löst oft ambivalente Empfindungen aus
Auch unter Christen hat „Seelsorge“ einen unterschiedlichen Klang. Sie wird einerseits hoch geschätzt und auf der anderen Seite zugleich skeptisch beurteilt. In Auseinandersetzungen über das zukünftige Profil von Kirche und Gemeinden hat die Seelsorge meist einen hervorgehobenen Stellenwert. Viele Kirchenvorstände wünschen sich mehr seelsorgliche Aktivitäten in der Gemeinde, und bei Pfarrwahlen hat die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber für die Seelsorge einen bedeutsamen Auswahlwert.4 In vielen Fällen wird aber gar nicht klar, inwieweit Menschen auch für sich selber ein seelsorgliches Angebot in Anspruch nehmen würden. Zuweilen findet sich die (unbewusste) Einstellung: Seelsorge ist sehr wichtig, aber ich hoffe, dass ich selbst sie nicht brauche. Was Seelsorge wirklich ist, liegt ja nicht so deutlich zu Tage, wie wenn es um Predigt oder Konfirmandenunterricht geht. Seelischer Hilfe zu bedürfen, erscheint zudem eher peinlich, ein Zeichen von Schwäche – sei es psychischer, sei es geistiger, sei es lebenspraktischer Art. Bei Seelsorge gehen die Gedanken zuerst an andere, die Beistand brauchen: Kranke, Zweifelnde, Sterbende, in Not Geratene. Manchmal haftet dem seelsorglichen Handeln gar ein Geruch des Weichen, Fürsorglichen, des Freundlich-Betulichen oder auch des Frömmlerischen an. Konkrete Erfahrungen müssen nicht unbedingt dahinterstehen. Das gilt auch angesichts der häufig zu beobachtenden Furcht vor einem moralisierenden Ermahnungston in der Seelsorge. Dem muss nicht widersprechen, dass mitunter gerade ein solches Verhalten einem Seelsorger nahe gelegt wird: „Herr Pfarrer, mit unserem Sohn sollten Sie mal ein seelsorgliches Wort reden!“
Die Ambivalenz gilt im Blick auf die Seelsorge auch für Pfarrerinnen und Pfarrer selbst. Der große Reiz dieser Arbeit und die Hoffnung, hier wirklich für die Menschen erreichbar und alltagsrelevant tätig zu werden, wird konterkariert von Zweifeln: Worauf lasse ich mich da eigentlich ein? Wie ernst muss diese Aufgabe wirklich genommen werden? Begebe ich mich da nicht auf ein viel zu offenes Feld? Kommen hier auf mich Erwartungen zu, die ich gar nicht erfüllen kann?
3. Seelsorge ist etwas zutiefst Menschliches
Gegenüber allen Voreinstellungen und Vorurteilen, so verständlich sie sein mögen, ist zunächst festzuhalten: Seelsorge ist eine unverzichtbare und grundlegende Weise menschlichen Miteinanderseins. Ob sie professionell im Rahmen einer kirchlichen Berufstätigkeit oder spontan als Reaktion unmittelbaren Betroffenseins ausgeübt wird, ist hier erst einmal von untergeordneter Bedeutung. Es ist einfach menschlich, sich gegenseitig zu raten und Rat zu holen. Und es ist menschlich, jemanden zu haben, dem man zu vertrauen vermag, dem man sein Herz ausschütten kann, dem man sich zumuten darf. Seelsorge hängt mit der menschlichen Fundamentalerfahrung zusammen, dass wir Angewiesene sind, dass wir nicht immer allein zu Rande kommen – weder seelisch, noch emotional, noch glaubensmäßig, noch lebenspraktisch. Wir brauchen Menschen, denen wir uns anvertrauen können; manchmal ist es gut, wenn sie nicht aus dem eigenen Umfeld kommen.
Seelsorge ist etwas zutiefst Menschliches, aber sie ist deswegen nichts weniger als selbstverständlich. Selbstverständlich ist viel eher, sich aus dem Wege zu gehen, sich fremd zu bleiben, andere sich selbst und ihren eigenen Problemen zu überlassen oder an die für Gesundheit und Wohlfahrt zuständigen Institutionen zu verweisen. Rolf Zerfaß hat als ein Modell für den menschlichen Aspekt von Seelsorge die Erfahrung von „Gastfreundschaft“ empfohlen. Gastfreundliche Seelsorge gibt dem anderen Raum, sie nimmt seine Bedürfnisse wahr, ohne ihn damit gleich zu vereinnahmen. Sie gibt und empfängt zugleich. Gastfreundliche und darin eben „menschliche“ Seelsorge „wagt es, sich fremden Menschen anzuvertrauen, weil sie die überraschende Erfahrung macht, dass uns bis heute im Fremden Gott begegnet.5
4. Seelsorge ist „Sorge um die Seele“
Dass Seelsorge etwas zutiefst Menschliches ist, erfüllt sich schon in dem, was der Begriff selber sagt: sie ist „Sorge um die Seele“. So banal diese Auskunft erscheinen mag, so ist sie doch gleichwohl auslegungsbedürftig. Denn: was ist eigentlich „die Seele“? Wer von ihr spricht, hat eine ungefähre Ahnung, aber im Zusammenhang einer Seelsorgelehre muss man doch etwas genauer werden.
„Seele“ erscheint uns zunächst als etwas Gegensätzliches zum „Leib“. Über Jahrhunderte haben sich gläubige Menschen an der von der griechischen Philosophie begründeten Vorstellung getröstet, dass es außer dem sterblichen Leib noch etwas Anderes gibt, das bleibt und um das zu sorgen sich lohnt. Bei näherem Zusehen freilich zeigt sich, dass in der Bibel von der Seele keineswegs in Abgrenzung zum Leib gesprochen wird, sondern im Zusammenhang mit ihm. Das hebräische Wort für „Seele“ heißt nefäs und hat eine leibnahe Bedeutung: Atem, Schlund, Leben; es steht für ganz vitale Lebensregungen: Hunger, Durst, Begehren, Liebe, Dankbarkeit, auch Klage, Zorn und intensives Sehnen. Oft sind es die tiefer gehenden Gefühle, die uns den Weg zur Seele weisen. Das Wort „Seele“ kann auch für das stehen, was wir in psychologischer Terminologie heute das „Ich“ oder das „Selbst“ nennen6, etwa wenn der 103. Psalm mit der Selbstaufforderung beginnt. „Lobe den Herrn, meine Seele“! Im Neuen Testament steht das griechische Pendant für die Seele „psyche“ an vielen Stellen faktisch für „Leben“, für das Leben des „ganzen“ Menschen (z.B. Mk 8, 35, Mt 6, 25). In biblischer Sicht gehören also Leib und Seele zusammen. Der Leib ist nicht „ganz“ ohne Seele, die Seele nicht ohne Leib.7
Aber noch einmal: Was ist dann die Seele? Eine Funktion unseres Körpers? Ein Produkt des Gehirns, wie es uns manche Neurowissenschaftler nahe legen?
Die Seele ist keine materielle „Substanz“, losgelöst von unserer körperlichen Existenz. Sie bezeichnet vielmehr eine grundlegende Beziehung der Person und des Leibes.8 Sie ist der „Ort“, wo Gottes Zuwendung zu uns und unsere Hinwendung zu ihm Ereignis werden: „Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.“ (Ps 43, 3). Seele ist Beziehung auf etwas, das uns leibhaft nahe ist und das zugleich über uns hinaus weist. Hier wird deutlich, wer von der „Seele“ spricht, berührt die religiöse Dimension. Das darf natürlich nicht so verstanden werden, dass nur im konfessionellen Sinn gläubige Menschen auf ihre Seele und auf Seelsorge hin ansprechbar wären. Die Seele dürstet, sie „hat“ nicht, sie ist Sehnsucht und Suchen. Und da sind gläubige von weniger gläubigen Menschen oft nicht weit entfernt. Die Seele ist, was Menschen als „Tiefe“ ihres Seins spüren, wohin ihr Herz neigt. Seelsorge, die für die Seele sorgt, fragt nach dem, was für die je eigene Seele wesentlich ist und so spricht sie den Menschen, schlicht gesagt, „persönlich“ an. Darüber freut sich die Seele, wie Augustin sagt, und: „Sie nährt sich von dem, woran sie sich freut.“9. Es ist die Freude darüber, als ungeteilt sein zu dürfen, was ich bin: leiblich, geistig, religiös. Die Seele als „Ort der Freude“ ist so auch der „Ort des Gewissens“10, an dem das Ich sich seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen bewusst wird.
5. Seelsorge ist unverzichtbares kirchliches Handeln
Gerade wenn wir mit Zerfaß Seelsorge unter anderem als Erfahrung von „Gastfreundschaft“ beschreiben wollen, wird deutlich, dass sie auch als eine Weise verstanden werden kann, in welcher Menschen das Evangelium begegnet. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass Luther im dritten seiner „Schmalkaldischen Artikel“ zum Ausdruck gebracht hatte, dass das Evangelium neben Wort und Sakrament auch „per mutuum colloquium et consolationem fratrum“11, also durch wechselseitiges Gespräch und geschwisterliche Tröstung erfahren werde. Indem Menschen miteinander sprechen und füreinander aufmerksam werden – helfend, stärkend, herausfordernd, ratend, ermutigend – erfahren sie auch etwas von der Menschenfreundlichkeit Gottes in Christus, die in einer Gemeinde Gestalt gewinnt.
„Seelsorge findet sich in der Kirche vor…“, heißt es in diesem Sinne am Beginn einer der einflussreichsten Seelsorgelehren des 20. Jahrhunderts12 Dieser Satzanfang muss sowohl deskriptiv wie normativ verstanden werden. Kirche ist nicht Kirche ohne Seelsorge und sie kann es nicht sein. Wir haben als diese nicht zu überlegen, ob wir Seelsorge wollen oder nicht. Seelsorge als die Realisierung einer helfenden Beziehung zwischen Menschen, die sich im Horizont des Glaubens geschwisterlich verbunden wissen, gehört zur Auftragsgestalt der Kirche – nicht mehr und nicht weniger als der Gottesdienst, die Verkündigung oder der Unterricht. Damit sollten freilich Menschen außerhalb der Kirche von Erfahrungen seelsorglichen Handelns bewusst nicht ausgeschlossen werden. In der Seelsorge und durch sie könnte kirchliches Handeln gerade als grenzüberschreitend in Erscheinung treten.
6. Seelsorge ist eine Brücke zur entkirchlichten Welt
Längst ist die Welt, die uns täglich umgibt, weithin säkular geworden, und viele Menschen sind den Kirchen entfremdet. Was in ihnen gesprochen wird, ist vielen religionslos gewordenen Zeitgenossen nicht mehr ohne weiteres verständlich. Und auch von denen, die zur Kirche gehören, gibt es viele, die mit den überlieferten Worten des Glaubens für sich nicht mehr viel verbinden können.13 Und doch ist ein Interesse da, das was die „Seele“, das was „unbedingt“ angeht, zu kommunizieren. Der Seelsorge könnte in dieser Situation eine echte Brückenfunktion zur Welt zukommen. Sie ist eine Möglichkeit, Menschen ganz unmittelbar anzusprechen, ohne Vermittlung durch Formen oder Formeln des kirchlichen Lebens. Seelsorge ist Kommunikation über seelische Fragen, ohne besondere religiöse Voraussetzungen dafür zu fordern. In Robert Musils „Mann ohne Eigenschaften“, einem unverkennbar nachchristlichen Roman, gibt es den Vorschlag für die Einrichtung eines „Weltsekretariats der Genauigkeit und Seele“ – von Ulrich, dem „Romanhelden“ zunächst „aus Spaß“, später immer ernsthafter erwogen. Dahinter steht das noch ganz unsichere Gefühl, es sei etwas nötig, „damit die Leute, die nicht in die Kirche gehen, wissen, was sie zu tun haben.“14 Es geht bei „Genauigkeit und Seele“ keineswegs nur um Moral, sondern um die den Menschen zuwachsenden Fragen, die durch Wissenschaft allein nicht zu beantworten sind. Seelsorge als „Dialog um Seele“ kann Menschen in ihrem Bemühen um Selbstreflexivität und Tiefe begleiten. Sie ist ein echter Dienst an den Menschen. Und wenn Seelsorge diesen an den verschiedenen Orten, wo sich das nahe legt, ausübt, dann nimmt sie eine Brückenfunktion wahr. Sie sollte es tun ohne aufdringlich-missionarische Absichten. Vielleicht jedoch eröffnet sie so dann auch wieder ein Zurückfragen nach dem, was sie zu ihrem Tun autorisiert.15
7. Seelsorge geschieht auf vielfältige Weise
Von anderen Formen einer helfenden Beziehung – etwa in der Sozialarbeit, bei unterschiedlichen Beratungsdiensten, in der Therapie – unterscheidet sich Seelsorge durch eine Vielfalt der Vollzugsformen Immer wieder wird es in der pastoralen Praxis Situationen geben, bei denen gar nicht klar ist, ob sie als „Seelsorge“ bezeichnet werden können. Die Grenzen zwischen einer informellen Begegnung und einem seelsorglichen Gespräch sind oft fließend. Zu denken ist hier an Gelegenheiten, bei denen sich ein Kontakt eher zufällig ergibt: das Gespräch am Schluss eines Gottesdienstes oder einer Gemeindeveranstaltung, die ungeplante Begegnung auf der Straße oder beim Spaziergang. Ähnliches gilt für manche kasuellen Anlässe – bei den vorbereitenden Gesprächen für Taufe, Trauung, Beerdigung, bei einem routinemäßig durchgeführten Geburtstagsbesuch, bei einem Begrüßungskontakt usw. Hilfreich kann hier die Unterscheidung von funktionaler und intentionaler Seelsorge sein, also einer Seelsorge, die sich „bei Gelegenheit“ ergibt, und einer Seelsorge, die bewusst als seelsorgliche Begegnung geplant und vereinbart wird. Wichtig ist es, alle diese Begegnungsformen als mögliche Gelegenheiten zur Seelsorge wahrzunehmen und für die Chancen der jeweiligen Situation offen zu sein. Seelsorge ist nicht festgelegt auf ein bestimmtes „setting“ – etwa den Besuch am Krankenbett oder das ausdrücklich vereinbarte Gespräch im Pfarrhaus. Für eine Seelsorgelehre haben diese Formen intentionaler Seelsorge freilich eine herausragende Bedeutung, denn an ihnen kann man in der begleitenden kritischen Reflexion erkennbar machen, was tendenziell auch für die weniger eindeutig strukturierten Prozesse einer funktionalen Seelsorge zutrifft.
8. Seelsorgelehre ist kritisch-konstruktiv auf Seelsorgepraxis bezogen
Seelsorgelehre – in der Wissenschaftssprache des 19. Jahrhunderts: Poimenik16 – ist auf Praxis angewiesen und auf sie bezogen. Sie lehrt nicht eigentlich Seelsorge, aber sie lehrt Seelsorge besser zu verstehen und sie in den Zusammenhang pastoralen Handelns und kirchlicher Lehre einzuordnen. In der Seelsorgelehre werden Kriterien entwickelt für die theologische und humanwissenschaftliche Beurteilung geschehener und geschehender Seelsorge. Darüber hinaus richtet sie ihr Augenmerk auf den Zusammenhang des seelsorglichen Handelns mit anderen Weisen zwischenmenschlicher Hilfebemühungen und deren wissenschaftlicher Reflexion in unserer Gesellschaft.
Der Ansatz unserer Seelsorgelehre ist ein pastoralpsychologischer. Die pastoralpsychologische Herangehensweise bedeutet dabei methodisch, dass die Konfliktlagen des Einzelnen und der zwischenmenschliche Kommunikationsvorgang in der Seelsorge auch unter humanwissenschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet werden. Zugleich ist damit eine prinzipielle Offenheit für Handlungsansätze und Handlungsmodelle intendiert, die durch die pastoralpsychologische Bewegung für die Seelsorgepraxis erschlossen wurden.
Stärker als in dieser poimenischen Tradition bisher üblich geht es in der vorliegenden Einführung in die Seelsorgelehre darum, auch die kontextuellen Faktoren, die für Selbsterfahrungen des Einzelnen relevant sein könnten, in die Darstellung einzubeziehen. Individuelle Probleme haben oft soziale Ursachen. Seelsorgliches Handeln geschieht immer in einer konkreten gesellschaftlichen und kulturellen Situation. Sie genau wahrzunehmen heißt auch, die Bedingungen zu erkennen suchen, die für die spezifischen Lebens- und Leidenserfahrungen des Einzelnen verantwortlich sind.
Fazit: Und was ist nun eigentlich Seelsorge?
Der Wunsch nach einer schlüssigen Definition ist gut verständlich, aber kaum erfüllbar, und das nicht nur mangels Sprachkraft, sondern letztlich wegen der Eigenart der „Seele“, deren Wesen jeder Art von Definition entgegensteht. Von ihr sagt Heraklit (5. Jh. v.Chr.): „Der Seele Grenzen kannst du nicht ausfindig machen, wenn du auch alle Wege absuchtest, so tiefgründig ist ihr Wesen.“17
Versuchen wir dennoch eine Definition, müssen wir zunächst ziemlich allgemein bleiben. Etwa so:
Seelsorge ist zwischenmenschliche Hilfe durch personale Kommunikation in religiösen Kontexten.
Dies ist eine sehr allgemeine Umschreibung. Sie versucht der Tatsache Rechnung zu tragen, dass es nicht nur christliche Seelsorge gibt, sondern auch beispielsweise jüdische und muslimische. Vielleicht empfindet aber mancher schon die Bestimmung „in religiösen Kontexten“ als einengend. Es gibt auch „weltliche“ oder neuerdings auch „philosophische“ Seelsorge. In der Tat ist Religionszugehörigkeit im persönlichen oder im rechtlichen Sinne keine Voraussetzung für Seelsorge, wohl aber ist eine Offenheit für das notwendig, was „menschlich und wesentlich“ ist. Denn darum geht es, wenn wir uns um die „Seele“ sorgen. Der Seele aber eignet, wie Heraklit sagt, eine „Tiefe“, und das bedeutet, dass sie in Bereiche führt, die wir dem Religiösen zurechnen.
Wenn wir nun die zunächst sehr allgemeine Definition mit der für christliche Seelsorge verbinden, könnte man auch so formulieren:
Seelsorge als „Sorge um die Seele“ kann umfassend als Sorge um das Menschsein des Menschen verstanden werden. Sie vollzieht sich in der vertrauensvollen Kommunikation existentieller Fragen im Horizont des christlichen Glaubens.
Wenn wir die Definition von Seelsorge nun in verschiedenen Fragehinsichten spezifizieren wollen, kommen wir zu folgenden Bestimmungen:
–Theologisch: „Seelsorge ist Zuwendung zum einzelnen Menschen als ‚Kommunikation des Evangeliums’“.18 Man könnte im gleichen Sinne von Seelsorge auch als „Vollzug christlicher Anthropologie“19 sprechen. (s. Kap. 4)
–Psychologisch kann Seelsorge verstanden werden als Beratung bei existentiellen und spirituellen Problemen im Rahmen eines relativ offenen Settings. (s. Kap.5)
–Soziologisch ließe sich Seelsorge beschreiben als intendierte Praxis solidarischer Gemeinschaft im kirchlichen Kontext. (s. Kap.1)
–Ekklesiologisch betrachtet ist Seelsorge Wesensmerkmal der christlichen Kirche als Gemeinschaft des Glaubens, konkret erlebbar durch die Gemeinde und in ihr. (s. Kap.4,4);
–Pastoraltheologisch gesehen ist Seelsorge geistlicher Auftrag und berufliche Aufgabe kirchlicher Mitarbeiter in den „Verkündigungsdiensten“, besonders im Pfarrberuf, aber auch ein wichtiges Engagement von Ehrenamtlichen in spezifischen Arbeitsfeldern. (s. Kap.7).
Alles dies sind Bestimmungen von Seelsorge, wie sie sich von unterschiedlichen Standorten her ergeben. Sie sind zutreffend und erweitern unser Bild von Seelsorge. Sie sollten aber andere Sichtweisen nicht ausschließen – die der Leiblichkeit etwa oder die einer ethischen Orientierung (s. Kap.4.3 und 4.5). Es ist wichtig, die Dynamik seelsorglichen Engagements in unserer Welt und Kirche nicht unnötig einzugrenzen. In unterschiedlichen Kontexten und unter unterschiedlichen Bedingungen hat Seelsorge jeweils eine andere Ausdrucksgestalt. Das gehört zu ihrem Wesen.20
Ist Seelsorge auch „missionarisch“? So wird gelegentlich gefragt. Seelsorge ist keine Missionsmethode, und sie will nicht Mitglieder werben. Aber wenn Seelsorge ist, was sie ist und soll, dann wirkt sie „missionarisch“21, weil sie Menschen an der Kraft des Evangeliums Anteil gibt, ohne dieses kirchlich zu etikettieren und ohne Gegenleistung zu erwarten.
In diesem Zusammenhang ist noch ein Wort notwendig zum unterschiedlichen Sprachgebrauch in der katholischen und in der evangelischen Kirche, Katholischerseits hat man bei „Seelsorge“ meist das mit im Blick, was traditionell die cura animarum generalis genannt wird, also den gesamten Bereich der Zuwendung zu den Menschen in der Gemeindearbeit (der Pastoral).22 Evangelischerweise ist dabei immer die cura animarum specialis gemeint, also ein besonderer Sektor der Gemeindearbeit, konkret die persönliche Begegnung mit dem Einzelnen, in der Regel das seelsorgliche Gespräch. So auch in diesem Buch. Wenn man den Unterschied beachtet, lässt sich über Seelsorge in Praxis und Theorie problemlos ökumenisch kommunizieren.