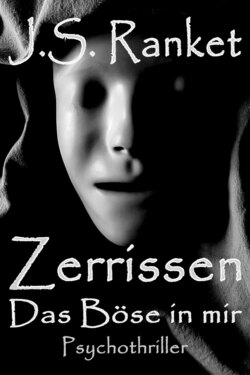Читать книгу Zerrissen - Das Böse in mir - J.S. Ranket - Страница 4
-1-
ОглавлениеWährend des Trainings bevorzuge ich immer den Dreierzug. Das hat den Vorteil, dass man dabei ruhiger im Wasser liegt und – so seltsam das auch klingen mag – ein bisschen länger die vorbeiziehenden Fliesen beobachten kann. Erst beim Wettkampf, wenn mein Körper Unmengen an Sauerstoff benötigt, um seinen Energiestoffwechsel sicherzustellen, schalte ich auf den Zweierzug um. Doch jetzt genoss ich erst einmal die monotone Eintönigkeit, die mir mit jedem Kraulschlag meine innere Ruhe zurückgab und mich über den unglaublichen Zufall nur verwundert den Kopf schütteln ließ. Den Zufall, der mich schließlich hierher geführt hatte. In das Schwimmbecken einer der angesehensten Universitäten der Welt.
Bereits bevor ich meinem Vater irgendwie begreiflich machen konnte, dass ich meine Zukunft nicht in dem familieneignen Delikatessengeschäft in Wilmersdorf sah, wurde mir die Entscheidung förmlich aus den Händen gerissen. Als Marlene, meine ältere Schwester, nach ihrem Studium plötzlich die Mutter Teresa in sich entdeckte hatte und auszog, um die Welt zu retten, lagen sämtliche Hoffnungen meines alten Herren auf die Fortführung der Tradition bei mir, dem Nachzügler.
Zwar eignete sich die Arbeit in einem kleinen Laden ganz hervorragend zur Aufbesserung des Taschengeldes, für mehr aber auch nicht. Nicht nur, weil immer mehr Supermärkte das gehobene Feinkostgeschäft für sich entdeckten, sondern auch, weil eine unheimliche Dunkelheit nach meinem Vater griff.
Am Anfang fiel es auch nicht weiter auf, dass er die eine oder andere Bestellung vergaß. Aber als sich diese Vergesslichkeitsattacken häuften, musste selbst einem medizinischen Laie klar geworden sein, dass mein Vater professionelle Hilfe benötigte. Und zwar bevor ein Unglück geschah und er das ganze Haus abfackelte.
Zum Glück hatte Marlene zu diesem Zeitpunkt gerade halb Zentralafrika das Lesen beigebracht und kam für einige Wochen zurück nach Berlin, um sich um meinen Vater zu kümmern. Ich hatte schon befürchtet, dass ich mein Freiwilliges Soziales Jahr in den Askania-Kliniken, das ich in Vorbereitung auf mein Medizinstudium in Angriff genommen hatte, abbrechen müsste. Denn ohne nachweisliche medizinische Praktika hatte ich, trotz meines respektablen Abiturs, noch einige Wartesemester vor mir. Auch wenn mein Herz seit meinem ersten Reanimationstraining, das der Coach unseres Schwimmvereins organisierte, für die Medizin schlug.
In jugendlichem Enthusiasmus hatte ich dann wenig später das eines überfahrenen Hundes freipräpariert, um mit eigenen Augen zu sehen, wie das Klappensystem denn nun genau funktionierte, und außerdem die Prüfung zum Rettungsschwimmer abgelegt. Darüberhinaus war ich in Bezug auf meine beruflichen Pläne der Auffassung, dass gerade Akademiker zumindest die Grundkrankenpflege beherrschen sollten und nicht vor einer vollen Windel zurückschrecken dürfen. Aus diesem Grund hatte ich auch schon daran gedacht, vorerst mit einer Ausbildung zum Krankenpfleger zu beginnen. Allerdings klammerte ich mich immer noch an die Hoffnung, irgendwie trotzdem einen Studienplatz zu ergattern. Und da war ich im FSJ deutlich flexibler.
Leider wurde ich am Anfang nur im sogenannten Patientenbegleitservice eingesetzt, bei dem ich verstauchte Knöchel und ausgerenkte Schultern mit dem Rollstuhl von der Notaufnahme in die Röntgenabteilung kutschieren musste. Aber fast alle Patienten fanden nach der stundenlangen Warterei meine rasanten Fahrten, die ich meist mit Formel-Eins-Geräuschen untermalte, sehr erfrischend.
Doch mein Tätigkeitsprofil änderte sich schlagartig, als ich eines Tages in der Radiologie auf eine verschobene Kniescheibe wartete. Eine Neurochirurgin, die ich nur vom Sehen her kannte, diskutierte gerade mit dem Leiter der Intensivstation, Professor Erlenmeyer, über eine Computertomographie. Das Unfallopfer, dessen Schädelschnitte über den großen Monitor wanderten, hatte offensichtlich eine Fraktur des Scheitelbeins. Dadurch wurden Teile davon nach innen auf das Gehirn gedrückt und verursachten so eine Blutung.
Um besser sehen zu können, schob ich mich vorsichtig näher. Blöderweise stieß ich dadurch gegen den Stuhl der Neurochirurgin.
„Tschuldigung“, murmelte ich leise und trat sofort einen Schritt zurück. Doch es war bereits zu spät.
Sie fuhr herum und musterte mich etwas seltsam von oben bis unten. Für den ersten Augenblick wusste ich nicht so recht, ob sie sich einfach wieder umdrehen oder mir ihren Kugelschreiber in den Hals rammen würde.
„Und, junger Mann“, wollte sie ein wenig überheblich wissen, „was sehen Sie auf den Aufnahmen?“
Jetzt drehte sich auch Erlenmeyer zu mir herum, nahm seine Brille ab und zog die Mundwinkel nach oben. Aber es wirkte keinesfalls herablassend, sondern nur irgendwie neugierig. Fordernd deutete er mit seiner Hand auf den Monitor.
Zum Glück war es fast stockdunkel, so dass keiner meine wechselnde Gesichtsfarbe erkennen konnte. Nur durch das strahlensichere Fenster fiel etwas Licht aus dem Nachbarraum, in dem das riesige Gerät brummte, auf den Schreibtisch der Röntgenassistentin. Leider hatte die im Moment auch nichts anderes zu tun und starrte mich zu allem Überfluss ebenfalls an.
Die drei konnten natürlich nicht ahnen, dass ich seit dem schicksalhaften Hundeexperiment medizinische Veröffentlichungen aufsog wie ein Schwamm und beim ehrenamtlichen Dienst in den Berliner Freibädern schon mehr Schnittwunden versorgt hatte als eine mittelgroße Arztpraxis.
„Also …“, begann ich zögernd und räusperte mich. Dann trat ich langsam näher an den Monitor heran, um noch etwas Zeit zu schinden. Viel mehr, als mir einen dämlichen Kommentar anhören zu müssen, konnte eigentlich nicht passieren. „… die deutliche Mittellinienverschiebung weist auf einen erhöhten Hirndruck hin“, fuhr ich relativ selbstsicher fort. „Offensichtlich resultiert der aus einer subduralen Blutung, die wiederum von der Fraktur des Os parietale verursacht wurde.“
Der Oberärztin klappte der Unterkiefer nach unten, während Erlenmeyer anerkennend die Augenbrauen nach oben zog.
„Und hätten Sie auch einen Therapievorschlag?“, fuhr er mit einem kollegialen Tonfall fort.
„Bei der Größe der Blutung wird eine Drainage nicht viel bringen“, gab ich mutig zurück, weil in diesem Fall das Schädeldach entfernt werden muss. „Da kann man eigentlich nur noch entdeckeln.“
„Entdeckeln!“, stieß die Neurochirurgin völlig entgeistert hervor und kratzte sich nervös an der Stirn. „Haben Sie wirklich gerade entdeckeln gesagt?“
„Ich lese sehr viel“, gab ich lakonisch zurück.
Zwei Tage später war ich für sämtliche Ausscheidungen der Patienten der Intensivstation verantwortlich. Wenn das in dem Tempo weiterging, hatte ich sicher eine strahlende Zukunft vor mir. Doch zuerst musste ich mich durch die eher unangenehmere Seite meiner Beförderung kämpfen und mir außerdem noch einige blöde Bemerkungen anhören. Schließlich war ich ja keine Fachkraft und hatte auf der Station eigentlich nichts zu suchen. Trotzdem erfüllte ich meine neue Aufgabe nach einer ausführlichen Einweisung sehr gewissenhaft. Ich konnte mir recht gut vorstellen, dass es nicht besonders angenehm war, in seinen eigenen Exkrementen zu liegen.
Dadurch schlug ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.
Zum einen reduzierte sich die Geruchsbelästigung auf ein Mindestmaß und die Patienten, die noch halbwegs beieinander waren, waren über meine schnelle Hilfe mehr als dankbar. Und zum anderen konnte ich so den Nörglern richtig in die Eier treten.
Das Ganze ging schließlich nach einigen Wochen so weit, dass während einer sehr stressigen Schicht Sophie, die stellvertretende Stationsschwester, völlig vergaß, dass ich nur eine Hilfskraft war.
„Kannst du in der vier bitte mal die Jono wechseln“, rief sie mir zu, während sie mit einem Paket Spritzenpumpen unter dem Arm über den Gang hastete.
„Klar“, bestätigte ich, ohne mir etwas dabei zu denken.
Denn jeder wusste inzwischen von meinen beruflichen Plänen. Und, dass ich für mehr zu gebrauchen war, als Urinbeutel wechseln. Außerdem ist diese Lösung nur für den Ausgleich des Flüssigkeitsverlustes gedacht und enthält lediglich Elektrolyte in der gleichen Konzentration wie das menschliche Blut. Darüberhinaus kannte ich die Handgriffe dafür bereits nach ein paar Tagen wie im Schlaf.
„Hallo General!“, grüßte ich mit militärischen Tonfall beim Betreten des Zimmers und knallte gekünstelt die Hacken zusammen.
Arthur Weinert war zwar kein wirklicher General, aber irgendjemand hatte ihm den Spitznamen MacArthur verpasst. Genau wie der legendäre amerikanische Befehlshaber aus dem Zweiten Weltkrieg. Nur leider musste unserem aufgrund eines Tumors ein Großteil des Darms entfernt werden.
„Hallo Soldat“, grüßte er augenzwinkernd zurück.
Sein Zustand hatte sich soweit stabilisiert, dass er schon morgen auf eine normale Station verlegt werden sollte.
„Ich schmeiß eine neue Runde“, kündigte ich übertrieben großspurig an und zog eine neue Flasche aus dem Wärmefach.
Dann stoppte ich die Dosierpumpe, schloss den Dreiwegehahn an seinem Venenkatheter und wechselte die Infusion. Gerade als ich den Infusiomat wieder startete, kreischte Sophie hinter mir auf.
„Scheiße!“, stieß sie erschrocken hervor und schlug die Hände vor das Gesicht. „Ich bin eine Idiotin. Wenn das rauskommt gibt’s richtig Ärger. Noch hast du ja keinen Doktortitel.“ Sophie holte tief Luft. „Und sorry, aber du bist ja noch nicht mal Krankenpfleger.“
„Hey…“, versuchte ich sie zu beruhigen, „das ist doch nur eine Elektrolytlösung.“
„Elektrolytlösung, Elektrolytlösung“, äffte sie mich wütend nach. „Erlenmeyer versteht da keinen Spaß.“
„Alexander hat alles abgestellt und die neue ordentlich angeschlossen“, mischte sich jetzt MacArthur ein. „Da können sich selbst die Jungspunde von Assistenzärzten noch eine Scheibe abschneiden.“ „Die finden bei mir ja nicht einmal eine Vene“, fügte er hinzu und präsentierte seinen linken Unterarm, auf dem das bläuliche Adergeflecht deutlich zu sehen war.
Sophies Blick schoss aufgeregt zwischen MacArthur und mir hin und her. Sie war echt hübsch und ich konnte nur mit Mühe der Versuchung widerstehen, sie tröstend in den Arm zu nehmen.
„Apropos Vene“, fuhr ich um Ablenkung bemüht fort und deutete auf den transparenten Verband. „Die Punktionsstelle sieht irgendwie gerötet aus. Ich glaube der Katheter sollte gewechselt werden.“
„Ich fasse es nicht“, murmelte Sophie, während sie das Pflaster inspizierte.
„Was fasst du nicht?“
Wir schossen gleichzeitig herum.
In der Tür lehnte Martin Scholz, der Oberarzt, und warf Sophie einen fragenden Blick zu. Er war ein recht umgänglicher Typ und mit allen Schwestern und Pflegern per Du. Nur eben nicht mit mir.
„Alexander hat beim Anschließen der Infusion festgestellt, dass die Einstichstelle ein bisschen entzündet ist und der Katheter gewechselt werden sollte“, platzte es aus MacArthur heraus.
Sophie sah aus als bekäme sie gleich einen epileptischen Anfall, während sie sich haltsuchend mit hochrotem Kopf am Verbandswagen festklammerte. Doch Scholz tat so, als sei meine Aktion die normalste Sache der Welt. Mit einer lässigen Geste zog er ein Stauband von einem Edelstahltablett. Dann ließ er es fordernd vor meinem Gesicht hin und her baumeln.
„Wie ich gehört habe, Bergmann, werden wir wahrscheinlich früher oder später Kollegen“, stellte er wohlwollend fest.
„Wenn es nach der Zentralen Vergabestelle geht, eher später“, gab ich ein bisschen resigniert zurück.
„Das sind Idioten“, fuhr Scholz fort und wedelte weiter mit dem Band. „Jetzt zeigen Sie mal, was Sie drauf haben!“
Bereitwillig drückte MacArthur seine Ellenbeuge durch, während es aus Sophies Richtung so klang, als würde sie gleich ersticken.
Vorsichtig nahm ich Scholz das Stauband aus der Hand und schlang es anschließend um den vorgestreckten Unterarm. Theoretisch kannte ich ja den Ablauf. Aber meine praktische Erfahrung beschränkte sich auf die Venen meiner Kumpels, die ich mit ein paar Bier überredet hatte, Versuchsobjekte zu spielen.
Die riesige Welle, die mich gerade überrollte, glich einer heißen Sauna. In Sekunden war ich schweißgebadet und das nervige Gefiepe der Überwachungsgeräte steigerte sich in meinen Ohren zur Lautstärke eines startenden Düsenjets. Genauso gut hätte Scholz mich auffordern können, vor der gesamten Ärzteschaft einen Vortrag zu halten.
„Mein Arm platzt gleich“, erinnerte mich MacArthur grinsend.
„Sorry“, murmelte ich aufgeregt zurück.
Dann besprühte ich seinen Arm großzügig mit Desinfektionsmittel und zog vorsichtig eine große Verweilkanüle aus ihrer sterilen Verpackung.
„Welche nehmen Sie, Bergmann?“, flüsterte Scholz dicht hinter mir.
„Die Cephalica“, antwortete ich jetzt ein wenig entspannter und deutete auf die große Ader, die sich vom Daumen her über die Außenseite von MacArthurs Unterarm zog.
„Und warum?“
„Man erreicht hier relativ hohe Durchflussraten und der Patient wird durch die Gelenkferne nicht in seiner Bewegung eingeschränkt“, flüsterte ich jetzt ebenfalls und versuchte meine Nervosität hinunterzuschlucken.
„Sehr gut“, stellte Scholz fest, während ich mit zusammengekniffenen Augen und angehaltenem Atem die ledrige Haut durchbohrte.
Doch bevor ich bewusstlos nach hinten kippen konnte, füllte sich die Kontrollkammer doch tatsächlich mit Blut und flutete so meinen Körper mit einer unbeschreiblichen Euphorie. Ich sah mich bereits in einer Reihe mit Christiaan Barnard, der seinerzeit in Kapstadt das erste Herz transplantierte, und plötzlich war meine Anspannung wie weggeblasen.
„Und warum bewerben Sie sich nicht einfach im Ausland?“, wollte Scholz wissen, ohne auf meine erfolgreiche Punktion einzugehen.
„Mir geht es nicht schlecht“, stellte ich immer noch ein bisschen zitternd fest, „aber ich bin kein Millionär.“
„Es gibt Stipendien“, entgegnete Scholz.
„Hmmm …“, murmelte ich nachdenklich, während ich den Katheter fixierte. „Und an welches Land haben Sie dabei gedacht?“
„Natürlich an die Staaten“, antwortete Scholz wie aus der Pistole geschossen. „Wenn Sie erst einmal die Auswahljury von sich überzeugt haben, dann sind die Amis mit Stipendien sehr großzügig.“
„Und hätten Sie da auch einen heißen Tipp für mich?“, hakte ich ein bisschen vorlaut nach, weil ich von meinem Erfolgserlebnis noch völlig benebelt war.
„Gehen Sie doch nach Yale!“, gab Scholz in einen selbstverständlichen Tonfall zurück.
„Genau, Yale“, schloss sich auch MacArthur an und stupste mich in die Seite.
„Kann ich jetzt schon ein Autogramm haben“, kicherte Sophie aus dem Hintergrund, während sie beide Daumen nach oben streckte.
Plötzlich begann sich das Zimmer zu drehen. An so etwas hatte ich bisher noch nicht einmal im Traum gedacht. Doch jetzt, da Scholz es so leichthin ausgesprochen hatte, erschien diese Möglichkeit plötzlich äußerst real.
„Yale …?!“, krächzte ich. „Ist das Ihr Ernst?“
„Yale oder irgendeine andere von den Ivys“, bestätigte er ohne ein Anzeichen, dass er scherzte. „Das Einzige, was passieren kann, ist, dass Sie abgelehnt werden.
„Was sind Ivys?“, wollte Sophie verständlicherweise wissen.
„Acht Elite-Unis in Neuengland“, antwortete Scholz und legte sich nachdenklich den Finger auf den Mund. „Harvard, Princeton, Cornell, Columbia und natürlich Yale.“ Er machte eine kurze Pause. „Die anderen drei fallen mir gerade nicht mehr ein“, fügte er hinzu. „Und sie werden Ivys, oder richtiger Ivy League, genannt, weil die alten Gebäude mit Efeu bewachen sind und sie ursprünglich zu einer Liga des Hochschulsports gehörten.“
„Und da kann man sich einfach so bewerben?“, hakte Sophie nach.
„Natürlich“, bestätigte Scholz. „Dort ist man immer auf der Suche nach dem nächsten Bill Gates oder …“ Er zwinkerte mir zu. „… Robert Koch.“
„Aha …“, murmelte ich ungläubig.
„Sie sollten auf jeden Fall zweigleisig fahren und hier ebenfalls am Ball bleiben, denn so schnell wird das nicht gehen“, dämpfte Scholz meine Erwartungen. „Bevor sie überhaupt in die engere Wahl kommen, müssen Sie sich förmlich nackig machen.“ Er grinste. „Die Auswahlkommissionen wollen Visionen …“
„Das klingt ja ganz so, als hätten Sie das schon selbst probiert“, unterbrach MacArthur den Oberarzt.
„Wenn man jung ist, dann kommen einem die verrücktesten Ideen“, stellte Scholz lakonisch fest. „Und wie gesagt, Bergmann, Sie brauchen irgendetwas womit Sie aus der Masse Sie herausstechen oder eine durchgeknallte Geschichte.“
„Ich habe einmal bei einem überfahrenen Hund das Herz freipräpariert…“, begann ich vorsichtig.
Sophie verzog das Gesicht, als hätte sie in eine Zitrone gebissen, und Scholz verschluckte sich fast an seiner Zunge.
„… dann habe ich mit dünnen Silikonschläuchen, verdünntem Johannisbeersirup und einem kleinen Messbecher das Schlagvolumen ermittelt“, fuhr ich fort. „Da war ich allerdings noch jünger“, fügte ich entschuldigend hinzu.
„Warum der Sirup?“, wollte Scholz interessiert wissen, als er wieder normal atmen konnte.
„Wegen der Viskosität“, klärte sich ihn auf.
„Verstehe …“ Scholz nickte abwesend. „Und wie ist die Blutviskosität bei Hunden?“
„So genau weiß ich das auch nicht“, musste ich eingestehen. „Da habe ich einfach die, eines gesunden Menschen angenommen. Also vier Komma fünf, im Vergleich zu Wasser.“
„Wenn Sie nicht spätestens an Ihrem nächsten freien Tag mit der Zusammenstellung Ihrer Bewerbungsunterlagen beginnen, dann trete ich Ihnen in den Hintern“, kündigte Scholz mit ernster Mine an, während er einen prüfenden Blick auf MacArthurs Überwachungsmonitor warf.
„Ich bin übrigens Martin“, fügte er grinsend hinzu.