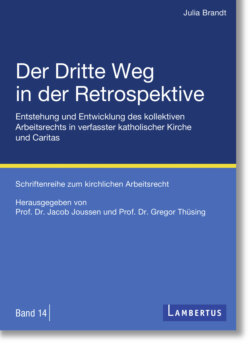Читать книгу Der Dritte Weg in der Retrospektive - Julia Brandt - Страница 24
3.Zwischenergebnis: Vergleich der Strukturen
ОглавлениеZwischen beiden Akteuren gab und gibt es durchaus Verflechtungen: ein katholischer Kindergarten kann etwa als typische caritative Einrichtung der katholischen Kirche innerkirchlich mehrfach in Erscheinung treten. Als Einrichtung der katholischen Pfarrgemeinde ist er zugleich korporatives Mitglied des DCV, seine Mitarbeiter können nach den AVR der Caritas, nach anderen kircheneigenen Vergütungsordnungen oder anderen übernommenen Tarifen entlohnt werden.163
Die überbetrieblichen Mitbestimmungsordnungen haben sich unterschiedlich entwickelt. Der DCV als weltlich eingetragener Verein hat trotz eigener Diözesancaritasverbände seit jeher die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter überdiözesan organisiert.164 Die Normierung des Dritten Weges beruht in der Caritas nicht auf der Gesetzgebungsgewalt der Bischöfe, sondern auf der Satzungsautonomie des DCV.165 Die Caritas hatte mit dem DCV bereits früh einen Dachverband, in dessen Gremien die AVR entwickelt und die Bildung der Arbeitsrechtlichen Kommission beschlossen wurde. Allgemein sind die konfessionellen Wohlfahrtsverbände im Gegensatz zu den verfassten Kirchen überwiegend als kollektive Akteure aufgebaut, bei ihnen ist zudem weniger hierarchische Steuerung möglich.166 In der verfassten katholischen Kirche war und ist jede Diözese mit ihrem Bischof als Gesetzgeber eigenständig auch für die Regelung der Dienstverhältnisse verantwortlich, was sich auch am Bestand diverser arbeitsvertraglicher Regelungen zeigte.167 Hier übernahm der VDD als überörtliche Instanz die Entwicklung kollektiver Mitwirkungsinstrumente in Form von Rahmenregelungen, die freilich durch jeden Bischof in seiner Diözese in Kraft zu setzen waren.
Bei beiden Akteuren bedurfte es zentraler Stellen, die die Regelung der überbetrieblichen Mitbestimmung in die Hand nahmen, oft voran getrieben durch einzelne Personen und Experten, denen bei dieser Entwicklung Schlüsselpositionen zukamen. In der verfassten katholischen Kirche wurde eine Institution, welche die überdiözesane Aufgabe der Entwicklung eines Systems zum Arbeitsrecht übernehmen konnte, erst 1968, mit Gründung des VDD, geschaffen.
72Die Darstellung hier umfasst nicht alle Einzelheiten, sondern konzentriert sich vor allem auf die Institutionen in verfasster katholischer Kirche und Caritas, die an der Etablierung und Weiterentwicklung des Dritten Weges beteiligt waren und sind. Zu Aufbau und Organisation der verfassten katholischen Kirche siehe umfassend Schwendenwein, Die Katholische Kirche – Aufbau und rechtliche Organisation, Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, Beiheft 37, Essen, 2003; siehe auch Schlief, Die Organisationsstruktur der katholischen Kirche, in: Listl/Pirson (Hrsg.), HbStKR, Bd. I, 2. Aufl. 1995, § 11; zur Organisation der Caritas: Hierold, Grundlegung und Organisation kirchlicher Caritas, 1979; SchmitzElsen, Die karitativen Werke und Einrichtungen im Bereich der katholischen Kirche in: Listl/Pirson (Hrsg.), HbStKR, Bd. II, 2. Aufl. 1995, § 61.
73So in einem Entwurf von Berghaus für den Zentralrat am 17. April 1980 zum Memorandum des Deutschen Caritasverbandes zu Selbstverständnis und Auftrag verbandlich organisierter Caritas im heutigen kirchlichen und gesellschaftlichen Kontext, ADCV 111.055-1980/1.
74Für eine Gesamtdarstellung siehe etwa Schwendenwein, Die Katholische Kirche Aufbau und rechtliche Organisation.
75Katholische Kirche in Deutschland ZAHLEN UND FAKTEN 2017/18, Arbeitshilfen 299 der DBK, abrufbar unter: https://dbk.de/fileadmin/redaktion/Zahlen%20und%20Fakten/Kirchliche%20Statistik/Allgemein_-_Zahlen_und_Fakten/AH299_Zahlen-und-Fakten-2017-2018_web.pdf (abgerufen am 27.11.2018).
76Katholische Kirche in Deutschland ZAHLEN UND FAKTEN 2017/18, Arbeitshilfen 299 der DBK, abrufbar unter: https://dbk.de/fileadmin/redaktion/Zahlen%20und%20Fakten/Kirchliche%20Statistik/Allgemein_-_Zahlen_und_Fakten/AH299_Zahlen-und-Fakten-2017-2018_web.pdf (abgerufen am 27.11.2018).
77Schlief, Die Organisationsstruktur der katholischen Kirche, in: Listl/Pirson (Hrsg.), HbStKR, Bd. I, 2. Aufl. 1995, S. 347.
78Hessler/Strauß, Kirchliche Finanzwirtschaft, Bd. I: Finanzbeziehungen und Haushaltsstrukturen in der evangelischen und katholischen Kirche in der Bundesrepublik Deutschland, S. 29 f.; zu den hierarchischen Organen auch Aymans in: Haering/Rees/Schmitz (Hrsg.), HbkathKR, 3. Aufl. 2015, S. 436.
79Schlief, Die Organisationsstruktur der katholischen Kirche, in: Listl/Pirson (Hrsg.), HbStKR, Bd. I, 2. Aufl. 1995, S. 356.
80Hessler/Strauß, Kirchliche Finanzwirtschaft, Bd. I: Finanzbeziehungen und Haushaltsstrukturen in der evangelischen und katholischen Kirche in der Bundesrepublik Deutschland, S. 33.
81Kuper, RdA 1979, 93 (94).
82So bereits Keßler, Die Kirchen und das Arbeitsrecht, S. 23, 24.
83Zur Normgebern in der katholischen Kirche Eder, ZMV 2014, 310 ff.; Rhode, Der Bischof und der Dritte Weg, in: Rees (Hrsg.), FS für Listl zum 75.Geburtstag, S. 314.
84Pree in: Haering/Rees/Schmitz (Hrsg.), HbKathKR, S. 1498; der vereinzelte Vorschlag für eine Zusammenführung von DBK und VDD von Lettmann im Rheinischen Merkur 1972 blieb ohne Resonanz, dazu Kräßig, Der Verband der Diözesen Deutschlands, S. 68 f.
85In damaligen Bekanntmachungen zur Gründung des VDD hieß es: „Es wird festgestellt, daß der neue Verband auf Grund des Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 137 Abs. 5 S. 3 Weimarer Reichsverfassung die Rechtstellung einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft besitzt…“, Schlief in: Friesenhahn/Scheuner (Hrsg.) HbStKR, 1975, S. 311, Fn. 36 mit Verweis auf die „Bekanntmachung über die Gründung eines Verbandes der Diözesen Deutschlands“ vom 21. August 1968, Nr. MB I -2/95 510, in: Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. 14 ausgegeben in München am 2. September 1968, Jahrgang 1968, S. 281-283.
86Schlief, Die Organisationsstruktur der katholischen Kirche, in: Listl/Pirson (Hrsg.), HbStKR, Bd. I, 2. Aufl. 1995, S. 366 m.w.N.
87Kräßig, Der Verband der Diözesen Deutschlands, S. 5.
88Katholische Kirche in Deutschland ZAHLEN UND FAKTEN 2017/18, Arbeitshilfen 299 der DBK, abrufbar unter: https://dbk.de/fileadmin/redaktion/Zahlen%20und%20Fakten/Kirchliche%20Statistik/Allgemein_-_Zahlen_und_Fakten/AH299_Zahlen-und-Fakten-2017-2018_web.pdf (aufgerufen am 27.11.2018). Zur Geschichte der Bischofskonferenzen in Deutschland: Kräßig, Der Verband der Diözesen Deutschlands, S. 5 ff. und https://www.dbk.de/ueber-uns/geschichte/ (aufgerufen am 15.07.2019).
89https://www.dbk.de/ueber-uns/geschichte/ (aufgerufen am 15.07.2019); zur Geschichte der DBK auch Iserloh in: Mogge (Hrsg.), Ein „Kölner Ereignis“ im Jahre 1977, S. 31 ff.
90https://www.dbk.de/ueber-uns/geschichte/ (aufgerufen am 15.07.2019).
91https://www.dbk.de/ueber-uns/geschichte/ (aufgerufen am 15.07.2019); dazu auch May, ArchfkKR (138) 1969, 405 ff.
92https://www.dbk.de/ueber-uns/geschichte/ (aufgerufen am 15.07.2019).
93Schlief, Die Organisationsstruktur der katholischen Kirche, in: Listl/Pirson (Hrsg.), HbStKR, Bd. I, 2. Aufl. 1995, S. 362 m.w.N.
94Gem. § 2 Abs. 1 und 2 des Statuts der DBK: die Diözesanbischöfe, die Koadjutoren, die Diözesanadministratoren, die Weihbischöfe und die anderen Titularbischöfe, die ein besonderes, vom Apostolischen Stuhl oder von der Deutschen Bischofskonferenz übertragenes Amt im Konferenzgebiet bekleiden. Beratende Mitglieder der BDK sind die Vorsteher anderer katholischer Rituskirchen eigenen Rechts und die diesen rechtlich Gleichgestellten, die im Konferenzgebiet ihren Sitz haben.
95Zur Entwicklung des Ständigen Rates: Kräßig, Der Verband der Diözesen Deutschlands, S. 25 ff.
96Kräßig, Der Verband der Diözesen Deutschlands, S. 28.
97Anlage zur Vorlage zu TOP 8 der Sitzung des Verwaltungsrates des VDD am 28./29. Oktober 1975, BAE GV 16-440.
98Näher dazu unten D. I. 2. b).
99Kräßig, Der Verband der Diözesen Deutschlands, S. 32.
100https://www.dbk.de/ueber-uns/bischoefliche-kommissionen/ (aufgerufen am 10.12.2018).
101Hessler/Strauß, Kirchliche Finanzwirtschaft, Bd. I: Finanzbeziehungen und Haushaltsstrukturen in der evangelischen und katholischen Kirche in der Bundesrepublik Deutschland, S. 63.
102Kräßig, Der Verband der Diözesen Deutschlands, S. 60.
103Homeyer, Ein Verband für die Diözesen Deutschlands, in: Domkapitel zu Essen (Hrsg.), Zeugnis und Dienst. Zum 70. Geburtstag von Hengsbach, S. 242.
104Eder, Tarifpartnerin Katholische Kirche?, S. 48.
105Eder, Tarifpartnerin Katholische Kirche?, S. 49.
106Dazu Kräßig, Der Verband der Diözesen Deutschlands, S. 15 ff.
107Zu den Beweggründen der Neufassung der Satzung Kräßig, Der Verband der Diözesen Deutschlands, S. 63 ff.
108Die Arbeit der Weiterentwicklung des Dritten Weges, dessen Grundlagen die ursprünglich vom Verwaltungsrat des VDD eingesetzte „Krautscheidt-Kommission“ erarbeitet hatte, übernahm nach den Umstrukturierungen ab 1978 die Personalwesenkommission des VDD. Diese war in der Folgezeit mehrfach sowohl mit der Novellierung der KODA-, als auch der MAVO-Rahmenordnungen befasst.
109§ 3 der Satzung des VDD 1968, der mir vom Archiv des Erzbistums Köln zur Verfügung gestellt wurde. Der Text dieser Satzung ist gedruckt unter der Überschrift „Bekanntmachungen des Erzbischöflichen Generalvikariates“ im Kirchlichen Anzeiger für die Erzdiözese Köln, 114. Jahrgang, Nr. 234.
110§ 5 Satzung des VDD, i.d.F. des Beschlusses der Vollversammlung vom 29.4.2019.
111§ 15 Ziff. 1 Satz 1 der Satzung VDD. Darüber hinaus kann die Vollversammlung im Aufgabenbereich einer Kommission eine oder mehrere Unterkommissionen einrichten, § 15 Ziff. 2 Satz 1 der Satzung des VDD.
112Benannt nach dem Vorsitzenden der Kommission, dem damaligen Generalvikar aus Essen. Siehe dazu unten D. I. 3., 4.,5.
113§ 7 Nr. 5, § 8 Nr. 2 der Satzung des VDD 1968, der mir vom Archiv des Erzbistums Köln zur Verfügung gestellt wurde. Der Text dieser Satzung ist gedruckt unter der Überschrift „Bekanntmachungen des Erzbischöflichen Generalvikariates“ im Kirchlichen Anzeiger für die Erzdiözese Köln, 114. Jahrgang, Nr. 234.
114Siehe B. II. 1. c).
115Lüdicke, Der Diözesanbischof und das kirchliche Arbeitsrecht, in: Demel/ders. (Hrsg.), Zwischen Vollmacht und Ohnmacht, Die Hirtengewalt des Diözesanbischofs und ihre Grenzen, S. 401.
116Lüdicke, Der Diözesanbischof und das kirchliche Arbeitsrecht, in: Demel/ders. (Hrsg.), Zwischen Vollmacht und Ohnmacht, Die Hirtengewalt des Diözesanbischofs und ihre Grenzen, S. 401; Eder sieht die Legitimation des VDD dadurch gegeben, dass gem. can. 393 der Diözesanbischof die Diözese in all ihren Rechtsgeschäften vertritt, Eder, Tarifpartnerin Katholische Kirche?, S. 49.
117Zur Rolle des Bischofs im Dritten Weg Dütz, Bischof und KODA-System, in: Annuß/Picker/Wißmann (Hrsg.), FS für Richardi zum 70. Geburtstag, S. 869 ff.; Rhode, der Bischof und der Dritte Weg, in: Rees (Hrsg.), FS für Listl zum 75.Geburtstag, S. 313 ff.
118In den Ordnungen mit „Letztentscheidungsrecht“ bezeichnet, dazu auch Eder, ZMV 2005, 66 - 71.
119Auch die Zentral-KODA enthält kein Notverordnungsrecht, Eder, ZMV 2005, 66 (67).
120Fuhrmann in: Reichold/Kortstock (Hrsg.), Das Arbeits- und Tarifrecht in der katholischen Kirche, Diözesanbischof, S. 144.
121Fuhrmann in: Reichold/Kortstock (Hrsg.), Das Arbeits- und Tarifrecht in der katholischen Kirche, Diözesanbischof, S. 144, 145: Die Vollversammlung des VDD hat am 19. November 2012 Änderungen der Rahmenordnung für die Kommission zur Ordnung des Diözesanen Arbeitsvertragsrechts (Rahmen-KODA-Ordnung) beschlossen, damit wurde das Notverordnungsrecht abgeschafft und das Letztentscheidungsrecht eingeschränkt.
122Fuhrmann in: Reichold/Kortstock, Das Arbeits- und Tarifrecht in der katholischen Kirche, S. 145; Eder ZTR 2016, 680; dagegen Klumpp, KuR 2012,176 ff. (190 f.)
123Eder, Ausübung bischöflicher Vollmacht im KODA-System, in: ders./Däggelmann/Oxen-knecht-Witzsch (Hrsg.), FS Graedler, S. 83.
124Fuhrmann in: Reichold/Kortstock (Hrsg.), Das Arbeits- und Tarifrecht in der katholischen Kirche, Diözesanbischof, S. 144.
125BAG 20.11.2012 - 1 AZR 179/11.
126Fuhrmann in: Reichold/Kortstock, Das Arbeits- und Tarifrecht in der katholischen Kirche, S. 145.
127Dütz, Bischof und KODA-System, in: Annuß/Picker/Wißmann (Hrsg.), FS für Richardi zum 70. Geburtstag, S. 869 ff.
128Aus einem Memorandum, welches auf der Sitzung des Zentralrates des DCV am 16. und 17. April 1980 in Bamberg unter TOP 8 diskutiert wurde. Dieses sollte Positionspapier für internen Gebrauch sein, wurde so jedoch nicht vom Zentralrat angenommen, sondern sollte weiter ausgearbeitet werden, ADCV 111.055-1980/1.
129Scheuner in: Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche, Band 8, S. 47.
130Dazu näher Frie, Zwischen Katholizismus und Wohlfahrtsstaat. Skizze einer Verbandsgeschichte der Deutschen Caritas in: Furger (Hrsg.), Jahrbuch für christliche Sozialwissenschaften, Bd. 38, 1997, S. 21-42 (22).
131Scheuner in: Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche, Band 8, S. 47.
132Scheuner in: Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche, Band 8, S. 47.
133Hüssler, 75 Jahre Deutscher Caritasverband 1899-1972, in: Deutscher Caritasverband (Hrsg.), 75 Jahre Deutscher Caritasverband, S. 11. Der Verband trägt seit 1909 den Namen „Caritasverband“, seit 1919 „Deutscher Caritasverband“.
134Präambel der Satzung des DCV vom 16. Oktober 2003, in der Fassung vom 18. Oktober 2005.
135Kuper, RdA 1979, 93 (94).
136Gatz, Caritas und soziale Dienste, in: Rauscher (Hrsg.): Der soziale und politische Katholizismus, Bd. 2, S. 327.
137Zu seiner Person und seinem Beitrag zur Gründung des Caritasverbandes: Neher/Feige/Wollasch/Wollasch, Lorenz Werthmann – Caritasmacher und Visionär.
138Vgl. dazu näher: Gatz, Caritas und soziale Dienste, in: Rauscher (Hrsg.): Der soziale und politische Katholizismus, Bd. 2, S. 329; zur Geschichte auch Hüdepohl, Organisation der Wohlfahrtspflege, S. 32 ff.
139Scheidgen, Die verbandliche Caritas und die katholische Kirche in Deutschland in den letzten 100 Jahren unter besonderer Berücksichtigung der Erzdiözese Köln, in: Feldhoff/Dünner (Hrsg.), Die verbandliche Caritas, S. 23.
140Frie stellt heraus, dass die Intention Werthmanns, den Bekanntheitsgrad der katholischen Wohlfahrtsarbeit durch bessere Öffentlichkeitsarbeit zu steigern, ihre fachliche Qualifikation zu heben und ihre Eigenständigkeit durch eine geschlossene Organisation zu sichern bei Anstalten, Orden, Vereinen und dem Episkopat nicht auf ungeteilte Zustimmung traf, denn ein Ausgreifen des neuen Überverbandes auf ihre Arbeitsfelder wurde befürchtet, Frie, Zwischen Katholizismus und Wohlfahrtsstaat. Skizze einer Verbandsgeschichte der Deutschen Caritas in: Furger (Hrsg.), Jahrbuch für christliche Sozialwissenschaften, Bd. 38, 1997, S. 21-42 (27, 28).
141Liese, Geschichte der Caritas, Bd. 1, S. 386.
142Bühler, Die Einrichtungen der deutschen Caritas 1913-1970, in: Deutscher Caritasverband Freiburg (Hrsg.), 75 Jahre Deutscher Caritasverband, S. 207.
143Näher: Gatz, Caritas und soziale Dienste, in: Rauscher (Hrsg.), Der soziale und politische Katholizismus, Bd. 2, S. 331.
144Gatz, Caritas und soziale Dienste, in: Rauscher (Hrsg.), Der soziale und politische Katholizismus Bd. 2, S. 334.
145www.caritas.de/diecaritas/wofuerwirstehen/geschichte-der-caritas?searchterm=geschichte++der+caritas, aufgerufen am 01.12.2019.
146Scheidgen, Die verbandliche Caritas, in: Feldhoff/Dünner (Hrsg.), Die verbandliche Caritas, S. 26; Benedict Kreutz (1879-1949) war der zweite Präsident des Deutschen Caritasverbandes.
147Scheidgen, Die verbandliche Caritas, in: Feldhoff/Dünner (Hrsg.), Die verbandliche Caritas, S. 26; Gatz, Caritas und soziale Dienste, in: Rauscher (Hrsg.), Der soziale und politische Katholizismus, Bd. 2, S. 335.
148Frie, Zwischen Katholizismus und Wohlfahrtsstaat. Skizze einer Verbandsgeschichte der Deutschen Caritas in: Furger (Hrsg.), Jahrbuch für christliche Sozialwissenschaften, Bd. 38, 1997, S. 21-42 (29).
149Hammerschmidt, Die Wohlfahrtsverbände im NS-Staat, S. 90 ff.
150Hammerschmidt, Die Wohlfahrtsverbände im NS-Staat, S. 90.
151Liese, Geschichte der Caritas, Bd. 1, S. 387, bezieht sich hier auf die Organe des Verbandes im Jahr 1917.
152Liese, Geschichte der Caritas, Bd. 1, S. 387, bezieht sich hier auf die Organe des Verbandes im Jahr 1917.
153Einen Überblick über die Entwicklung der Organe gibt Mitte der 1960er Jahre Klein, Die Verfassung der deutschen Caritas, 1966.
154Klein, Die Verfassung der deutschen Caritas, S. 81; Liese, Geschichte der Caritas, Bd. 1, S. 387.
155Hammerschmidt, Wohlfahrtsverbände in der Nachkriegszeit, S. 25, 27.
156Klein, Die Verfassung der deutschen Caritas, S. 82.
157Klein, Die Verfassung der deutschen Caritas, S. 82.
158Klein, Die Verfassung der deutschen Caritas, S. 83.
159Kuper, Caritas Jahrbuch 1978, S. 71.
160https://www.caritas.de/diecariatas/deutschercaritasverband/strukturundleitung/organedesdcv/organe-des-deutschen-caritasverbandes, aufgerufen am 12. August 2019.
161https://www.caritas.de/diecariatas/deutschercaritasverband/strukturundleitung/organedesdcv/organe-des-deutschen-caritasverbandes, aufgerufen am 12. August 2019.
162https://www.caritas.de/diecariatas/deutschercaritasverband/strukturundleitung/organedesdcv/organe-des-deutschen-caritasverbandes, aufgerufen am 12.08.2019.
163Kuper, RdA 1979, 93 (94).
164Eder, Tarifpartnerin katholische Kirche, S. 21; Kuper, RdA 1979, 93 (94).
165Rhode, Der Bischof und der Dritte Weg, in: Rees (Hrsg.), Festschrift für Listl zum 75.Geburtstag, S. 318.
166Lührs, Die Zukunft der Arbeitsrechtlichen Kommissionen, S. 226.
167Eder, Tarifpartnerin katholische Kirche, S. 21; Kuper, RdA 1979, 93 (94).