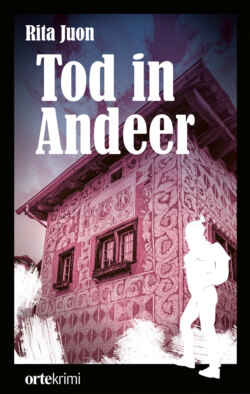Читать книгу Tod in Andeer - Juon Rita - Страница 14
6 September 2019
ОглавлениеPiet füllte zum dritten Mal die Waschmaschine. Zwei Waschgänge hatte er gebraucht, um alles zu reinigen, was er auf der einwöchigen Jagd getragen hatte. Zwei Kudus hatte er erlegt, noch jetzt schlich sich beim Gedanken daran ein stolzes Lächeln in sein Gesicht. Die Kudujagd war nichts für Draufgänger und Haudegen. Um bei Gefahr ihr Leben zu retten, zogen sich diese speziellen Antilopen klammheimlich ins Gebüsch zurück, anstatt, wie andere, Hals über Kopf davonzustürmen. Damit schlug die Stunde des besonnenen Jägers, zu welchen Piet sich zählte. Er brachte die Nerven auf, um reglos zu verharren, denn nun hing alles davon ab, keine Geräusche zu verursachen. Nur so erlebte man es möglicherweise, dass das Tier zuerst aufgab. Piet war dieser Moment in der einwöchigen Jagd drei Mal beschieden gewesen, zwei Mal hatte er getroffen. Die Kühltruhe in seinem Gästehaus in Mossel Bay würde zu Beginn der südafrikanischen Sommersaison gut gefüllt sein, Roos würde sich über die Grilladen freuen.
Beim Gedanken an sie verschwand das Lächeln aus seinem Gesicht. Mit gerunzelter Stirn füllte er die Wäsche in die Maschine, es gab noch einiges zu tun vor der Wiedereröffnung der Pension. Während der Jagd hatte er abseits in einer einfachen Hütte in der Eastern Cape Region gewohnt, ohne Telefonempfang. Erst auf der Heimreise hatte er das Gerät wieder eingeschaltet und ihr sofort geschrieben. Das war am Vortag gewesen, und bis jetzt hatte er nichts von ihr gehört. Dass sie seit bald vierundzwanzig Stunden nicht schrieb, war etwas sonderbar, musste er sich eingestehen. Ihm schien es manchmal, das Mobiltelefon sei ihr verlängerter Arm und längst mit ihr verwachsen.
Piet wäre jedoch nicht Piet, der erfolgreiche Kudujäger, gewesen, wenn er sich leicht aus der Ruhe bringen liesse. Er war sicher nicht einer dieser Männer, die ihre Frau oder Freundin pausenlos überwachten und in jedem Augenblick wissen mussten, was sie gerade trieb. Piet war ein erfolgreicher Jäger, weil er geduldiger war als alle anderen, seien es Kudus, Jäger oder Ehemänner.
Einige Waschgänge, zwei grosse Steaks und drei Dosen Bier später senkte sich die Sonne über das flache Land im Westen. Er liess den Blick gegen Süden schweifen. Irgendwo dort war der Südpol, dann sehr viel Meer, ein kleiner Durchgang zwischen Russland und Alaska, dann der Nordpol, Skandinavien. Von dort aus wäre es ein Katzensprung nach Italien, wo sie zusammen den südafrikanischen Winter verbracht hatten. In dieser Zeit herrschte tote Hose in Mossel Bay, es lohnte sich nicht, das Gästehaus offenzuhalten. Früher hatte er jeweils über den Winter eine Arbeit angenommen. Für einen praktisch veranlagten, starken Mann gab es genug zu tun. So hatten sie sich manchmal Ferien im warmen Norden leisten können. In den Niederlanden, wo ihre Ahnen herkamen, oder am Mittelmeer. Mit steigendem Wohlstand waren aus den zwei Ferienwochen Monate geworden. Jedenfalls für sie, denn ihm selbst wurde die Zeit irgendwann zu lang. Auch diesen Sommer war sie vor ihm nach Europa gereist. Ein paar Wochen später hatten sie zusammen zwei Monate in Italien verbracht, in den Ausläufern der Alpen. Das war für Piet eine neue Erfahrung gewesen; noch nie hatte er sich so lange im Landesinnern aufgehalten. Nach einer Woche hatte er das Meer zum ersten Mal vermisst, nach zwei Wochen war er unruhig geworden. Piet konnte es kaum fassen: Er, der geduldigste aller Jäger, wurde unruhig ohne freie Sicht bis zu einem Horizont, wo Himmel und Wasser sich trafen. Während es Roos wohl war in ihrer Ferienwohnung, brauchte er für seinen Seelenfrieden gelegentlich einen Ausflug an den Strand. Wenn er sich hatte überzeugen können, dass die Weite hinter den Hügeln noch da war, war er für einige Zeit wieder sein ausgeglichenes Selbst.
Seine Ruhe war nun allerdings gefährdet, weil er nichts von ihr hörte. Sie war in Europa geblieben, als er zur Jagd heimgekehrt war, hatte noch ein paar Besuche im Sinn gehabt, bevor sie ihm in wenigen Tagen nach Hause folgen wollte. Inzwischen vermisste er sie nicht nur, weil er ihr gerne von seinem Jagderfolg berichtet hätte, sondern weil er tatsächlich begann, sich Sorgen zu machen.
An diesem Abend konnte er nichts mehr tun. Das wurde ihm klar, als er das vierte Bier öffnete. Morgen würde er weitersehen.
Als Beni am Montagmittag nach der Arbeit nach Hause kam, hatte er einen Bärenhunger. Montag bis Freitag war Annetta für seine Verpflegung zuständig, was ihr gehörig Punkte auf der Ertragsseite einbrachte. An diesem Tag war es allerdings still im Haus, als Beni über die Schwelle trat. Vielleicht würde er über Mittag tatsächlich seine Ruhe haben.
In der Küche empfingen ihn die bunten Papierchen, die seine Nana so gewissenhaft vollschrieb. Mittels eines rosaroten Zettels, der an der Glasscheibe in der Küchentür haftete, erfuhr er, dass sie zum Einkaufen nach Thusis gefahren war und sein Essen in der Pfanne zum Aufwärmen bereit sei. Ein gelber Zettel auf dem Tisch teilte ihm mit, das WC sei einmal mehr verstopft, und die Behebung des Schadens gehöre zu seinen Pflichten. Beni stöhnte. Dieser Posten hätte seiner Meinung nach weit höher zu seinen Gunsten gewichtet werden müssen, aber er versuchte erst gar nicht, sich gegen seine Nana durchzusetzen. Ein violetter Zettel am Geschirrschrank schliesslich unterrichtete ihn darüber, dass man immer noch nicht wisse, wer die Tote sei. Ausrufezeichen. Das wäre Beni ohnehin klar gewesen. Diese Mitteilung war ihr einen Zettel und sogar ein Ausrufezeichen wert gewesen, woraus er folgerte, dass sie sich in das Thema verbissen hatte und nicht so schnell wieder loslassen würde. Beni seufzte erneut. Das konnte ja heiter werden.
Mit grossem Appetit schaufelte er Hörnli und Gehacktes mit Apfelmus in sich hinein, während er sich den Informationen auf seinem Smartphone widmete. Niemand wusste etwas Neues. Nicht einmal Gerüchte, die vielleicht Hand und Fuss hatten, machten die Runde. Allem Anschein nach hatte sogar niemand eine Vermutung, was sich bei der Brücke zugetragen haben und wer die Frau sein könnte.
Nachdem er das Geschirr in die Maschine geräumt hatte, streckte er sich ausgiebig. Bald würde er sich für drei Stunden aufs Ohr legen. Diesen Rhythmus hatte er sich angewöhnt, weil er es ihm erlaubte, trotz seiner ungewöhnlichen Arbeitszeiten weitgehend am sozialen Leben teilzunehmen. Abends ging er wie seine Kameraden aus. Er trieb Sport, traf sich mit Freunden, blieb so lange auf wie diese, obwohl sie einige Stunden länger schlafen konnten als er. Die verpasste Nachtruhe holte er nachmittags nach, dann schlief er jeweils tief und fest.
Vorher wollte er allerdings zum Kaffee ins «Weisse Kreuz». Am Montag assen dort immer die gleichen paar Kollegen, er gesellte sich jeweils nach dem Essen dazu. Dass er nicht auch mit ihnen ass, lag weniger an Annettas zugegebenermassen beachtlichen Kochkünsten. Vielmehr war es so, dass sein Verzicht auf eine der wöchentlichen Mahlzeiten einen herben Verlust auf ihrer Aktivseite bedeutet hätte. Das konnte er ihr nicht antun, fand Beni.
Im «Weissen Kreuz» traf er am gewohnten Tisch die gewohnten Kameraden an, und die Serviererin brachte ihm ungefragt den gewohnten Espresso. Einer fehlte, weil er auf der Jagd war. Einer grübelte wie immer mit einem Zahnstocher die Reste aus dem Gebiss, während er die Zeitung las. Zwei begrüssten Beni herzlich.
«Was gibt’s Neues?», fragte er in die Runde und hoffte, nicht mit endlosen Berichten über Jagderfolge eingedeckt zu werden.
«Der eine liest Zeitung, der andere redet noch weniger als üblich, was soll es da Neues geben?», maulte einer der Kameraden.
«Tom mag nicht reden?» Beni wandte sich dem Kollegen zu. «Ist etwas passiert?»
«Nein, alles gut», antwortete Tom.
«Sorgen mit dem Lastwagen?»
«Nein, alles in Ordnung mit dem Lastwagen.» Als er sah, dass Beni weiter fragen wollte, nahm er die Antwort vorweg. «Auch mit dem Strassenzustand, mit dem Chef, mit der Ware.»
Beni grinste. «Sorgen mit deinen Hunden?»
«Nein, alles in Ordnung mit den Hunden.»
«Bringst du ihnen immer noch das Apportieren von Cervelats bei, die du nachher selbst isst?», fragte der andere Gast leicht befremdet.
«Das kann nur einer, und beigebracht habe ich es ihm schon lange. Wir müssen es nur immer wieder üben.»
«Folglich hast du einen ordentlichen Cervelatkonsum», stellte Beni fest. «An deiner Stelle hätte ich ihm das Herantragen von Entrecôtes beigebracht.»
«Oder er könnte dir Zigaretten holen im Dorf», schlug einer vor. «Du schickst ihn mit dem Geld in den Laden, und die Verkäuferin gibt ihm eine Stange mit für dich.»
«Geht nicht, er ist noch nicht achtzehn», antwortete Tom. «Ausserdem ist das zurzeit zu gefährlich. Während der Jagd lasse ich die Hunde nicht aus den Augen. Es kommt immer wieder vor, dass ein Depp einen Hund mit einem Reh verwechselt.»
Nicht zur Jagd abschweifen, dachte Beni und wollte die Gefahr abwenden, doch der Zeitungsleser kam ihm zuvor.
«Eher verwechselt man deine Hunde mit Wölfen, und diese sind geschützt», stellte er fest.
Noch viel schlimmer, dachte Beni, bloss nicht auf die Wölfe zu sprechen kommen. Dieses Reizthema konnte eine Tischrunde stundenlang beschäftigen. Er verkniff sich die Bemerkung, dass der Schutz manchen Wolfsgegner unter den Jägern kaum am Schiessen hindern würde, und leitete einen Themawechsel ein. «Aus dem Haus Rosales wurden wertvolle Bilder abtransportiert. Was tut sich dort?»
«Keine Ahnung.» Tom zuckte die Achseln.
«Ich glaube, der Künstler und seine Frau sind nicht hier.» Er wandte sich Tom zu. «Sie reitet doch manchmal zu dir hinauf.»
«Ich habe sie seit einer Woche nicht gesehen.» Tom zeichnete mit dem Löffel Muster auf den Tisch. «Oder sogar länger.»
«Sie werden verreist sein», warf der Zeitungsleser ein und legte das Blatt weg. «Geld haben sie eh zum Versauen, Zeit auch, und arbeiten müssen sie ja nicht. An ihrer Stelle könntest du deinen Hund auf Tausendernoten abrichten», wandte er sich an Tom.
«Es gibt Zeiten, da arbeitet er fast Tag und Nacht», widersprach Beni. «Ich glaube, wenn es ihn packt mit seinen Steinen, kommt er kaum mehr aus der Werkstatt.»
«Das nenne ich nicht Arbeit», meinte der Leser abschätzig. «Und sie tut sowieso nichts, ausser schön auszusehen und ihre Gäule spazieren zu führen.»
Tom fuhr auf. «Du nimmst den Mund ganz schön voll. Kennst du sie denn? Du hast bestimmt noch nie ein Wort mit ihr gesprochen!»
«Nein, natürlich nicht», gab er bereitwillig zu. «Ich habe sie noch nie an einem Stammtisch angetroffen. Oder im Dorfladen. Oder auf der Post. Oder an einem Dorfanlass. Ausländer halt.»
«So ein Blödsinn!» Tom schüttelte den Kopf. «Es gibt auch Schamser, die man kaum im Dorf antrifft.»
Beni beeilte sich, die Wogen zu glätten. «Sollen sie doch zurückgezogen leben in ihrem grossen Haus. Solange sie dabei niemandem auf den Geist gehen, ist das ihre Sache.»
Der Zeitungsleser nickte. «Solange sie brav ihre Steuern zahlen und keinen Ärger machen, können sie sich in ihrer alten Hütte den Arsch abfrieren, mir soll’s recht sein.»
Tom runzelte die Stirn und schwieg.
Am nächsten Tag gerieten Frederik und Ursin schier aus dem Häuschen, als Daria ihnen in der Pause diskret ein Daumenhoch-Zeichen machte. Direkt nach der Schule standen sie aufgeregt bei ihr vor der Tür. Sie bedeutete ihnen unwirsch, gefälligst ruhig zu sein, und führte sie in den Keller, wo sie das Paket untergebracht hatte.
«Alles da!», rief Frederik. «Ursin, jetzt geht es los!»
Ursin hüpfte vor Begeisterung auf und ab.
«Moment!», bremste die Kameradin die beiden Jungen. «Erstens: Her mit dem Geld!»
«Das müssen wir erst holen. Wir bringen es morgen mit in die Schule», beteuerte Ursin. Frederik nickte eifrig.
«Zweitens: Woher kommt das Geld!»
Augenblicklich hörten die Buben auf zu strahlen und zu hüpfen. Sie drucksten eine Weile herum, bis Frederik aufbegehrte. «Das spielt keine Rolle, und das geht dich nichts an!»
«Oh doch», widersprach sie. «Wenn ihr es geklaut habt, hänge ich mit drin.»
«Wir haben es doch nicht geklaut!», rief Ursin entsetzt. «Ehrlich. Du musst keine Angst haben.»
«Angst?» Sie lachte verächtlich. «Ich habe keine Angst. Aber ich will sicher sein. Also: Woher kommt das Geld?»
«Wir haben es geschenkt bekommen.» Frederik nickte feierlich, um seine Aussage zu bekräftigen.
«Für wie blöd hältst du mich?» Daria schaute ihn streng an. «Wenn ihr es geschenkt bekommen hättet, würdet ihr mich nicht brauchen, um das Zeug zu kaufen.» Sie tippte ihm auf die Brust und wurde lauter: «Woher kommt das Geld?»
«Das sagen wir dir nicht.» Frederik verschränkte die Arme. «Nein, das sagen wir dir nicht.»
Wortlos packte sie das Paket und ging damit zur Tür.
«Moment», rief Ursin, «warte!»
Sie blieb mit dem Rücken zu ihnen stehen, die Türfalle in der Hand.
«Wir haben das Geld gefunden», erklärte Ursin.
«Gefunden», wiederholte sie ärgerlich und verdrehte die Augen.
«Es stimmt, wirklich», bekräftigte Frederik. «Es gehört niemandem. Es ist nicht geklaut.»
Nach und nach erzählten sie ihr von dem Rucksack, den sie aus dem Rhein gezogen hatten.
Stöhnend liess sich Daria auf einen Harass sinken. «Ihr steckt noch schlimmer im Schlamassel, als ich gedacht hätte.»
Frederik schaute sie verständnislos an. «Warum?», fragte er. «Ist doch kein Problem!»
«Überleg doch mal», wies sie ihn an. «Was war am Sonntag los?»
«Am Sonntag?» Die Buben schauten sich an. Bezüglich Wochentage und Zeitgefühl hatten sie beide noch Luft nach oben, wie sich Frederiks Vater auszudrücken pflegte.
«Am Sonntag!» rief Daria. «Was war am Sonntag los? Bei der Brücke? Was hat man beim Granitwerk aus dem Rhein gefischt?»
«Eine tote Frau», antwortete Ursin verdattert.
«Bravo», lobte sie ironisch. «Und was habt ihr beide ein paar Tage vorher aus dem Rhein gefischt?»
«Den Rucksack», sagte Ursin brav.
«Bravo», wiederholte sie. «Und wem gehört wohl dieser Rucksack?»
«Der toten Frau.»
«Bravo, ihr cucaloris!» Vom bemüht geduldigen Tonfall war nichts mehr übrig. «Er gehört der toten Frau, von der man immer noch nicht weiss, wer sie ist. Weil sie nichts bei sich hatte, keinen Ausweis, kein Geld, nichts. Und warum hat man nichts davon bei ihr gefunden? Weil ihr zwei die Sachen genommen habt!»
Ursin schluckte.
Frederik biss sich auf die Lippe.
Die Kameradin trommelte mit den Fingern auf das Paket.
«Wir werden ihn abgeben müssen», meinte Frederik leise.
«Wir werden das Paket zurückschicken müssen.» Ursin liess nicht erkennen, was für ihn schlimmer war.
«Wirklich?», fragte Daria kritisch.
Die Buben schauten sie fragend an.
«Das Porto ist teuer, und meine Provision schuldet ihr mir sowieso.»
«Deine Provision?», fragte Ursin entgeistert. «Aber wir können die Ausrüstung ja nicht behalten!»
«Aber ihr habt sie über mich bestellt und auch bekommen. Also müsst ihr mich bezahlen. Ist doch klar.»
«Aber wenn wir den Rucksack zurückgeben müssen, haben wir doch kein Geld!», rief Ursin verzweifelt.
Sie verdrehte die Augen. «Giavel, seid ihr schwer von Begriff. Weiss jemand, wie viel Geld im Portemonnaie war? Nein. Also nehmt ihr so viel heraus, wie ihr mir schuldet.»
Ursin schluckte wieder.
Frederik biss sich immer noch auf die Lippe. «Du hast recht», sagte er schliesslich. «Niemand weiss, wie viel Geld drin war. Also können wir genauso gut mehr herausnehmen, als wir dir schulden. Nämlich so viel, wie die Goldwaschrinne und die Waschpfanne kosten.» Triumphierend schaute er in die Runde.
«Aber …» Ursin musste nochmals Anlauf nehmen. «Aber das geht doch nicht!»
«Warum nicht?», fragte Daria. «Frederik hat recht.»
«Das geht doch nicht!», wiederholte Ursin. «Was sagen wir den Eltern, woher wir das Geld haben für die Goldwaschausrüstung?»
«Das haben wir doch besprochen», antwortete Frederik. «Jeder von uns sagt, der andere habe es geschenkt bekommen.»
Sie nickte. «Jetzt braucht ihr nur noch einen guten Grund, weshalb ihr den Rucksack erst jetzt herausrückt.»
«Müssen wir ihn wirklich herausrücken?», fragte Frederik. «Wir können ihn ja einfach von der Brücke in den Rhein werfen. So, als ob wir ihn nie gehabt hätten.»
«Das geht nicht», widersprach Daria. «Die Bullen haben das ganze Flussbett abgesucht, sie hätten ihn gefunden.»
«Wir können nur das Portemonnaie ins Flussbett legen, weiter unten im Rhein, wo sie nicht mehr so gut gesucht haben. So, dass sie es übersehen haben könnten.» Frederik begeisterte sich für seine Idee.
«Das geht auch nicht», erwiderte sie. «Stell dir vor, die Strömung nimmt das Portemonnaie mit. So klein wie es ist, wird es nie mehr gefunden.»
«Wir könnten es bei der Gemeinde in den Briefkasten werfen», schlug Ursin vor.
«Spinnst du?», fragte Frederik. «Wenn uns jemand sieht? Wenn man unsere Fingerabdrücke darauf findet?»
«Na, nun übertreib nicht», bremste ihn Daria. «Das Problem ist verzwickt, aber es gibt sicher eine Lösung.»
Die Buben zogen einen zweiten Harass heran und setzten sich darauf. Zu dritt heckten sie einen Plan aus, wie sie weiter vorgehen wollten.