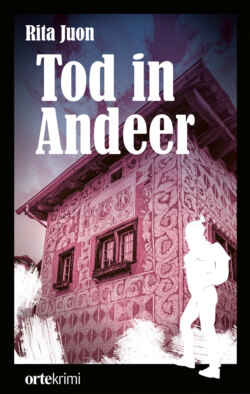Читать книгу Tod in Andeer - Juon Rita - Страница 5
1 September 2019
ОглавлениеDie beiden Buben schrien sich schon den ganzen Nachmittag an. Nicht etwa, weil sie im Streit lagen. Auch nicht, weil keiner dem anderen zuhören wollte. Erst recht nicht, weil ihre Ohren wieder einmal geputzt werden sollten. Sie mussten schreien, um das Rauschen des Hinterrheins zu übertönen.
«Wieder nichts», rief der eine. «Ob wir wohl überhaupt jemals Gold finden?»
«Das muss man üben!», brüllte der andere. «Parker Schnabel hatte auch nicht auf Anhieb Erfolg.»
«Wer?»
«Parker Schnabel! Der Goldsucher aus Alaska, der im Fernseher kommt. Papa und ich schauen uns die Sendung immer an.»
Ursin schaufelte erneut Sand und Kies aus dem Fluss in das Kunststoffbecken. «Ein richtiges Goldwaschbecken wäre zehnmal praktischer als diese Teigschüssel meiner Mutter», maulte er.
«In einem Monat habe ich Geburtstag, dann wünsche ich mir eines.» Frederik rüttelte an der selbst gebauten Goldwaschrinne, um sie besser zu platzieren. «Für eine richtige Goldwaschrinne wird es nicht reichen, aber diese hier ist gar nicht schlecht.»
«Und wenn es im Hinterrhein gar kein Gold gibt?», wandte Ursin ein.
«Gibt es!», beharrte sein Freund. «Ich habe es selbst gehört, als zwei Männer darüber redeten. Ich erzählte meinem Papa davon, und der hat im Internet nachgeschaut. Es gibt Gold im Hinterrhein.»
«Da!», brüllte Ursin aufgeregt, während er die Teigschüssel im Kreis drehte. «Schau hier, am Rand, das, was so glitzert!»
So schnell er mit den hohen Gummistiefeln konnte, eilte Frederik zu ihm. Andächtig betrachteten sie das winzige glitzernde Teilchen im Sand auf dem Boden der Schüssel. Fast gleichzeitig liessen sie ein enttäuschtes Brummen vernehmen.
«Glimmer», stellte Ursin fest. «Wieder nur Glimmer.»
Frederiks Gesicht hellte sich auf. «Aber wir werden immer besser», meinte er. «Letztes Mal haben wir überhaupt nichts gefunden und heute schon zum zweiten Mal Glimmer!»
Ursin leerte die Schüssel aus und klemmte sie sich zwischen die Knie, um sich die klammen Finger warm zu reiben. Als er den Reissverschluss seiner Jacke bis zum Kinn hochzog, blieb sein Blick an einem dunklen Fleck flussaufwärts haften. «Schau, dort liegt etwas im Wasser», sagte er. «Was kann das sein?»
Trotz der unförmigen Stiefel bewegten sich die Buben gewandt über Kies und Steine am Ufer flussaufwärts.
«Ein Rucksack!», rief Ursin. «Hilf mir», wies er seinen Freund an und begann, Trittsteine zwischen dem Ufer und dem Fundstück ins Flussbett zu werfen. Frederik schleppte einen angeschwemmten Holzprügel heran, an dem sich Ursin festhalten konnte, als er sich zum Fundstück hinüberhangelte. Seine Jacke wurde nass bis zu den Ellbogen, als er die Hände ins eiskalte Wasser tauchen musste, um den Rucksack, der sich im Geschiebe verfangen hatte, zu lösen. Endlich erreichte er mit ein paar Sätzen das Ufer, wo er zitternd vor Kälte auf einen Stein sank.
Frederik nahm ihm die Beute aus der Hand. «Vielleicht ist ein Ausweis drin, dann können wir ihn zurückgeben.» Er schickte sich an, die Schnalle zu lösen. «Ein richtiger Rucksack ist das nicht, er sieht eher aus wie eine grosse Damenhandtasche.»
Tatsächlich enthielt der Beutel die üblichen Utensilien, die Damen nach den Kenntnissen der Buben mit sich führten: Taschentücher, ein Brillenetui, Kaugummi, Lippenstift, ein Röhrchen mit Kopfwehtabletten, die Reste einer Illustrierten, ein kleines Portemonnaie und einen durchnässten Briefumschlag aus Karton.
Frederik griff nach dem Portemonnaie. «Kein Ausweis», berichtete er, als er es untersucht hatte, «und auf dem Couvert steht keine Adresse.» Er drehte es in der Hand. «Es ist verschlossen. Der Inhalt wird wohl völlig aufgeweicht sein.»
«Wie finden wir denn heraus, wem der Rucksack gehört?», fragte Ursin.
Der Freund dachte nach. Erneut untersuchte er das Portemonnaie und entdeckte ein Notenfach mit Reissverschluss, den er jetzt öffnete. «Keine Adresse», stellte er fest, «aber hundertfünfzig Franken.»
Ursin blickte sehnsüchtig auf die Noten. «So viel wie eine Goldwaschrinne und eine Waschpfanne kosten.»
«Stimmt.» Frederik blickte ihn aufmerksam an. «Wir wissen nicht, wem der Rucksack gehört. Darum können wir ihn auch nicht zurückgeben. Also dürfen wir ihn behalten.»
«Bist du verrückt?», fragte Ursin entsetzt. «Er gehört uns doch nicht. Wir müssen ihn abgeben.»
«Wo denn?»
«Das weiss ich nicht. Vielleicht auf dem Fundbüro?»
«So etwas gibt es hier nicht», gab Frederik zurück.
«Dann müssen wir ihn auf der Gemeinde abgeben», sagte Ursin.
«Auf welcher denn?» Frederik wurde ungeduldig. «Andeer? Bestimmt nicht, wir haben ihn ja vor dem Dorf aus dem Rhein gefischt. Er muss von irgendwo oberhalb kommen. Aber wir können doch nicht bis nach Splügen gehen, nur um ihn dort abzugeben!»
Ursin schüttelte den Kopf. «Von dort kann er nicht kommen, er muss nah beim Dorf ins Wasser gefallen sein, unterhalb der Staumauer von Bärenburg.»
«Jetzt sei nicht so ein Besserwisser», raunzte Frederik. «Hat der Stausee etwa keinen Abfluss? Klar hat er! Also kann der Rucksack auch von weiter oben kommen.» Er runzelte die Stirn und überlegte. «Wenn er aber aus dem Rheinwald kommt und schon einen oder sogar zwei Staudämme hinter sich hat, ist er schon länger unterwegs. Dann hat es die Besitzerin längst aufgegeben, ihn zu suchen. Ausser diesen hundertfünfzig Franken ist ja auch nichts Besonderes drin.»
«Was meinst du damit?»
«Ich meine, dass niemand den Rucksack vermisst. Wir brauchen ihn nirgends abzugeben.»
Ursin war empört. «Aber das Geld!»
«So viel ist es nicht. Wenn Mama in Thusis einkaufen geht, braucht sie mehr als das.»
«Schon, ja, aber die Frau, der der Rucksack gehört, wollte doch etwas kaufen damit!»
«Dann hätte sie besser aufpassen müssen», sagte Frederik ungehalten. «Wahrscheinlich war es sowieso eine Touristin, somit ist sie unmöglich zu finden. Vermutlich ist sie längst wieder abgereist.»
«Möglich. Ich kenne jedenfalls niemanden im Dorf mit einem solchen Rucksack.» Ursin betrachtete das Gepäckstück nachdenklich.
«Du hast gesagt, es würde reichen für eine Goldwaschrinne und eine Waschpfanne.»
«Ja.» Abwesend liess Ursin den Blick zur Teigschüssel schweifen. «Es würde genau reichen …»
Eine Zeit lang hing jeder seinen Gedanken nach, die sich unweigerlich in die gleiche Richtung bewegten.
«Sind wir uns einig, dass wir die Besitzerin des Rucksacks niemals finden werden?», fragte Frederik schliesslich.
«Ja.»
«Wozu sollen wir ihn also irgendwo abgeben?»
«Weil …»
«Wenn er niemandem gehört, können wir ihn genauso gut behalten.»
«Aber …»
«Aber, aber, aber!» Frederik rang die Hände. «Mach nicht so ein Theater! Für die Besitzerin ist der Rucksack verloren. Wer soll ihn dann am ehesten bekommen? Die Gemeinde?» Er schüttelte den Kopf. «Sicher nicht! Die auf der Kanzlei wissen doch nichts damit anzufangen, und Geld hat die Gemeinde genug.»
«Schon, aber …»
«Aber wir können uns damit eine Goldwaschrinne und eine Waschpfanne kaufen!»
Nach einigen Minuten war Ursin endlich von der Idee überzeugt, das Fundstück zu behalten. Dass sowohl seine als auch Frederiks Eltern das anders sehen würden, war allerdings beiden klar. Deshalb durften sie nichts davon erfahren, was bedeutete, dass sie jemand anderen brauchten, der ihnen beim Einkauf im Internet half und das grosse Paket zu sich nach Hause liefern lassen konnte. Ein Mittelsmann musste her, oder in ihrem Fall ein Mittelsmädchen. Ein solches kannten sie nämlich im Dorf; es war einige Jahre älter und gewitzt genug, um ihr Vorhaben zu unterstützen.
Sie besiegelten ihren Plan mit einem feierlichen Schwur und machten sich auf den Weg nach Hause, wo sie den Rucksack auf einer Ablage unter dem Dach im Stall von Ursins Familie verstecken wollten.
Am folgenden Morgen drehte sich Massimiliano träge im Bett um. Das Tageslicht drang durch seine geschlossenen Lider. Er lauschte auf die Atemzüge seiner Partnerin, hörte aber nichts. Offenbar war Marlene bereits aufgestanden, um nach den Pferden zu sehen. Er streckte sich ausgiebig, bevor er endlich die Augen öffnete. Halb neun Uhr und kein Sonnenschein. Das waren zwei gute Gründe, an diesem Donnerstag noch eine Weile liegen zu bleiben. Er griff nach dem dicken Buch auf seinem Nachttisch und vertiefte sich in die Schilderung des ausschweifenden Lebenswandels von Amedeo Modigliani.
Eine Stunde später stieg er aus dem Bett und in eine ausgeleierte Trainingshose und einen dicken Pullover. Das stattliche Haus der Familie Rosales war zwar ein Schmuckstück und ein historisch faszinierendes Gebäude, aber die dicken Mauern und die Steinböden liessen sich kaum wärmen. Mochte die Kühle während ein paar Wochen im Sommer angenehm sein, sorgte sie während zehn Monaten im Jahr für permanentes Frösteln und immense Heizkostenrechnungen. Er zog dicke Socken über und machte sich auf den Weg ins Esszimmer.
Der Tisch war zum Frühstück gedeckt, beide Teller waren unberührt. Bevor er sich Gedanken über den Verbleib seiner Partnerin machen konnte, trat Blanka aus der Küche und begrüsste ihn wie üblich ohne den Anflug eines Lächelns.
«Wartest du auf deine Frau oder wünschst du zu essen?», fragte sie.
Massimiliano hatte es längst aufgegeben, ihr zu erklären, dass Marlene und er nicht verheiratet waren. Blanka nannte sie konsequent seine Frau, und eigentlich, hatte er irgendwann eingesehen, stimmte das abgesehen vom Zivilstand auch.
«Marlene ist längst aufgestanden», erklärte er. «Hat sie nichts gegessen?»
«Nein», antwortete Blanka, ohne ihn darauf aufmerksam zu machen, dass die Frage nicht besonders gescheit war.
«Wo ist sie denn?», wollte Massimiliano wissen.
«Ich habe sie heute Morgen noch nicht gesehen», antwortete Blanka.
Er runzelte die Stirn und warf einen Blick aus dem Fenster. Es hatte zu nieseln begonnen. Keine zehn Pferde würden ihn bei diesem Wetter aus dem Haus bringen, aber Marlene scherte sich nicht darum. Für sie reichten zwei Pferde. Für ihre Haflinger würde sie barfuss durchs Feuer gehen, während die beiden für ihn bloss ein Pärchen hellbrauner Huftiere waren. Er seufzte und machte sich auf den Weg nach draussen, um Marlenes Frühstückswünsche zu erfragen.
Daraus wurde nichts. Vier Pferdeaugen beobachteten ihn sanftmütig, während er Stallungen und Weide erfolglos nach seiner Partnerin absuchte. Zurück im Haus schälte er sich aus der Regenjacke und kehrte in die Küche zurück, wo er sein Mobiltelefon einschaltete. Keine neuen Nachrichten. Er schickte Marlene einen Guten-Morgen-Gruss und setzte sich an den Tisch, wo Blanka sogleich mit einer dampfenden Tasse Kaffee aufwartete.
Bis er in aller Ruhe sein Frühstück fertig gegessen hatte, war keine Antwort eingetroffen. Er wählte Marlenes Nummer, doch ihr Smartphone war ausgeschaltet. Stirnrunzelnd hob er den Kopf. Sein Blick kreuzte sich mit Blankas; in ihren Augen las er dieselbe Besorgnis.
«Sie wird wohl joggen gegangen sein», versuchte er, sich und Blanka zu beruhigen.
«Ihre Joggingschuhe stehen beim Eingang», erwiderte Blanka.
«Vielleicht ist sie nach Thusis oder Chur gefahren.»
Blanka schüttelte den Kopf. «Beide Autos stehen in der Garage.»
Mit aller Kraft versuchte er, sich daran festzuhalten, dass alles in Ordnung war. Marlene war nur kurz weg. Jeden Moment würde sie über die Schwelle treten und ihn auslachen, weil er sich Sorgen gemacht hatte.
Als ein Klingelton den Eingang einer neuen Meldung anzeigte, griff er aufgeregt nach dem Gerät. «Die von Ihnen bestellten Werkzeuge sind eingetroffen und in unserem Geschäft zum Abholen bereit», las er. Die banale Mitteilung des Händlers liess die Schutzmauern einstürzen. «Mein Gott, Blanka, was ist passiert? Wo kann sie sein? Wir müssen sie suchen! Aber wo?» Er raufte sich die Haare.
«Wir könnten zuerst nachschauen, welche Jacke und welche Schuhe fehlen. Dann wissen wir vielleicht mehr», riet Blanka.
«Ja, ja, ja, mach das!»
Da er nicht untätig abwarten konnte, eilte Massimiliano selbst die Treppe hinauf, zwei Stufen auf einmal nehmend. In Marlenes Ankleidezimmer sah er sich ratlos um. Wie sollte er wissen, was in der Unmenge von Kleidern, Foulards und Taschen fehlte? Er ging weiter zum angrenzenden Arbeitszimmer. Marlene hatte es fast nie benutzt, der imposante antike Schreibtisch war aufgeräumt wie immer.
Als er Blankas Schritte auf der Treppe hörte, trat er hinaus auf den Flur, aber die Haushälterin wich seinem Blick aus. Sie betrat Marlenes Ankleidezimmer und durchsuchte systematisch die Regale und Kleiderstangen. Als sie damit durch war, blieb sie reglos stehen. Endlich gab sie sich einen Ruck und wandte sich zu ihm um.
«Es fehlen ihre Bergschuhe und ihre leichten Freizeitschuhe. Die Regenjacke, eine Wolljacke und ein Blazer. Zwei Paar Jeans, eine schwarze Hose, eine Bluse, einige T-Shirts, drei Pullover.»
Massimiliano rannte an ihr vorbei die Treppe hinunter und stürzte hinaus ins Freie. «Marlene!», schrie er. «Marlene!» Wie von Sinnen lief er durch den weitläufigen Garten. «Marlene!» Verzweifelt rüttelte er am Gitter, das sein Anwesen vom Gelände trennte, wo der Andeerer Granit aus dem nahe gelegenen Steinbruch verarbeitet wurde. «Marlene!»
Kraftlos sank er am Zaun nieder. Wie ein zauberhaftes Wesen von einem anderen Stern war Marlene vor fünfzehn Jahren in sein Leben getreten. Überirdisch schön. Ein Engel, der seinem Leben Sinn gab. Sie hatte ihn bei der Hand genommen und aus dem Trübsinn hinausgeführt ans Licht. Sie hatte ihn ermutigt, sich dem Druck seiner Familie zu widersetzen und seinen eigenen Weg zu gehen. Seinem standesgemässen Leben den Rücken zu kehren und seine Träume zu verwirklichen. Sie hatte ihn dabei unterstützt, seine Skulpturen der Öffentlichkeit zu zeigen. Ihr verdankte er den Mut, unter sein bisheriges Leben einen Schlussstrich zu ziehen und sich fortan mit Leib und Seele der Kunst zu widmen. Zusammen hatten sie das Anwesen neben dem Steinbruch in Andeer entdeckt, als sie auf den Spuren des grünen Andeerer Granits, der eigentlich ein Gneis war, durch die Täler gereist waren. Gemeinsam hatten sie sich in das geschichtsträchtige Haus Rosales verliebt, das zur Tarnung als Wohnhaus rund um einen Blashochofen zur Eisengewinnung errichtet worden war. Es war ihre Insel geworden, ihr Paradies, die Erfüllung ihrer sehnlichsten Wünsche. Zusammen mit ihrer Haushälterin, ihrem Stallknecht, Marlenes Pferden und Massimilianos Steinblöcken lebten sie in ihrer eigenen Welt ohne nennenswerten Kontakt zur Umgebung.
Fragen nach ihrer Herkunft liess Marlene nicht zu. Wie die Fee im Märchen hatte sie ihm gleich zu Beginn ihrer Beziehung die Spielregeln klargemacht: Keine Fragen zur Vergangenheit. «Vielleicht bin ich als Elfe aus einer Rose geschlüpft? Ich lebte dreihundert Jahre lang, bevor ich dich sah. Dann war ich verloren. Ich wurde ein Mensch, um dich lieben zu können.» Keine Fragen, woher ihr Vermögen stammte. «Vielleicht war ich Meerjungfrau im Pazifik? Ein reicher Mann verzweifelte, weil ich ihn nicht lieben konnte. Er stürzte sich mit seinem ganzen Vermögen ins Meer. Dadurch wurde der Fluch gebannt, ich wurde erlöst und stieg an Land. Ich erblickte dich und entdeckte den Sinn meines Lebens.» Keine Fragen zu ihrer Familie. «Vielleicht lebte ich auf der Strasse und verzauberte als junges Mädchen einen Prinzen aus Saudi-Arabien? Er nahm mich in seinen Harem auf und schmückte mich mit Gold und Edelsteinen. Als er alt war, schenkte er mir die Freiheit und gab mir die Aufgabe, den besten Mann, der neben ihm auf der Erde wandelt, glücklich zu machen. Das ist mir gelungen.»
Marlene war nicht von dieser Welt. Immer hatte er die leise Furcht verspürt, sie könnte so plötzlich verschwinden, wie sie vor fünfzehn Jahren aufgetaucht war. Er wurde überwältigt von der Angst, Marlene sei als zauberhafter Vogel weitergezogen in ein neues Dasein.
Erst als ihm Wasser aus den Haaren über die Stirn lief, bemerkte er, dass der Regen zugenommen hatte und er bis auf die Haut durchnässt am Boden sass. Mühselig rappelte er sich auf und schleppte sich ins Haus zurück. Blanka empfing ihn mit ernstem Blick. In der einen Hand hielt sie ein Frottiertuch für ihn bereit, in der anderen einen grossen lilafarbenen Umschlag. In Marlenes schwungvoller Handschrift stand sein Name darauf.