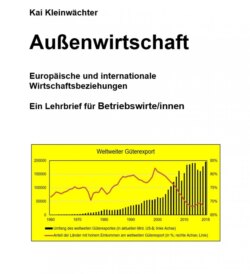Читать книгу Außenwirtschaft Europäische und internationale Wirtschaftsbeziehungen - Kai Kleinwächter - Страница 11
2 Globalisierung und internationale Organisationen 2.1 Begriffsbestimmung – Globalisierung / Liberalisierung
ОглавлениеGlobalisierung
Dieser Begriff beschreibt die internationale Verflechtung von Gesellschaften. Das betrifft alle gesellschaftlichen Bereiche - Kultur, Wirtschaft, Politik, soziale Strukturen, Sicherheit… Es bedeutet die zumindest teilweise Schwächung nationaler Strukturen und stellt partiell die Regulierungskraft der Staaten in Frage.
Liberalisierung
Die Liberalisierung ist eine ökonomische Erscheinungsform der Globalisierung. Der Begriff bedeutet den Abbau von „Hindernissen für die Entfaltung des freien Marktes“. Im Außenhandel fallen darunter vor allem der Abbau von sogenannten Handelshemmnissen. Ziel ist die Förderung der Wirtschaft bzw. des Handels durch partielle Zurücknahme des Staates bzw. anderer Wirtschaftsstrukturen (beispielsweise feudale Strukturen)
Die Ursachen der Globalisierung sind vielfältig und haben starke Wechselwirkungen.
A) Politik
B) Ökonomie
C) Technik / Infrastruktur
D) Mobilität von Personen
A) Politik
Die in den hochentwickelten Industriestaaten dominanten politischen Strömungen traten seit den 1950er Jahren für eine (gesteuerte) Globalisierung ein. Die Staaten betreiben dabei eine Internationalisierung ihrer politischen Strukturen – sei es in der Wirtschaftssphäre (IMF, Weltbank, OECD…), in der Außen- und Sicherheitspolitik (NATO, OSZE, ICAN…), im Gesundheitswesen (WHO…) oder im Infrastrukturbereich (SWIFT, ICANN…). Ziele sind vor allem eine Stimulierung von Wirtschaftswachstum und Wohlstand sowie die friedlichere Gestaltung der Außenpolitik.
Mit dieser politischen Globalisierung einher, geht der forcierte Aufbau internationaler Infrastrukturen (Flugwesen, Hafenanlagen, Autobahnen, Strom- und Energiesysteme, Eisenbahnen…) sowie die Durchsetzung anerkannter Regeln.
Auch die sozialistischen Systeme bekannten sich zu einem globalisierten System. Allerdings sollte dieses unter umfassender Kontrolle der Staaten bleiben. Nicht-staatlichen Akteuren wie Wirtschaftsunternehmen wurde eine weniger selbstständige Rolle zugedacht, als in den kapitalistischen Ordnungsvorstellungen.
B) Ökonomie
Durch die Verzahnung regionalen Märkte bildete sich für viele Güter ein Weltmarkt heraus - insbesondere im Industrie-, Finanz- und Rohstoffsektor. Angebot und Nachfrage wird weniger durch die lokalen Bedingungen bestimmt, sondern durch die Marktprozesse auf globaler Ebene. Die Wirtschaftsakteure stellen sich darauf ein und treiben ihrerseits die Internationalisierung der Märkte und die globale Spezialisierung voran (vgl. transnationale Konzerne).
C) Technik / Infrastruktur
In Folge neuer Techniken sanken in den letzten 200 Jahren die Kosten für Kommunikation und Transport auf einen Bruchteil des ursprünglichen Niveaus. Große Durchbrüche waren v.a.: Schifffahrt (Große Segelschiffe, Dampfschiff, Eisen-/Stahlschiffe, Schiffe mit Dieselmotor), Eisenbahn (Dampf-, Diesel- und E-Log), Flugzeuge, Telekommunikation (Modernes Postwesen, Telegrafen, Telefon, Radio, Fernsehen, Internet). Diese Techniken ermöglichten einen deutlich kostengünstigeren und schnelleren Transport von Waren bei höherer Qualität und Quantität sowie die Kommunikation über globale Entfernungen.
Die Technikentwicklung steht in Wechselwirkung mit der Politik und der Ökonomie. Deren Anforderungen treiben ihre Dynamik voran. Gleichzeitig erhöht die Durchsetzung eines Technikniveaus die Anforderungen in den Sektoren. Es entstand ein sich selbst verstärkender Kreislauf, der zu einer dynamischen Epoche der Menschheit führte.
Die meisten Techniken basieren auf sogenannten Netzinfrastrukturen (Häfen, Eisenbahn, Autobahnen, Stromnetze…). Diese entstanden in den hochentwickelten Staaten durch umfassende staatliche Investitionen.
D) Mobilität von Personen
In Folge sinkender Transportkosten und Abschwächungen der Grenzregime stieg die Mobilität der Bevölkerung deutlich. Das zeigt sich sowohl in vielfältigen Migrations-Formen (vom Auslandsstudenten, Gastarbeitern über Projektmanager/innen bis zu Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlingen) als auch im Aufstieg der Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Letzteres ist inzwischen einer der bedeutendsten Wirtschaftssektoren. Die entsprechenden staatlichen Förderungen stimulieren seine weitere Zunahme. Dafür nehmen Regierungen auch Veränderungen ihrer nationalen Kultur in Kauf.
Beispiel: Japan und der Tourismus (Lill 2018)
Selbst das verschlossene Japan erwartet inzwischen mehr als 40 Mio. ausländische Gäste pro Jahr. Es beginnt zumindest eine partielle kulturelle und sprachliche Öffnung. In den großen Kultur-Magneten erfolgt eine Ausschilderung in mehreren Sprachen und das Servicepersonal beherrscht zunehmend Englisch. Auch stellt sich die Bevölkerung in den angesagten Hot-Spots auf die Touristen ein.
Ökonomische Herausforderungen der Globalisierung
A) Differenzierung der Lohneinkommen
B) Auseinanderentwicklung der Arbeits- und Kapitaleinkommen
A) Differenzierung der Lohneinkommen
Die internationale Konkurrenz auf den Arbeitsmärkten wirkt unterschiedlich auf einzelnen Berufsfelder und Qualifikationen. Tendenziell sind niedrige Qualifikationen und (Massen-)Berufe einer höheren Konkurrenz durch Einwanderer bzw. der Bedrohung durch Arbeitsplatzverlagerungen ausgesetzt. In Folge stagnieren bzw. sinken hier eher die Löhne. Die politische Schwächung der Gewerkschaften in den letzten Jahrzehnten verstärkt diese Entwicklung. Gleichzeitig können Spezialisten (bei internationaler Mobilität) von der global wachsenden Nachfrage profitieren. Ihre Gehälter steigen tendenziell.
Auf den globalisierten Arbeitsmärkten verschärft sich die Konkurrenz unter den Arbeiter- und Angestellten deutlich. Prof. Nils Ole Oermann fasst es prägnant zusammen: „Der hochpreisige Verkauf von Arbeitskraft wird angesichts der größer werdenden internationalen Konkurrenz immer schwieriger. [In Folge] klafft in vielen Ländern die Lohnschere derart auseinander, dass […] der Begriff ´unfair´ oftmals tatsächlich angemessen erscheint.“ (Schnaas und Schwarz 2018)
Unterläuft die Arbeitsmigration darüber hinaus gesetzliche Standards wie Mindestlöhne oder Versicherungszwang, verschärft sich die soziale Spaltung deutlich. Vor allem in Dienstleistungsberufen mit Projektcharakter (Bauwirtschaft, Fernfahrer, Saisonarbeitskräfte…) erleichtern die instabilen Arbeitsverhältnisse die Umgehung der Gesetze. Bevor Kontrollen greifen, befinden sich Arbeiter und Firmen im Ausland. Da die Migranten oft nur vorübergehend in Deutschland bleiben, liegen ihre Kosten für die Lebenshaltung unter dem deutschen Niveau. Bei dauerhaften Aufenthalt wäre das niedrige Lohnniveaus nicht durchhaltbar.
Beispiel: Mindestlohn in Deutschland (Kirchgeßner 2018)
Ab Grenzübertritt gilt für ausländische Fernfahrer der deutsche Mindestlohn. (2018 8,84 € pro Stunde) In Tschechien hingegen liegt er bei ca. 73 Kronen, umgerechnet etwa drei Euro. Bei diesen Unterschieden zahlt kaum ein Spediteur das deutsche Niveau. Da die Abrechnung der Gehälter im Herkunftsland erfolgt, finden kaum Kontrollen statt. Die Fahrer müssen selbst ihre Gehälter einklagen. Im Mai 2018 einigte sich erstmal ein tschechischer Fernfahrer vor dem Bonner Arbeitsgericht mit seiner Spedition auf eine Lohnnachzahlung von 10.000 €. Weitere Klagen laufen. Allerdings weist der Vorsitzender des tschechischen Bündnisses der Transport Gewerkschaften (KDOS): „Wenn die tschechischen Spediteure den deutschen Mindestlohn zahlen, versuchen Bulgaren und Rumänen in die Lücke vorzustoßen.“
Befinden sich in der Volkswirtschaft größere Kontingente an Menschen ohne gesetzlichen Aufenthaltsstatus, spitzt sich die Situation noch weiter zu. Sie sind sowohl von den Sozialsystemen als auch den Arbeitsgerichten ausgeschlossen. Würden sie fehlende Löhne einklagen, droht ihnen die Abschiebung. In Folge sind sie gezielter Ausbeutung bis ins Existenzminimum ausgeliefert.
Beispiel: Arbeitsmarkt USA
In den USA halten sich nach Schätzungen über 11 Mio. Illegale auf – die meisten in den südlichen US-Bundesstaaten entlang der mexikanischen Grenze. (Rötzer 2018a) Gleichzeitig kommen immer weitere Arbeitskräfte aus Latein- und Südamerika nach. Isolierte Versuche der Bundesstaaten des Südens, die Mindestlöhne anzuheben, Krankenversicherungen ausdehnen o.ä. führen in den einfachen Berufsgruppen zu einer erhöhten Arbeitslosigkeit von US-Amerikanern. Sie werden ersetzt durch illegale Ausländer. Parallel zu den sozialen Verbesserungen müsste die Anzahl der Illegalen reduziert werden - sei es durch Legalisierung, sei es durch Ausweisung und durch Kappung weiterer Einwanderung. Die konservativen Strömungen haben das wahrscheinlich besser erkannt, als die meisten „linken“ Kritiker.
Diese Entwicklung vollzieht auch in den südlichen Randgebieten Europas. So bilden sich Italien fast schon kleine Städte von illegalen Migranten. Diese sind hauptsächlich in der Landwirtschaft beschäftigt. Die Zustände sind katastrophal - die Ausbeutung enorm. (Horn und Tomasone 2018)
„Zusätzlich hat das Wachstum der Informationswirtschaft die Gewinne aus herausragenden Geistesfähigkeiten vergrößert. Diese neue Elite der Hochgebildeten neigt dazu, […] sich auch sozial zusammenzufinden. Ihre Mitglieder heiraten untereinander und ihre Nachkommen haben enorme Bildungsvorteile. Als Folge nimmt die soziale Mobilität ab.“ (Collier 2014, S. 91) Ebenfalls untergrub bzw. untergräbt die Masseneinwanderung (armer) Migranten das Mitgefühl der reichen einheimischen Oberschicht arme Menschen. In Folge setzt sich die ökonomischen Eliten weniger bzw. sogar gegen soziale Umverteilung ein. (Collier 2014, 91ff)
B) Auseinanderentwicklung Arbeits- und Kapitaleinkommen
Im Rahmen der heutigen Globalisierung entwickeln sich Lohn- und Kapitaleinkommen zunehmen auseinander. Das Kapitaleinkommen steigt schneller als die Lohneinkommen. Partiell - insbesondere bei den schwach Qualifizierten in den hochentwickelten Industriestaaten - sinken die Löhne sogar. Ausdruck dessen ist die zunehmend ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen. (Rötzer 2018b)
Es liegen hierfür mehrere Ursachen vor. Diese sind unter anderem:
- Finanzmittel lassen sich international investieren und ermöglichen so eine umfassende Risiko-/Chancenstreuung. Investoren können von Wachstumschancen mehr profitieren als auch regionalen Krisen bzw. Konjunktureinbrüchen besser ausweichen als (schlecht qualifizierte) Lohnabhängige. Letztere können sich nur unter hohen Kosten aus dem Wirtschaftsraum wegbewegen. Dadurch lassen sich langfristig sich Renditen erreichen, die deutlich über dem Anstieg der nationalen Lohnentwicklung liegen.
Prof. Brooke Harrington: Eine der wichtigsten Lektionen, die man während der Ausbildung zur Vermögensverwalterin lernt, ist die Welt als eine Art rechtlich-finanzielles Einkaufszentrum zu sehen. Man geht zu den verschiedenen Staaten wie zu Läden in einem Einkaufszentrum und man sucht sich die Gesetze und [wirtschaftlichen] Bedingungen aus, die am besten zu einem bestimmten Vermögenswert [bzw. Vermögensstrategie] passen.“ (Friedrichs et al. 2018, 18:15ff)
- Durch internationale Investitionen kann sich das Finanzkapital partiell einer nationalen Besteuerung entziehen. Der daraus resultierende internationale Steuerwettbewerb führte seit den 1970er Jahren zu einer stark sinkenden Steuerbelastung von Kapitaleinkommen. Gleichzeitig stiegen die Abgaben auf Arbeitseinkommen sowie die indirekte Besteuerung (Steuern auf Konsumgütern und Energie). In Deutschland nahm insbesondere die Höhe der Sozialabgaben deutlich zu.
Durch die Kombination der genannten Mechanismen erreicht das Vermögen der oberen Schichten inzwischen Dimensionen, bei der ein privates Ausgeben des Geldes ökonomisch sinnvoll kaum noch möglich ist. Die Geldsummen sind einfach zu groß. Durch Zinseszins-Effekte erhöht sich der Abstand zur durchschnittlichen Bevölkerung immer weiter. Es entsteht eine neue Kaste von Rentiers, die primär von ihren Zinsen lebend, ein Vielfaches des durchschnittlichen Lebensstandards haben.
Christoph Gröner, Besitzer der Immobilienfirma CG-Gruppe, bringt es auf den Punkt:
"Wenn Sie 250 Mio. € haben und schmeißen das Geld zum Fenster raus, kommt es zur Tür wieder rein. Sie kriegen es nicht kaputt. Sie kaufen Autos, die kriegen mehr Wert. Sie kaufen Häuser/Immobilien, die kriegen mehr Wert. Sie gehen in Gold, das Gold wird mehr wert. Sie können es durch Konsum nicht zerstören - das Geld." (Friedrichs et al. 2018, 00:40ff)
Politische Herausforderungen der Globalisierung
A) Globale Märkte
B) Multipolare Welt
C) Migrationspolitik
D) Kultureller Identität
A) Globale Märkte
Die Volkswirtschaften verflechten sich über die Außenwirtschaft zunehmend miteinander. Das spiegelt sich sowohl auf betriebswirtschaftlicher Ebene der transnationalen Konzerne als auch den volkswirtschaftlichen Angleichungen der Preise sowie der internationalen Arbeitsteilung wieder. Insbesondere bei kurzfristig beschlossenen Maßnahmen wie Wirtschaftssanktionen oder Subventionen wird es schwierig (langfristige) Folgen abzuschätzen. Entsprechend unsicher sind die Prognosen ob die Maßnahmen erfolgreich sind oder wie hoch der Schaden für die fremde bzw. eigene Wirtschaft ist.
Bsp.: US-Sanktionen gegen Russland (Pfeiffer 2018)
Am 06. April 2018 verhängten die USA Sanktionen gegen den russischen Aluminium-Konzern Rusal. Angeblich mischten sich führenden Managern in den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf ein. Rusal ist der weltgrößte Produzent von Aluminium. 40 Prozent der europäischen Aluminium-Importe stammen aus seiner Produktion. Da die Geschäfte vor allem in US-$ abwickelt werden, bereiten die Sanktionen auch europäischen Geschäftspartnern Schwierigkeiten. Auch reagieren die Börsen auf die Unsicherheiten. Der Preis für Aluminium im Spot-Markt stieg deutlich. Spekulanten konnte gute Gewinne erzielen. Die Preissteigerungen setzten europäische Importeure unter Druck. Gleichzeitig weicht Rusal den Sanktionen aus. Erste Vermutungen in der Presse verweisen auf China als zusätzlichen Abnehmer als auch Zwischenhändler. Die Sanktionen laufen weitgehend ins Leere.
Abbildung 05: Die Entwicklung des Preises Aluminium (06/2016 – 05/2018)
Roter Kreis: Inkraftsetzung Sanktionen gegen Rusal.
Screenshot: von http://markets.businessinsider.com/commodities/aluminum-price
Leider führt die wachsende Unsicherheit nicht zu einer Einschränkung einseitiger Wirtschaftsmaßnahmen. Im Gegenteil, durch die sehr differenzierten Folgen, unterliegt die Politik oft Steuerungsillusionen. Kurzfristige Wirtschaftsimpulse - ob positiv oder negativ - werden bewusst als langfristiger Trend ausgegeben. Die Maßnahmen erreichen das politische Ziel nicht, bleiben aber in Kraft.
B) Multipolare Welt
Die Macht einzelner Staaten wird stark eingeschränkt. Es entstehen wirtschaftliche und politische Alternativen. Insbesondere China stellt eine wirtschaftliche Ergänzung teilweise sogar eine Alternative zu den Märkten der EU und Nordamerikas dar. Entsprechend relativiert sich die ökonomische Macht der westlichen Zentren.
Bsp.: Umorientierung Russlands
Die seit 2014 verhängten EU-Sanktionen gegen Russland (Amtsblatt der Europäischen Union) zielen vor allem auf dessen wichtigsten Exportsektor - die Öl-/Gas-Förderung. Sie erschweren die Zusammenarbeit mit wichtigen (teil-)staatlichen Unternehmen sowie die Lieferung bestimmter Investitionsgüter. Verstärkt durch sinkende Rohstoffpreise brach der russische Außenhandel ein. Die europäischen Exporte nach Russland sanken um über 40 Prozent, die Importe aus Russland um ca. 37 Prozent. Für beide Seiten liegen die Kosten der Sanktionen bei mehreren 100 Mrd. €. (Thielicke 2018)
Russland reagierte mit einer Neuausrichtung seiner Außenwirtschaft auf die ost-asiatischen Märkte. (Schröder 12.2018) Insbesondere der Ölexport Richtung China stieg nach der Erweiterung (2018) der Ostsibirien-Pazifik-Pipeline deutlich an. Der schnell wachsende Warenaustausch mit der Volksrepublik gleicht die wirtschaftlichen Verluste im EU-Handel langfristig mehr als aus. Russland gewinnt sogar durch die von außen forcierte Diversifikation seiner Handelspartner an Unabhängigkeit und wirtschaftlicher Stabilität. So sollen geplante Verlängerungen der Ostsibirien-Pipeline zukünftig auch Südkorea und Japan mit Öl versorgen.
Auf EU-Seite hingegen reduzierte sich das Handelsdefizit kaum. Allerdings haben russische und asiatische Firmen die entstandenen Marktlücken besetzt. Es steht zu befürchten, dass sich die Exporte zukünftige nicht wieder im Gleichschritt mit den Importen entwickeln, sondern die EU-Einfuhren schneller steigen. Das Handelsdefizit würde dann deutlich anwachsen. Ohne einen politischen Gewinn hätte sich die Position der EU verschlechtert. „Werteorientierte“ Außenpolitik verträgt sich selten mit der ökonomischen Realität.
Abbildung 06: Volumen Außenhandel EU-Russland
Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den Sanktionen der USA gegen den Iran. Eine umfassende Wirkung lässt sich nur erzielen, wenn die EU mitzieht. Entsprechend setzen die USA jetzt die europäische Wirtschaft und damit auch die deutsche unter Druck. (Poelchau 2018a)
C) Migrationspolitik
Zunehmend gelingt es, ausländischen Regierungen die jeweiligen Auslandsminderheiten für die eigenen Ziele zu aktivieren. Das betrifft u.a. die Generierung von Auslandsüberweisungen als auch den aktiven Einsatz für politische Forderungen.
In Deutschland ist dies zurzeit am stärksten bei den Auslandstürken sichtbar. Die türkische Regierung nutzt diese gezielt um Außenpolitik zu betreiben sowie ihre eigene Machtbasis im inneren zu stärken. (Windisch 2018) Ähnliche Ansätze betreiben aber auch viele andere Staaten wie Russland oder auch Deutschland selbst (über die Auslandsdeutschen in Rumänien, Ungarn und der GUS).
D) Kultureller Identität
Die Globalisierung wird wesentlich durch die großen Nationalstaaten und die transnationalen Konzernen vorangetrieben. Diese fokussieren sich auf die eigene Kultur sowie global vermarktungsfähige (Kultur-)Produkte. In Folge dessen dominieren innerhalb der Gesellschaft als auch auf den internationalen Märkten, bestimmte Arten von kulturellen Massengütern und mit ihnen verknüpfte Sprachen.
Durch die Dominanz bestimmter Hauptkulturen, weniger Sprachen sowie der wachsenden Migration, geraten insbesondere kleine Kulturen unter Druck. So zeigen sich auch in den Industriestaaten, Tendenzen der Zurückdrängung kultureller Minderheiten. Beispielhaft dafür stehen die Volksgruppen auf dem Balkan wie die Pomaken (muslimisch-türkische Bulgaren), die Walachen (romanische Volksstämme in verschiedenen Ländern des Balkans) oder die Uskoken. (Jähne 2018) Aber auch die Zukunft der Minderheiten in Deutschland wie der Sorben und Friesen ist ungewiss.
In der öffentlichen Diskussion findet vor allem das Aussterben von Sprachen Beachtung. Oft wird dabei vor allem dem Englisch bzw. der Globalisierung allgemein eine Verdrängung der heimischen Kultur vorgeworfen. Auf globaler Ebene sind wohl eher Prozesse der Nationenbildung Hauptauslöser des weltweiten Sprachensterbens. Insbesondere der Aufbau einheitlicher Bildungssysteme beschleunigt die Entwicklung substanziell. (Haarmann 2016, 340ff)
Die Angst vor dem Verlust der eigenen Identität ist ein wesentlicher politischer Treibstoff für „globalisierungskritischen“ Bewegungen. Noch dazu, weil Teile der Gegenseite die Befürchtungen bestenfalls nur ignorieren, schlimmstenfalls als nationalistisch brandmarken. Sie übersehen dabei (oder übergehen auch bewusst), dass im Zusammenhang mit Kultur auch harte wirtschaftliche Interessen berührt werden.
Was nutzen nationale Medienkonzerne, wenn deren Angebot die eigene Bevölkerung schon sprachlich kaum konsumieren kann? Wem nutzt eine Ausbildung in Englisch, wenn zwei Drittel aller Arbeitsplätze an der (deutschen) Binnenwirtschaft hängen? Was bleibt von den eigenen Denkkonzepten, von den eigenen Interessen und alternativen Politikansätzen, wenn diese ihre national-kulturelle Basis verlieren?
Eine einfache Abwehr dieser Fragen verstärkt politische Gegenreaktionen. Dabei wird oft ignoriert, dass ohne Zustimmung der Bevölkerung die Globalisierung keine Basis hat. Die Bewahrung der eigenen (nationalen) Identität bei Teilhabe an der Europäisierung bzw. Globalisierung wird für die international integrierten Volkswirtschaften eine der zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.