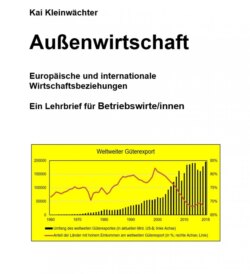Читать книгу Außenwirtschaft Europäische und internationale Wirtschaftsbeziehungen - Kai Kleinwächter - Страница 8
1.4 Gründe für Unternehmen im Ausland zu investieren
ОглавлениеZentrale Vorteile des internationalen Handels können allerdings oft nur durch Investitionen im Ausland realisiert werden. Dafür sprechen vor allem sechs Gründe.
A) Kosteneinsparungen
B) Markterschließung
C) Handel mit Dienstleistungen
D) Nähe zu Marktpartnern
E) Umgehung Handelshemmnisse
Abbildung 04: Motive von Auslandsinvestitionen deutscher Unternehmen
A) Kosteneinsparungen
Jede Volkswirtschaft verfügt über eine andere Ausstattung mit Produktionsfaktoren. Darüber hinaus unterscheiden sie sich voneinander durch ihre Umweltbedingungen, Nachfrage- sowie Angebotsstrukturen, gesellschaftliche Parameter… Daraus resultieren unterschiedliche Kostenstrukturen für die Warenproduktion. Der Aufbau einer Produktion im Ausland ermöglicht es Kostenvorteile auszunutzen. So kann von rumänischen Löhnen nur profitiert werden, wenn die Arbeiter auch dort beschäftigt werden.
In der öffentlichen Diskussion wird dieses Argument sehr häufig bei Diskussionen über Globalisierung genutzt. Oft mit kritischen Untertönen in Richtung Lohndumping, Gewinnraffgier der Unternehmer und Angst vor Verlust von (deutschen) Arbeitsplätzen. In der Praxis jedoch ist die Hochphase dieser Motive für Auslandsinvestitionen vorüber.
Einerseits wanderten weniger technologieintensive, preiselastische und unter hoher ausländischer Konkurrenz stehende Industriezweige bereits seit den 1970er Jahren ab. Der letzte große Schub erfolgte in den 1990er bzw. Anfang der 2000er Jahre mit den Investitionen in Osteuropa. Wirtschaftssektoren wie die Textilindustrie oder die einfache Elektroindustrie existieren in Deutschland kaum noch. Die verbliebenen Wirtschaftszweige produzieren vor allem technologieintensive Güter mit geringer Preissensibilität auf Seiten der Käufer.
Andererseits ist das Argument vor allem für Unternehmen relevant, deren zentraler Absatzmarkt Deutschland ist. Die Produktion im Ausland dient ihnen zur besseren Positionierung gegenüber der Konkurrenz. Je geringer der Fokus auf den heimischen Markt ist, umso mehr treten andere Argumente hinzu bzw. dominieren sogar.
Ebenfalls entwickelt sich das Lohngefüge in den ausländischen Märkten. So stiegen die chinesischen Löhne in den letzten 20 Jahren jedes Jahr deutlich. Auch in anderen Standorten mit niedrigen Löhnen wie Osteuropa und Süd-Ostasien verknappen sich die Arbeitskräfte bzw. nehmen die Löhne zu. Unternehmen, die sich einseitig auf niedrige Lohnkosten konzentrieren, müssten entsprechend immer wieder ihre Produktion verlagern. Angesichts lange Amortisationszeiten für Maschinen und Gebäude sowie der nur langsamen Entwicklung der volkswirtschaftlichen Produktivität halten solche Strategie nur wenige Unternehmen langfristig durch.
Folge des Versuchs die internationalen Vorteile bei der Kostenstruktur auszunutzen, sind hochkomplexe Produktions- und Lieferstrukturen.
Beispiel: Produktionsstruktur Kurbelwelle BMW-Mini (Bochum 2019)
Die Kurbelwelle wird in Nordfrankreich gegossen. Die Weiterverarbeitung erfolgt im englischen BMW-Werk Hams Hall. Die nächste Station befindet sich im BMW-Motorenwerk in Steyr (Österreich). Hier wird die Kurbelwelle in den Motorblock eingebaut. Die Endmontage - der Einsatz des Motors in ein Fahrzeug - wird in Oxford durchgeführt. Die Kurbelwelle hat dann über 1.400 km zurückgelegt und insgesamt viermal den Ärmelkanal überquert. Solche Produktionsstrukturen währen ohne den europäischen Freihandel sowie niedrigste Transportkosten nicht rentabel. Entsprechend stellen sowohl der BREXIT als auch Überlegungen zur Verteuerung von Mobilität die Unternehmensstruktur BMW´s (und anderer Autokonzerne) in Frage.
B) Markterschließung
In der betriebswirtschaftlichen Praxis zeigt sich oft, dass die reine Lieferung von Waren ins Ausland nicht genügt, um dort gute Ergebnisse zu erzielen. Oft muss vorher in die Märkte investiert werden. Dazu zählt vor allem Marktforschung, Aufbau lokaler Vertriebs- sowie Logistikstrukturen, die Anpassung der Produkte an die Erfordernisse des Exportmarktes sowie Ausgaben für das Marketing. Je stärker die Produkte dem ausländischen Markt angepasst werden müssen, umso eher wird sich ein Unternehmen für den Aufbau einer dortigen Produktion entscheiden.
Oft werden dafür auch sogenannte Hub-Strategien gewählt. Dabei tätigen die Unternehmen Investitionen in einer zentralen Volkswirtschaft in der Zielregion. Von dieser beliefern sie dann die anderen regionalen Märkte.
Beispiel: Deichmann
Der Konzern versucht durch internationale Expansion trotz eines gesättigten deutschen Marktes weiter zu wachsen. Eine zentrale Bedeutung erlangt dabei die Türkei. Trotz dortiger volkswirtschaftlicher Probleme seit 2017 hält Deichmann an den Investitionen fest. Dazu der Inhaber Heinrich Deichmann: „Aufgeben ist keine Option, dafür ist die Türkei zu wichtig, zumal das Land unser Brückenkopf in den Nahen Osten ist. […] Wir wollen aus der Türkei heraus in den Nahen Osten und die arabische Welt expandieren. […] Dort leben nicht nur viele Luxuskäufer, sondern auch einfache Arbeiter und Menschen, die günstig Schuhe kaufen wollen oder müssen.“ (Hielscher 2018, S. 38)
C) Handel mit Dienstleistungen
Dienstleistungen können auf Grund ihres immateriellen Charakters nur schwer ausgeführt werden. Produktion sowie Konsum erfolgen hier eher lokal. Darin liegt eine der wesentlichen Ursachen für die sehr niedrige Bedeutung der Importe am staatlichen Konsum (weniger als fünf Prozent; vgl. Grafik 3). Schulen, Betriebsinspektionen oder ärztliche Dienstleistungen lassen sich kaum über Strukturen des Außenhandels erbringen. Durch den Aufstieg der Dienstleistungen im Verbund mit klassischen Industrieprodukten (Wartung, Ausbildung Personal und Verkäufer, Anpassung Maschinen an Bedürfnisse des Kunden….) muss im Exportland zunehmend eine dafür geeignete Produktion aufgebaut werden.
D) Nähe zu Marktpartnern
Viele Unternehmen folgen ihren Marktpartnern bei deren internationaler Expansion. Wenn wichtige Kunden Produktionsanlagen im Ausland eröffnen, sehen sich die Zulieferer gezwungen, ebenfalls diesen Schritt zu gehen. Sonst könnten die Zulieferer den Kontakt zum Partner verlieren. Die Lücke würde ein Konkurrent füllen, der eventuell in Zukunft auch im Binnenmarkt zum Zuge kommt. Besonders bei geographisch entfernten Märkten - die nicht mehr von Heimatmarkt bedient werden können - dominiert dieses Motiv. Insbesondere der Verkauf von Dienstleistungen gestaltet sich ohne Präsenz beim Kunden schwierig. So war im Jahre 2014 für 87 Prozent der Unternehmen die Nähe zu Marktpartner entscheidend bei der Wahl ihrer Auslandsinvestitionen. (DIHK 2014)
E) Umgehung Handelshemmnisse / Verringerung Kosten Logistik
Da viele Staaten ihren Außenhandel insbesondere den Export regulieren, ist es manchmal von Vorteil die Produktion hinter die Außengrenzen zu verlagern. Insbesondere produzierende Unternehmen können möglicherweise nur so einen Marktzugang erlangen.
Aber durch den Internationalen Handel bzw. Auslandsinvestitionen kann es auch gelingen nationale Regelungen zu umgehen. Eine Produktion, die beispielsweise in Deutschland mit Auflagen verbunden ist, könnte in einem anderen weitgehend unreguliert sein. Entsprechend wäre eine Verlagerung des Produktionsstandortes aus Unternehmenssicht sinnvoll. Das wäre beispielswiese bei der Umgehung von Umweltstandards.
Die konkrete Kombination der Argumente hängt stark vom Unternehmen, der Branche, den Marktpartnern sowie der konjunkturellen Lage von Herkunfts- und Zielmarkt ab. So gewann beispielsweise in den Krisenjahren 2003/04 sowie 2008 das Motiv „Kostenersparnis“ deutlich an Relevanz.
Beispiel: Heckler & Koch (H&K) (Rahmann 2018)
H&K produziert vor allem Handfeuerwaffen - für die private als auch militärische Nutzung. Hauptproduktionsstandort ist Deutschland. Aus Sicht von H&K können durch den Bau einer Waffenfabrik in Georgia (USA) mehrere Ziele erreicht werden:
(1) Vereinfachung Logistik: Die USA sind einer der wichtigsten Absatzmärkte für Schusswaffen. Durch eine Produktion vor Ort könnte H&K Aufwand und Kosten des Transportes, inkl. Zollabwicklung, deutlich senken.
(2) Kostensenkung: Georgia hat ein niedrigeres Lohnniveau als Deutschland. Es gilt ein deutlich geringerer Arbeits- und Kündigungsschutz und die Gewerkschaften sind sehr schwach. H&K könnte wahrscheinlich die Lohnkosten senken bzw. diese flexibler gestalten.
(3) Bessere Ausfuhr in Drittländer: In Deutschland sind Waffenexporte gesellschaftlich sehr umstritten. In Folge unterliegt besonders die Ausfuhr in Nicht-NATO-Staaten erheblichen politischen Regularien. „Deutschland darf eigentlich nur in Ausnahmefällen Waffen an Drittstaaten wie Brasilien liefern, nämlich, wenn besondere außen- oder sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands für die Genehmigung sprechen.“ (Franzen 2018) In den USA Waffenexporte weniger umstritten. In Folge fördern diese den Export - auch in Kriegsgebiete. Durch eine US-Produktion könnte H&K Dritt-Staaten einfacher beliefern.
Auch andere Rüstungskonzerne gehen diesen Weg. So vergab Rheinmetall Lizenzen des Leopard 2-Panzers nach Zypern sowie Italien. Die Versorgung politisch heikler Kunden wie der Türkei oder Katar mit Ersatzteilen, Munition etc. erfolgt jetzt von diesen Standorten aus.