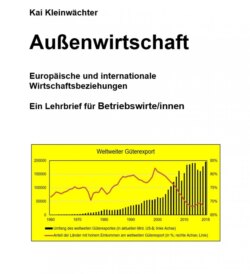Читать книгу Außenwirtschaft Europäische und internationale Wirtschaftsbeziehungen - Kai Kleinwächter - Страница 12
2.2 Handelshemmnisse
ОглавлениеHandelshemmnisse sind Barrieren denen sich Unternehmen beim Handel im Ausland gegenübersehen. Sie unterbinden entweder den Handel ganz oder erhöhen dessen Kosten. Bei Beseitigung dieser Hemmnisse würden die Unternehmen theoretisch mehr Handel betreiben oder zumindest dabei geringere Kosten haben.
Ein völlig freier Handel hat nie existiert. Er würde die Nicht-Existenz jedweder Staatlichkeit, Transportkosten von null sowie völlig identische Volkswirtschaften bzw. Gesellschaften voraussetzen. Insofern wird es auf absehbare Zeit Handelshemmnisse geben. Die Frage ist also nicht ob es welche gibt, sondern wie sind deren Auswirkungen und sind die Hemmnisse als auch ihre Folgen beabsichtigt bzw. erträglich.
Vorteile von Handelshemmnissen
Durch eine gezielte Instrumentalisierung von Handelshemmnissen lässt sich die wirtschaftliche Entwicklung beschleunigen. Beispielsweise beruht der wirtschaftliche Erfolg der süd-ost-asiatischen Staaten (Japan, Korea, Vietnam und China) wesentlich auf einer aktiven Steuerung des Handels. Die Kombination aus Export-Promotion bei selektiver Marktabschottung und Förderung von Investitionen in die Binnenwirtschaft erwies sich als sehr leistungsstark.
Nachteile von Handelshemmnissen
Allerdings steigen in Folge hoher Handelshemmnisse meist die Handelspreise, da die Händler ihre gestiegenen Kosten an die Endkunden weiterreichen. Ebenfalls finden oft Ausweichreaktionen statt. Teile der Wirtschaft aber auch der privaten Haushalte versuchen, die staatlichen Regulierungen zu umgehen. Die Mittel der Wahl sind dann meist Schmuggel sowie die Erbringung der Leistung in der Schattenwirtschaft. Zu den ökonomischen Verzerrungen treten oft politische Auseinandersetzungen. Profiteure der Maßnahmen versuchen diese zu erhalten oder sogar auszubauen. Die Geschädigten wehren sich dagegen.
Beispiel: Kuba – Ausweichreaktion (Knobloch 2018)
Kuba verbietet natürlichen Personen den Import von Konsumprodukten sowie einfachen Investitionsgütern (Bsp.: Autoscheinwerfer, Werkzeuge…). Diese dürfen nur über staatliche Unternehmen bzw. Agenturen eingeführt werden. Allerdings können private Personen aus dem Urlaub bis zu 120 kg Gepäck pro Jahr weitgehend zollfrei importieren. So entstand ein eigener Wirtschaftszweig, der Kubaner für „Urlaub“ im Ausland bezahlt. Die Unternehmen zahlen den Flug, zwei/drei Tage Aufenthalt und teilweise bis zu 200 US-$ Bargeld. Auf dem Rückweg transportieren die „Urlauber“ vom Auftraggeber beschaffte Güter nach Kuba. Besonders Kubaner mit mehreren Staatsbürgerschaften profitieren davon. Denn sie können auch westliche Handelsbeschränkungen umgehen. Neben der ökonomischen Verzerrung setzt auch eine Erosion des politischen Systems ein. Die versprochene bzw. behauptete Gleichheit gilt nicht für jeden. Eine Entwicklung die auch in der DDR beobachtet werden konnte. Wer „West-Verwandtschaft“ hatte oder in die BRD reisen konnte, verfügte über Konsummöglichkeiten, die andere nicht hatten.
Eine andere Form der Ausweichreaktion ist mehr oder weniger versteckte Korruption von Entscheidungsträgern - vom Zollbeamten bis in hohe Staatsämter. Insbesondere bei staatlichen Hemmnissen mit politischer Entscheidung wird von Seiten der Unternehmen oft versucht den Weg der Bestechung zu gehen.
Beispiel: Korruption bei Waffengeschäften (Heilig 2018)
Bei großen Rüstungsgeschäften tauchen oft Fälle von Korruption auf. Hintergrund ist einerseits, dass dieser Bereich hochpolitisch ist. Nur wenige Spitzen-Politiker und Beamte tragen am Ende die Verantwortung. Das bedeutet aber auch, dass die Liste von zu Bestechenden nicht lang. Andererseits geht es bei solchen Geschäften oft um Milliardenbeträge. Interessanterweise tritt Korruption nicht nur auf Käuferseite auf, sondern auch auf Seiten des Verkäufers. Hintergrund sind die Exportbeschränkungen zur Kontrolle der Rüstungsindustrie. Die Grenze zwischen normalen Lobbying und Korruption sind dabei fließend. Beispielhaft für derartige Einflussnahme steht H&K.
Die Ausweichreaktionen können bis hin zum Aufbau einer umfassenden Schattenökonomie führen. Diese erlangt möglicherweise einen solchen Umfang, dass viele Akteure ein Interesse an ihrem Vorbestand haben – sei es aus persönlichen Profit oder weil ihre Auflösung neue politische Lösungen erfordern würde. Die oft mit Ausbeutung sowie Korruption einhergehenden Strukturen verfestigen sich dann. Staatliche Institutionen werden so Teil privater Strategien der Bereicherung. Folge sind Deformationen von Staatlichkeit.
Beispiel: Altkleiderschmuggeln in Melilla (Khamis 2019)
Die nordafrikanische Küstenstadt Melilla ist ein Überbleibsel der kolonialen Vergangenheit Spaniens. Landwärts ist sie vollständig umgeben von Marokko, gehört aber zur EU. Zum Schutz der marokkanischen Industrie existieren umfassende Zollbarrieren für Textilien aus der EU. Aber inoffiziell dominieren europäischen Textilien, vor allem Altkleider, den afrikanischen Markt. Preisunterschiede, mangelndes afrikanisches Angebot und ungesättigte Nachfrage entfalten einen zu hohen Marktdruck.
Entsprechend etablierte sich in Marokko (wie auch in anderen afrikanischen Küstenstädten) ein einträglicher Schmuggel. Marokkaner dürfen Melilla betreten und dabei „Handgepäck“ zollfrei ein- bzw. ausführen - wenn sie am gleichen Tag wieder zurückgehren. Entsprechend schnüren Schmuggler in Melilla schwere Ballen mit Textilien wie Altkleidern und Schuhen sowie anderen Waren. Tagelöhner der marokkanischen Unterschicht schleppen sie über die Grenze. Damit die Zollbeamten nicht nachfragen, entrichten die Schmuggler eine „Gebühr“. Auf der anderen Seite empfängt ein Kontaktmann die Ware und zahlt eine kleine Prämie. Schätzungen gehen von bis zu 9.000 Menschen aus, die so täglich die Grenze überschreiten. Das sind je Tag mehr als 300 Tonnen Waren.
Das Geschäft ist fest in der Hand organisierter Gruppen. Die Tagelöhner können von den Umsätzen kaum leben. Wer sich auflehnt bekommt keine Arbeit mehr. Gleichzeitig schützen die marokkanischen Sicherheitskräfte die Banden. Die „Zollgebühr“ bringt ihnen ein vielfaches ihres kleinen Lohnes. Die EU rüttelt daran nicht. Sowohl der Druck der Textilindustrie als auch der Sicherheitsapparate sind zu stark. Fällt der Schmuggel weg, fürchten letztere Instabilitäten sowie den Verlust an Einfluss.