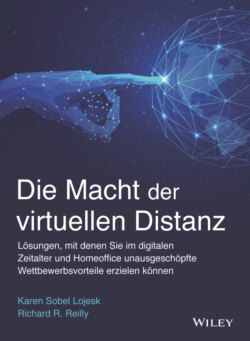Читать книгу Die Macht der virtuellen Distanz - Karen Sobel Lojeski - Страница 11
Hintergrund
ОглавлениеEine der ersten Städte in den USA, die in den Lockdown gingen, war Hoboken, New Jersey. Dort trafen Dick und ich uns im Stevens Institute of Technology. In Hoboken befindet sich zufällig auch die Zentrale des Wiley‐Verlags. Kurz danach zogen mein Heimatstaat New York und alle anderen Staaten im Nordosten der USA nach.
An diesem Punkt schickte ich unserem Lektor eine kurze Anfrage, ob das Buch in Druck gehen würde, bevor man alles dichtmachte. Ich erhielt nicht sofort eine Antwort, aber wenige Tage später trafen meine Belegexemplare ein.
Obwohl es ein fantastischer Tag war – wir hatten unser drittes Buch mit einer einzigartigen Landkarte der virtuellen Distanz veröffentlicht, die in dieser Krisensituation von Organisationen gleich welcher Art als Orientierungshilfe genutzt werden konnte –, dachte ich mit gemischten Gefühlen an die Möglichkeiten der Verkaufsförderung. Es war nicht gerade der richtige Zeitpunkt, um zu feiern.
Ab März trafen Tag für Tag dutzende E‐Mails mit der Frage ein, wie man am besten Remote arbeitet. Zuerst stammten sie überwiegend von einzelnen Unternehmensberatern oder Leuten, die als dogmatische Befürworter der mobilen oder standortunabhängigen Arbeit bekannt waren. Ich erinnere mich, dass ich dachte, es sei auch nicht der richtige Zeitpunkt, um dieser spezifischen Sichtweise mehr Schubkraft zu verleihen, denn die unbeabsichtigten Folgen einer solchen Strategie waren (und sind bis heute) aus der Perspektive der menschlichen Gesundheit nicht eindeutig geklärt.
Obwohl es sich für die meisten Berufstätigen um die einzig sichere Arbeitsform handelt, systemrelevante Arbeitskräfte ausgenommen, hatte man diese Struktur zum Leidwesen einiger Betroffener nie als Standard in Betracht gezogen – außer in Science‐Fiction‐Romanen wie The Naked Sun von Isaac Asimov. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass eine Krise nicht dazu dienen sollte, eine so langfristige Positionierung der Unternehmen zu zementieren – zumindest nicht angesichts der begrenzten Informationen über die damit verbundenen Auswirkungen. Doch als Zwischenschritt, um Leben zu retten, ist Remote‐Arbeit in globalem Maßstab eine der besten Lösungen, auch wenn sie uns einen hohen persönlichen, familiären und gesellschaftlichen Preis in Form physischer und mentaler Folgen für Gesundheit und Wohlergehen abverlangt.
Kurz nach jener ersten Beratungswelle wurde von Videokommunikationsunternehmen eine weitere Flutwelle von Tipps und Tricks ausgelöst. Diejenigen, die »Installationsarbeiten« für Videokonferenzen anboten, waren als Experten gut aufgestellt, technische Verbindungen herzustellen. Sie konnten in diesem beispiellosen Zustand extremer Isolation ihren Nutzern aber nicht wirklich ein Gefühl menschlicher Verbundenheit vermitteln – einer Situation, in der es Kontakte zu anderen zu meiden galt, mit Ausnahme der Beschaffung von Lebensmitteln, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.
Bis zu dem Zeitpunkt konnten Remote‐ oder standortverteilte Mitarbeiter ihr Arbeitsgerät ausschalten und ins Fitnesscenter gehen, Nachbarn und Freunden die Hand schütteln, Menschen umarmen, die sie eine Weile nicht gesehen hatten, und ihre Kinder nach Beendigung der außerlehrplanmäßigen Aktivitäten von der Schule abholen.
Das alles hat sich geändert.
Und die Realität dessen, was diese Entwicklung beinhaltet und auch in Zukunft beinhalten könnte, ist ein weiteres Gedankenexperiment mit einer schier endlosen Reihe von Tentakeln, die zumindest bewusste Aufmerksamkeit und reifliche Überlegung verdienen, bevor wir als Unternehmergesellschaft zu »permanenten« Entscheidungen gelangen.
Obwohl damals phasenweise einige interessante und innovative Leitlinien auftauchten, fehlte fast allen das Fundament einer jahrzehntelangen methodisch validen Forschung. Einige erwiesen sich als hilfreiche Tipps und dringend benötigte Erleichterung von den zunehmend stressreichen und traumatischen Erfahrungen, die sich bei jedem Blick auf den Bildschirm aufbauten, wenn die Nachrichten wieder einmal die steil ansteigende Infektionskurve zeigten.
Zweifellos konnte das Konzept der virtuellen Distanz als stabiles Rahmenwerk genutzt werden, um Licht in das Dunkel der Remote‐Arbeit zu bringen – ungeachtet dessen, wie lange die Covid‐Pandemie andauern mochte. Damit würde ein unumkehrbarer Wandel des Begriffs »zur Arbeit gehen« verbunden sein, sowohl auf struktureller als auch psychologischer Ebene. Das Rahmenwerk konnte außerdem als Orientierungshilfe für diejenigen dienen, die auch weiterhin an ihrem standortgebundenen Arbeitsplatz erscheinen mussten oder irgendwann beschließen würden, in eine sichere Arbeitsumgebung zurückzukehren, um das dringende Bedürfnis nach Sozialkontakt zu befriedigen, wenngleich in eingeschränkter Form.
Ich beriet auch weiterhin Führungskräfte aus zahlreichen globalen Organisationen. Anfang Februar 2020 wurde ein Personalleiter, mein Ansprechpartner in einem solchen Unternehmen, mit Notfällen aller Art und aus aller Welt überschwemmt.
In einem anderen Fall waren Arbeitsregeln mit »A« und »B« Tagen aufgestellt worden – die vorsahen, dass jeweils die Hälfte der Belegschaft wechselweise zur Präsenzarbeit am Firmenstandort erscheinen sollte (bevor der totale Lockdown verhängt wurde). Auf diese Weise hoffte man, Ansteckung zu vermeiden. Eine logische Vorstellung im Hinblick auf Schutzmaßnahmen, wie Kontaktnachverfolgung und Quarantäne.
Natürlich änderte das nichts an den Gefühlen oder Ängsten der meisten Mitarbeiter. Jeden Tag setzten sie auf dem Weg zur Arbeit und durch den Umgang mit Menschen, die vielleicht an Covid erkrankt waren, sich ohne ihr Wissen infiziert hatten oder keine Symptome aufwiesen, ihr Leben aufs Spiel. Dennoch hatten sie sich zunächst für diese Alternative entschieden. Damals gab es verschiedene Optionen, je nach Land, Klein‐ oder Großstadt und Unternehmen. Und das ist noch heute der Fall.
Aber es gab noch mehr Variablen, abhängig von der eigenen Komfortzone, die gegen überaus reale Sorgen und Situationen im häuslichen Arbeitsumfeld in die Waagschale geworfen wurden. Doch auch das begann sich zu ändern. Einige Führungskräfte hatten in der Anfangsphase der Krise die Befürchtung, die »Kontrolle« über ihre Mitarbeiter und ihre geschäftlichen Aktivitäten zu verlieren. Sie gelangten zu der Ansicht, es sei an der Zeit, nach vorne zu schauen und zu irgendwelchen Arbeitsgewohnheiten »zurückzukehren«, die der früheren »Normalität« entsprachen.
Doch das wäre ein Fehler.
Im ersten Corona‐Jahr haben wir den Anstieg einer extremen virtuellen Distanz erlebt.
Extreme virtuelle Distanz bezieht genau diejenigen Formen der Distanz ein, die wir seit mehr als einem Jahrzehnt erforscht und in diesem Buch beschrieben haben:
weitreichende und anhaltende »Traumatisierung«,
kognitive Dissonanz und
extreme Isolation.