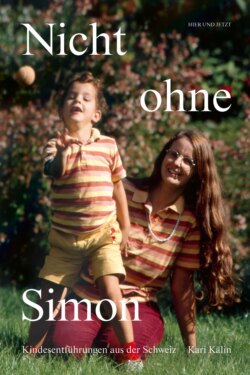Читать книгу Nicht ohne Simon - Kari Kälin - Страница 7
Der Fall Samir
ОглавлениеFrühling 1981, Bahnhofplatz 9, Café Brésil in Biel: Irma Samir, 34-jährig, eine bildschöne Frau mit langen, schwarzen Haaren, kommt zum Mittagessen – wie so oft. Sie habe drei Söhne, aber alle, so erzählt sie Monique Werro, der Geschäftsführerin des «Brésil», lebten in Ägypten. Werro ist erstaunt. Im darauffolgenden Sommer, Samir ist wieder zu Gast im «Brésil», sagt sie Werro plötzlich: «Da vorne, auf der Strasse, da läuft mein Mann.» Jetzt klärt Samir Werro über das Drama mit ihren Kindern auf: Vater Mahmoud Samir hält die drei Buben, unterdessen alle im Teenageralter, in Ägypten versteckt, mal bei Familienmitgliedern und Verwandten, dann wieder bei Freunden.
Irma Samir brachte einige Opfer, um die zerrüttete Ehe mit ihrem 18 Jahre älteren Mann zu kitten. Sie konvertierte zum Islam, 1978 zog sie mit Mahmoud nach Ägypten. Doch die Beziehung liess sich nicht retten. Samir kehrte wenige Monate später zurück in die Schweiz, reichte die Scheidung ein und wollte die Söhne nachkommen lassen. Ihr Mann lehnte die Scheidung jedoch ab, die gemeinsamen Kinder gab er nicht her.
Werro ist empört über das Gehörte und schlägt vor, den Beobachter über den Skandal zu orientieren. Samir will ihren Fall aber noch nicht an die Öffentlichkeit bringen, sondern das Gerichtsurteil abwarten. Am Mittwochmorgen, 25. November, ist es so weit: Für Samir ist das Urteil eine Katastrophe. Das Bieler Amtsgericht spricht das Sorgerecht dem Vater zu, einem Islamisten, der gemäss Medienberichten in dubiose Geschäfte verstrickt ist und fürchtet, bei seiner Frau würden die Kinder nicht im muslimischen Glauben erzogen. Samir hat sich in den letzten Jahren emanzipiert und arbeitet ganztägig. Diese Tatsache scheine ihr nun, stellte der Tages-Anzeiger fest, in den Scheidungsverhandlungen zum Verhängnis geworden zu sein. Der Vater versteckt die Kinder in einem fremden Land, ohne sich um sie zu kümmern. Dennoch attestiert ihm das Gericht mehr pädagogische Kompetenz als der werktätigen Mutter. Nach diesem Verdikt verliert Samir den Glauben in die Justiz. Um 11 Uhr installiert sie sich, eingehüllt in Wolldecken, auf der Treppe des Bieler Amtshauses und beginnt ihren Hungerstreik. «Ich will meine Kinder zurück, ich will, dass sie in die Schweiz kommen» heisst es auf zwei Tafeln, die links und rechts von ihr stehen.
Von der Telefonzelle aus, die neben dem Amtshaus steht, informiert Werro die Medien. Am gleichen Abend berichtet die Tagesschau über den Fall Samir, in den nächsten Tagen erscheinen schweizweit Dutzende Zeitungsartikel über das Schicksal der jungen Frau. Mit aller Wucht dringt die Problematik internationaler Kindesentführungen durch einen Elternteil ins öffentliche Bewusstsein. Die Schweiz solidarisiert sich mit der Mutter, sie erhält unzählige Briefe und Postkarten mit Sympathiebekundungen, niemand kann den Richterspruch nachvollziehen. Innert kürzester Zeit unterschreiben 2000 Bürgerinnen und Bürger eine Petition, in der die Bieler Behörden aufgefordert werden, für die Rückführung der Kinder in die Schweiz zu sorgen. Mahmoud Samirs Versuch, seine Frau als eine Verrückte zu diskreditieren, der man die Kinder nicht anvertrauen könne, misslingt.
Prominente Personen schalten sich in die Affäre ein. Edmond Kaiser, Gründer des Kinderhilfswerks Terre des hommes, der 1971 selbst in einen Hungerstreik trat, um vom Hungertod bedrohten Kindern in Bangladesch zu helfen, bezeichnet Samir in einem Brief an Bundesrat Kurt Furgler als Opfer einer «Betonjustiz». Kaiser appelliert an den Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD), auf die Richter einzuwirken, damit die Kinder von Samir in die Schweiz zurückkehren können. Das EJPD weist die Aufforderung als unbotmässigen Eingriff in die Gewaltentrennung zurück. Doch der Druck auf die Bieler Justiz steigt auch ohne bundesrätliche Einmischung, je länger Samir die Nahrungsaufnahme verweigert. Am 3. Dezember, Samir hat ihre Protestaktion unterdessen in die Kapelle der französischen reformierten Kirche in Biel verlagert, kippt das Bieler Amtsgericht sein Urteil. Es entscheidet, die Kinder seien in die Schweiz zurückzuführen, unter Vormundschaft zu stellen und in einem Kinderheim in Langenthal unterzubringen. Damit beendet Samir ihren Hungerstreik. Die Kinder aber kehren erst rund ein Jahr später definitiv in die Schweiz zurück. Samir und ihr Mann treffen folgende Vereinbarung: Sie überlässt ihm das Sorgerecht, im Gegenzug erhält sie ein Besuchsrecht.