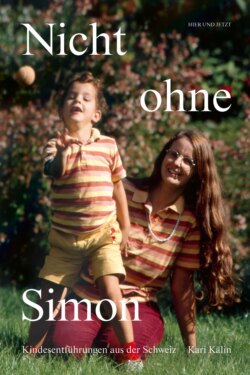Читать книгу Nicht ohne Simon - Kari Kälin - Страница 8
Eine Mutter kettet sich an die italienische Botschaft
ОглавлениеKaum hat sich die Situation in der Affäre Samir entspannt, sieht sich die Schweiz mit dem nächsten Hungerstreik einer alleingelassenen Mutter konfrontiert. Am 15. Dezember 1981 kettet sich Monica Ranieri* an die italienische Botschaft in Bern. Ihr italienischer Ehemann, von dem sie seit acht Jahren getrennt lebt, hat den 14-jährigen Sohn und die 10-jährige Tochter Ende August nicht aus Florenz zurückgebracht. Trotz mehreren schweizerischen und italienischen Gerichtsurteilen zu ihren Gunsten weigert sich die italienische Polizei, Ranieris Recht durchzusetzen. Ein Unterstützungskomitee, dem Monique Werro, Irma Samir und Edmond Kaiser angehören, kümmert sich um den Fall. Kurz vor Weihnachten fahren Samir, Werro und Ranieri nach Florenz, um die Kinder eigenhändig in die Schweiz zurückzuholen, da es die Justiz nicht schafft. Als Ranieri ihre Kinder erblickt, rennt sie sofort auf sie zu, herzt und umarmt sie – unglücklicherweise vor den Augen des Vaters, der die Kinder packt, mit ihnen davonrennt und im Vorbeigehen die Fotokameras der Frauen zertrümmert. Was tun? In diesem schäbigen Florentiner Hotel übernachten und zurückfahren in die Schweiz, mit leeren Händen? Nein. Edmond Kaiser bietet einen protestantischen Pfarrer zur Unterstützung auf. Der Gottesmann und die Frauen schalten die italienische Presse ein, harren so lange bei der Nachrichtenagentur Ansa aus, bis sich der Chefredaktor des Falls annimmt. Der Journalist fragt, wer die Frauen überhaupt seien. Der Pfarrer antwortet ohne zu zögern: «Queste sono donne del ‹movimento svizzero contro il ratto dei minori›.» («Das sind Frauen der ‹Schweizer Gruppe gegen die Entführung von Kindern›.») Am nächsten Tag, am 24. Dezember, beherrschen die «Schweizer Gruppe gegen die Entführung von Kindern» und der Fall Ranieri die Schlagzeilen in der italienischen Presse. Danach fahren die Frauen zurück, ohne Kinder. Weihnachten verbringen sie in einem Hotel in Brig, weil sie bei dem dichten Schneetreiben mit Sommerpneus den Kanton Bern nicht mehr erreichen.
Die Schweizer Medien interessieren sich nun für die Gruppe. Werro und Samir sehen sich quasi genötigt, die Erfindung des Pfarrers real werden zu lassen. Am 24. Januar 1982 wird der Verein mit dem Namen «Schweizer Gruppe gegen die Entführung von Kindern» offiziell gegründet. Das Westschweizer Fernsehen begleitet den Akt mit einer Livesendung aus Werros Wohnung. Wenn die Schweiz nicht fähig ist, heisst es in den Statuten, die entführten Kinder zurückzuholen, dann sorgt die Gruppe dafür. Im Wochenrhythmus dringen jetzt neue Kindesentführungen an die Öffentlichkeit. Ein Jahr nach der Gründung des Vereins stapeln sich bei Werro 150 Dossiers – meist von betroffenen Müttern – auf dem Tisch. Im Juli 1982 bietet Willy Kantorik, ein tschechoslowakischer Flüchtling und Pilot, seine Dienste als Kindesrückführer an. Mit seiner Hilfe führt die Gruppe im ersten Jahr ihres Bestehens dreissig Kinder zurück in die Schweiz. In Aktion tritt sie nur, wenn ein Gericht dem zurückgebliebenen Elternteil das Sorgerecht zugesprochen hat.
Werros Büro im obersten Stock des Café Brésil avanciert zur ersten Anlaufstelle für Opfer von Kindesentführungen. Während sie kaum noch dazu kommt, ihr Geschäft zu führen, reagiert jetzt auch der Bundesrat. Er beschleunigt die Ratifikation von zwei internationalen Abkommen zu Kindesentführungen, weil die Öffentlichkeit durch medienwirksame Fälle für das Thema sensibilisiert worden sei. Die Schweizer Gruppe gegen die Entführung von Kindern, hält der Bundesrat fest, habe das Bewusstsein für das Problem geschärft. Seine früheren Vorbehalte wischt er beiseite, auch, weil immer mehr Direktbetroffene bei den Behörden um Hilfe bitten. Ergänzend zum Europäischen Sorgerechtsabkommen schlägt der Bundesrat dem Parlament deshalb vor, auch das Haager Übereinkommen zu Kindesentführungen zu unterzeichnen. Das Haager Übereinkommen ist inhaltlich fast deckungsgleich mit dem Europäischen Abkommen, beschränkt sich aber nicht auf Europa. Die unterzeichnenden Staaten verpflichten sich, die Kinder dem sorgeberechtigten Elternteil zurückzugeben und für eine gütliche Konfliktlösung zu sorgen. Ein Kernpunkt lautet: Die zuständigen Gerichte und Behörden müssen die Rückführung eines Kindes so rasch als möglich anordnen, sofern der sorgeberechtigte Elternteil weniger als ein Jahr nach der Entführung die Rückführung verlangt. Der Bundesrat betont in der Botschaft, wie wichtig eine schnelle Reaktion sei, denn: «Bei allzulanger Frist könnte derjenige, der das Kind entführt hat, in Ruhe nach einer Möglichkeit suchen, sich der Anwendung des Übereinkommens zu entziehen.» Zwar kann ein Kind dem sorgeberechtigten Elternteil auch dann zurückgegeben werden, wenn der Antrag später als ein Jahr nach der Entführung erfolgt. Der Bundesrat wies aber darauf hin, dass solch spät gestellte Anträge auch abgelehnt werden können, weil sich das Kind in der neuen Umgebung vielleicht schon eingelebt habe. Die Zeit spielt also dem Entführer oder der Entführerin in die Hände.
Der Bundesrat stellt klar, dass er den Einsatz von Privatdetektiven nicht unterstütze. Er setzt auf die Rechtshilfe und schreibt in der Botschaft: «Das beste Abschreckungsmittel besteht darin, demjenigen Elternteil, der eine Entführung plant, zu beweisen, dass eine Entführung nicht die erhofften Vorteile mit sich bringt, weil die Behörden des Zufluchtstaates das Kind umgehend in seinen früheren Aufenthaltsstaat zurückschicken.» Für die Zunahme der Kindesentführungen macht er die wachsende Zahl der geschiedenen binationalen Ehen, die guten internationalen Verkehrsverbindungen und die Lockerung der Grenzkontrollen verantwortlich. Auch würden Gastarbeiter, die in ihre Heimat zurückkehrten, oft die Kinder mitnehmen. Dieses Problem habe sich wegen der steigenden Arbeitslosigkeit verschärft. Als erste Opfer der Entführungen bezeichnet der Bundesrat die Kinder. Die zerstrittenen Eheleute würden diese missbrauchen, um einander aus Rache oder reiner Bösartigkeit zu schaden. Der Bundesrat betont, mit den beiden Abkommen verfüge die Schweiz über eine umfassende Handhabe, «um die durch internationale Kindesentführungen entstandenen Probleme zu lösen». In der Parlamentsdebatte warnt die damalige Schwyzer CVP-Nationalrätin Elisabeth Blunschy vor übertriebenen Hoffnungen. Bundesrat Rudolf Friedrich räumt ein, man dürfe von den Abkommen keine Wunder erwarten. Mit gutem Grund. Als sie am 1. Januar 1984 in der Schweiz in Kraft treten, haben sie erst eine Handvoll Staaten, darunter Frankreich und Portugal, ratifiziert. Für die Wunder ist weiterhin die Schweizer Gruppe gegen die Entführung von Kindern zuständig. Der Bundesrat schafft zwar beim Bundesamt für Justiz eine Zentralbehörde für Kindesentführungen durch einen Elternteil. Doch er hält sie sehr schlank. Eine einzige Person, Jurist Bernard Deschenaux, kümmert sich um alle Fälle. Monique Werro begrüsst die beiden Abkommen, glaubt, sie würden betroffenen Eltern Halt geben. Sie habe sich aber gewünscht, dass der Bund die Zentralbehörde mit mehr Geld und mehr Personal ausstatten würde. Dem Tages-Anzeiger sagt sie: «Eine private Organisation wie die unsere schafft es auf die Dauer nicht, den Betroffenen, deren Zahl weit grösser ist, als wir ursprünglich gedacht haben, die erforderliche Hilfe zukommen zu lassen.» Werro wird sich später auch um Beatrix Smit kümmern.