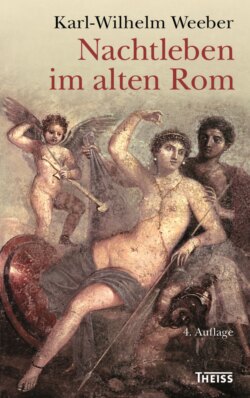Читать книгу Nachtleben im alten Rom - Karl-Wilhelm Weeber - Страница 23
Alltags-Refugium ohne Sperrstunde
ОглавлениеMochten die Gasthäuser auch den Ansprüchen der Oberschicht nicht genügen, der Stimmung unter den Kneipengästen tat das keinen Abbruch. Für die meisten von ihnen war die caupona trotz allem ein Refugium, in dem sie einen Teil ihrer Freizeit verbrachten. Freizeit – sie begann für das Gros der Stammgäste nicht vor dem späten Nachmittag. Ausgedehnte Wirtshausbesuche dürften deshalb eher in die Abend- und Nachtzeit gefallen sein; für kurze ‚Stippvisiten‘, um rasch ein Häppchen zu essen oder einen Becher Wein zu trinken, waren die Lokale auch tagsüber geöffnet.
Über Öffnungszeiten schweigen die Quellen weitgehend. Vermutlich hat es keinerlei Restriktionen gegeben, auch keine nächtliche Sperrstunde. Erst der zwischen 371 und 372 amtierende Stadtpräfekt Ampelius machte dieser liberalen Praxis ein Ende, indem er per Verfügung verbot, tabernae vor der vierten Stunde, also gegen 10 Uhr morgens, zu öffnen.37 Der Betrieb der Schänken und Esslokale bis in die Nacht ist gut bezeugt.38 Im 4. Jahrhundert übernachteten Obdachlose sogar in Kneipen.39 Gaststätten, die zu einem Beherbergungsbetrieb gehörten, werden erst recht abends stärker frequentiert worden sein, wenn die Reisenden sich eine Unterkunft für die Nacht suchten. Dass sie daneben auch auf ‚Siesta-Kundschaft‘ eingestellt waren, macht die Copa deutlich.
Was zog die einfachen Leute – überwiegend die Männer – in die Gaststätten, was machte deren Attraktivität aus? Vor allem eine Geselligkeit, die ihre beengten Wohnverhältnisse im Privaten nicht zuließen. Man erzählte einander Neuigkeiten – die Kneipe war eine noch effektivere Klatschbörse als der Friseur40 – und zechte kräftig miteinander. Der Wein war billig – jedenfalls der normale Hauswein; wer besser bei Kasse war, konnte gegen gehörigen Aufpreis höhere Qualität bestellen (S. Kasten S. 34).
Allerdings musste man den Wirten beim Ausschänken auf die Finger sehen. Sie standen unter dem Generalverdacht des Schankbetruges. Der lag nahe, weil der Wein in der Antike fast immer mit Wasser verdünnt wurde. Jedes Verdünnungsverhältnis über das Normalmaß hinaus bedeutete für den Wirt einen finanziellen Vorteil. Viele gaben dieser Versuchung offenbar nach. Der Hobby-Astrologe Trimalchio ist sich sicher: Gastwirte kommen im Sternzeichen des Wassermanns zur Welt.41 Und ein spätantikes Wörterbuch definiert den caupo („Gastwirt“) schlicht als „jemanden, der Wein mit Wasser mischt“.42 Für Horaz sind Wirte pauschal als „betrügerisch“ und „böswillig“ ver dächtig, Martial bescheinigt ihnen eine wenig schmeichelhafte „Cleverness“ (callidus copo). In einem pompejanischen Graffito macht ein Gast seinem Unmut über die dreiste Panscherei Luft: „Wenn dich doch deine Betrügereien zu Fall brächten, Wirt: Du verkaufst Wasser und trinkst Wein!“43
Die Wirtin Hedone lädt ein – auch mit ihrem Namen („Genuss“)
Schöne Hedone, gut ergehe es dem, der dies liest. Hedone gibt bekannt: Hier trinkt man für einen As. Bezahlst du zwei Asse, so wirst du bessere Weine trinken, gibst du vier Asse, bekommst du Falernerwein zu trinken.
Inschrift; Corpus Inscriptionum Latinarum IV 1679
Andere Gasthaus-Graffiti zeigen, dass sich die Zecher die gute Laune dadurch nicht verderben ließen. „Gib noch ein bisschen kaltes Wasser!“, fordert einer den Wirt sogar seinerseits zum Verdünnen auf. „Gieß einen Becher Setiner nach!“, verlangt ein anderer mit etwas unkonventioneller Bestellmethode per Wand. „Suavis dürstet nach Weinkrügen. Ich bitte euch; es dürstet ihn sehr!“, drängt ein Dritter. Ähnlich bekennen zwei Freunde: „Dies schrieb Epaphra, und Elea hat’s vollendet – beide mit großem Durst.“
Ein Liberius Venustus konnte seinen Spitznamen auf der Kneipenwand lesen: Durch Änderung des L in B wurde aus ihm der „Säufer“ (Biberius von bibere, „trinken“) Venustus. Den originellsten Spruch hat ein erfahrener Trinker in geradezu zeitloser Einsicht auf eine Mauer gekritzelt: Si quisquis bibit, cetera turba est, „wenn einer trinkt, ist ihm alles andere wurscht“. Andere Kneipengänger grüßen nach erfolgreicher Zechtour: avete, utres sumus! „Seid gegrüßt! Wir sind (voll wie die) Schläuche!“44
Auch in der Provinz reichte das Latein der ins Römische Reich aufgenommenen und damit auch in die römische Kneipenkultur eingeführten Germanen allemal aus, den Wirt zum Einschenken aufzufordern. Und das sogar in der erstaunlich kultivierten Form der so ge nannten Spruchbecher. Es handelt sich dabei um Keramik, die auf schwarzem Firnis weiß gemalte Ornamente und freundlich-animierende Aufschriften trägt. Offenbar eine rheinische Spezialität – die reichsten Sammlungen solcher Spruchbecher sind in den Museen in Trier und Köln zu Hause. „Füll Wein ein, Wirt!“ (imple, copo, vinum!), heißt es da; oder reple me, copo, mero!, „fülle mich, Wirt, mit unvermischtem Wein auf!“ – in römischen Augen ein ungewöhnliches Bekenntnis zu barbarischem ‚Saufen‘.45 Maßvoller dagegen ein „Habe immer noch Durst!“ (adhuc sitio); abgeklärt die schöne Erkenntnis vinum vires, „Wein gibt Kraft“. Andere Becher wenden sich an die Kneipenbesucher: „Trink!“ oder „Trinkt“, mahnen sie, „sei fröhlich!“, „genieß mich!“, „zum Wohl!“ (bene te) und gaudiamus felices, „lasst uns Spaß haben und glücklich sein!“46
Kein Zweifel, dass sich das Kneipenpublikum von solchen Sprüchen, vor allem aber durch die Gabe des Bacchus selbst, zur Lebenslust inspirieren ließ. Mochten die Herren von Stand die Nase rümpfen, auch und gerade Kneipenseligkeit war ein Lichtblick in dem an Höhepunkten armen Plebejerleben. Und die feinen Leute verzogen das Gesicht, wenn es sie einmal in eine der „feucht-fröhlichen Tavernen“ (madidae tabernae)47 verschlug und sie sich die „heiseren Gesänge“ der weinseligen Wirtshausgäste anhören mussten.48 Besonderes Niveau wird man diesen Gesängen sicher nicht attestieren können (den bei ‚vornehmen‘ Gastmählern und Trinkgelagen nach einigen Bechern Wein angestimmten freilich ebenso wenig). ‚Ausdrucksstarkes‘ Singen und Grölen gehörten zur Wirtshausatmosphäre genauso wie raue Umgangsformen und eine derbe Sprache. Der von keinen Berührungsängsten geplagte Kaiser Vitellius mischte sich auf Reisen gern in Herbergen und Kneipen unter das einfache Volk, erkundigte sich morgens, ob seine Mitgäste schon gefrühstückt hätten, und bekundete durch ein kräftiges Rülpsen, dass er das seinerseits schon getan hatte49 – Volksnähe dank Volkes Manieren.
7 Trierer Weinbecher. Von der Aufschrift ist parce aq(uam; sic!) zu erkennen, „geh schonend mit dem Wasser um!“