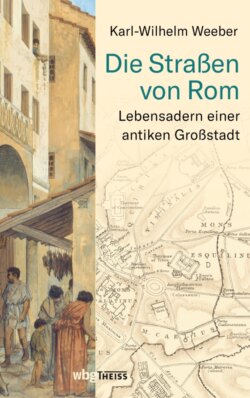Читать книгу Die Straßen von Rom - Karl-Wilhelm Weeber - Страница 10
via: „die Straße“ – mit Schul-Latein auf dem Holz-Weg?
ОглавлениеNicht erst im GPS-Zeitalter fragt sich allerdings der moderne Leser, wieso Demea dem Sklaven die mangelnde Präzision seiner Angaben trotz der zuvor angedrohten „Keile“ durchgehen lässt. Warum darf Syrus ihn mit Hinweisen wie „rechts“ und „links“, „nach oben“ und „nach unten“, einer Säulenhalle und einem Tempelchen, einer Sackgasse, einer kleinen Mühle und einem Ladenlokal gegenüber an der Nase herumführen? Warum fordert er keine Straßennamen und Hausnummern ein? Was auf heutige Leser unverständlich wirkt, war für die römischen Zuschauer ganz normal: Es gab sie nicht! Oder, genauer gesagt, Hausnummern gab es überhaupt nicht, und Straßennamen nur recht wenige. Je enger und kürzer eine Straße oder Gasse war, umso wahrscheinlicher war es, dass sie bis in die Spätantike namenlos blieb. Insofern war es grundsätzlich schon hilfreich, Fremden, die nach dem Weg fragten, wichtige Orientierungsmarken wie Tempel und Altäre, auffällige Monumente oder auch markante freistehende Häuser wohlhabender Bürger zu nennen, ihnen eine allgemeine Richtung zu weisen und sie dann, wenn sie erst im richtigen Viertel angelangt wären, erneut nach dem Weg fragen zu lassen. Exakte Adressen wie „Hauptstraße 36“ oder „Ahornweg 10“ gab es nicht.
Wer den originalen Terenz-Text zur Hand nimmt, wird über eine weitere Auffälligkeit stolpern. Der vertraute und scheinbar selbstverständliche Begriff via kommt in der Passage kein einziges Mal vor. Dabei ist das doch der Terminus für „Straße“, der selbst noch Jahrzehnte nach dem schulischen Latinum präsent ist und zusätzlich durchs Italienische sowie durch Kreuzworträtsel immer mal wieder aufgefrischt wird. Keine einzige via in einer Wegbeschreibung im alten Rom? Ein höchst merkwürdiger Befund!
Beschäftigt man sich näher mit den Straßen im Rom der Antike, so wird dieser auf den ersten Blick irritierende Befund schnell zur Normalität. Als viae wurden hauptsächlich die Überlandstraßen bezeichnet, die sternförmig von Rom in alle Himmelsrichtungen gingen und die Hauptstadt mit den Städten Italiens und den Provinzen des Reiches verbanden: die Via Appia als erste und bekannteste, als regina viarum, „Königin der Straßen“, gerühmte,2 die nach Brundisium (Brindisi), dem Übersetzhafen nach Griechenland, führte, die Via Aurelia, die der Tyrrhenischen Küste folgte und über Genua bis nach Marseille verlief, oder die Via Flaminia, die von Rom über den Apennin zur Adria-Küste bei Rimini führte.
Innerstädtische Straßen dagegen, die als viae bezeichnet wurden, gab es in der gesamten republikanischen Zeit nur zwei: Die über das Forum Romanum führende Sacra Via, die „Heilige Straße“, und die Nova Via (das Adjektiv steht hier jeweils vorn), trotz ihres Namens „Neue Straße“ eine uralte Durchgangsstraße zwischen dem Nordrand des Palatins und dem sumpfigen Velabrum in der Nähe des Tibers.3 In der Kaiserzeit kamen einige wenige viae innerhalb des Stadtgebietes hinzu, in der Regel waren das aber gewissermaßen innerstädtische Verlängerungen der Konsularstraßen. Die bekannteste ist wohl die Via Lata, die heutige Einkaufsstraße Via del Corso („der Corso“). Die „Breite Straße“ ging an der Porta Flaminia in die Via Flaminia über. Die Bezeichnung ist erst seit dem 4. Jahrhundert bezeugt. Die (Neu-?)Benennung steht möglicherweise in Verbindung mit dem Bau der Aurelianischen Stadtmauer im späten 3. Jahrhundert.