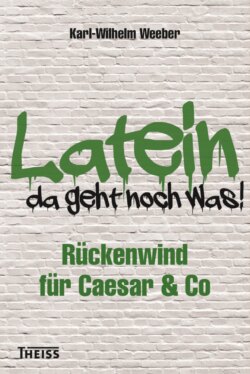Читать книгу Latein - da geht noch was! - Karl-Wilhelm Weeber - Страница 51
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wenn Superlative den Weg versperren und den Krieg auslösen
ОглавлениеMachen wir die Probe aufs Exempel. Schauen wir uns ein weiteres konkretes Beispiel dafür an, wie Caesar den Leser verdeckt „anstupst“, um ihn zu „folgerichtigem“ Denken und auf seine Linie zu bringen. In den ersten Kapiteln des Bellum Gallicum schildert er die Auswanderungspläne der Helvetier. Er stellt sie als kriegerischen, geradezu kriegslüsternen Stamm dar, der in der Eigenwahrnehmung eine Art „Volk ohne Raum“ sei – verständlich aus der Sicht der Helvetier, dass sie ihren Aktionsradius ausweiten wollen. Doch die geographische Situation hindert sie daran: „Auf allen Seiten werden sie von natürlichen Grenzen eingeengt“ – continentur schreibt Caesar, „sie werden zusammengehalten“, „eingeschlossen“, in ihrer Wahrnehmung: „eingepfercht“. In continere schwingt auch das Substantiv continentia mit. Das ist die „Selbstbeherrschung“, „Mäßigung“, das „Ansichhalten“ – in der Ethik der römischen Aristokratie ein moralisches Gütesiegel für einen Menschen, wenn dieses sich Zusammenhalten zu einem Sich-Zusammennehmen aus Einsicht und freiem Willen wird. Davon kann bei den Helvetiern indes keine Rede sein. Ihre continentia ist eine von den äußeren Umständen erzwungene. Ändern sich diese Umstände, so kann man sich leicht ausmalen, wie dieser auf Krieg versessene Stamm alle Mäßigung aufgeben wird.
Im nächsten Satz erläutert Caesar das contineri, „Eingeengtsein“, der Helvetier durch natürliche Grenzen ganz konkret: una ex parte flumine Rheno latissimo atque altissimo, qui agrum Helvetium a Germanis dividit, altera ex parte monte Iura altissimo, qui est inter Sequanos et Helvetios, tertia lacu Lemanno et flumine Rhodano, qui provinciam nostram ab Helvetiis dividit (Caes. B. G. I 2, 3). Drei geographische Barrieren werden skizziert; der jeweils folgende Relativsatz stellt sie als natürliche Grenze dar, die sie von den jeweiligen Nachbarn trennt: „Auf der einen Seite durch den sehr breiten und sehr tiefen Rhein, der das helvetische Gebiet von den Germanen trennt, auf der anderen durch das sehr hohe Jura-Gebirge, das zwischen Sequanern und Helvetiern liegt, auf der dritten Seite durch den Genfer See und die Rhône, die unsere Provinz von den Helvetiern trennt.“
In welche Richtung werden die Helvetier ihren „Ausbruchsversuch“ unternehmen? Caesars Leserlenkung gibt die Richtung vor, ohne dass er es expressis verbis aussprechen muss: Die Superlative, die vor die Barrieren eins und zwei gestellt werden, wirken wie ein Sperrriegel: latissimo atque altissimo hier, altissimo dort. Assoziation: Unmöglich, da gibt es kein Durchkommen. Durch die Superlativformen werden die Adjektive latus und altus zusätzlich gelängt – neben der Semantik der Wörter erweist sich ihre Länge als bildhafte Darstellung der Unüberwindlichkeit.
Die dritte Grenze leistet den Expansionsgelüsten der Helvetier deutlich weniger Widerstand: Kein sperriges Adjektiv steht entgegen, schon gar kein Superlativ. Klar, dass die Helvetier es über die Route Genfer See/Rhône versuchen werden. Und wie man das als römischer Leser zu beurteilen hat, wird latent gleich mitgeliefert: provincia nostra, „unsere Provinz“, emotionalisiert zumal in Verbindung mit einem als kriegerisch beschriebenen Barbarenstamm: Alarmstufe Rot! Da braut sich Konfliktpotenzial zusammen, da droht Roms Herrschaftsgebiet Gefahr. Kann das friedlich abgehen? Werden die Helvetier nur um einen Durchmarschkorridor bitten, um die römische Provinz auf dem Weg zu neuen Wohnsitzen friedlich zu durchqueren? Die Antwort darauf findet sich einen Satz weiter: Caesar spricht von homines bellandi cupidi, „kriegslüsternen Menschen“.
Das Ganze ist auch schon eine Einstimmung auf das Problem der „Kriegsschuldfrage“. Aber wieso „Problem“? Die Sachlage ist doch sonnenklar. Sollte es zur kriegerischen Auseinandersetzung kommen, so tragen selbstverständlich die Helvetier die Verantwortung dafür. Sie sind expansiv, gewalttätig und lassen continentia vermissen. Die römische Provinz – nein: „unsere Provinz“, sagt der sonst distanziert in der dritten Person schreibende Autor – ist höchst gefährdet. Und der Leser kann nur hoffen, dass der zuständige Provinzstatthalter alles unternehmen wird, um diese Gefahr abzuwehren. Der heißt Caesar und will natürlich alles in seiner Macht Stehende tun, um einen militärischen Konflikt zu vermeiden, von einem Angriffskrieg ganz zu schweigen. Aber was soll er tun, wenn ihm der Konflikt aufgezwungen wird? Drei Superlative – latissimo und zweimal altissimo – reichen im Prinzip aus, um Caesar vor dem Vorwurf zu schützen, er habe einen unnötigen Krieg vom Zaun gebrochen.