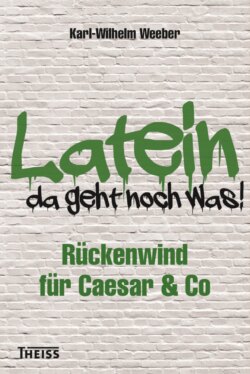Читать книгу Latein - da geht noch was! - Karl-Wilhelm Weeber - Страница 54
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Römische Tüchtigkeit als Vorstufe der Industrialisierung – Wie Caesar in die Schule kam
ОглавлениеAn Selbstbewusstsein gebrach es unserem Feldherrn nicht, weder an persönlichem noch an nationalem. Caesar verkörpert römische Mentalität, und er macht keinen Hehl daraus, dass er sie für vorbildlich und für eine gute Grundlage und Begründung der römischen Weltherrschaft hält. Die Römer sind tüchtiger und fähiger als die „Barbaren“, sie sind zivilisierter und verhalten sich rationaler. Das scheint auf jeder zweiten Seite des Bellum Gallicum auf. Caesar klopft seinem eigenen Volk anerkennend auf die Schulter. Dergleichen liest der römische Senator gern, aber Caesar meint es auch so. Analyse und Empirie einerseits und Schmeichelei andererseits sind nicht konträr, sondern deckungsgleich. Die Beschreibung kollektiver römischer Leistungsfähigkeit ist bereits Schmeichelei. Aber man wird ja wohl noch die Wahrheit sagen dürfen …
Elemente dieser „Wahrheit“ sind Schnelligkeit und Umsicht, Effizienz und Disziplin, Koordination und Rationalität, Erfolgsorientierung und Planung, Anstrengung und Entschlossenheit, Zähigkeit und überlegter Mitteleinsatz. Caesar drückt ständig aufs Tempo; celerius omnium opinione, „schneller, als alle gedacht hätten“, ist eine beliebte Redewendung bei ihm; statim, confestim und subito sind beliebte Adverbien: „sofort!“ Die Dinge werden zunächst durchdacht, dann aber konsequent umgesetzt: imperare und iubere, „befehlen“, sind selbstverständliche Methoden dieser Umsetzung – aber der Macher Caesar tritt erst in Aktion, wenn er einen nachvollziehbaren und möglichst nachhaltigen Plan entwickelt hat. In diesem Punkt unterscheiden sich die Römer und ihr Feldherr am stärksten von den „Barbaren“ und deren Anführern. Die sind zwar auch mutig, kampferprobt und einsatzbereit, ihr Manko aber ist ihre temeritas, „Unbesonnenheit“, „Planlosigkeit“, „Draufgängertum“. Sie handeln blindlings-emotional, spontan und aufs Geratewohl. Das mag bei der einen oder anderen Schlacht gut gehen, den Krieg aber gewinnen die Römer.
Die Römer stehen mit ihren Werten, Tugenden und Zielen in gewisser Weise am Anfang einer westlichen Tradition der Tüchtigkeit. Insbesondere seit dem Zeitalter der Industrialisierung erfreuen sich römische Dispositionen und Haltungen hoher Wertschätzung. Schnell und effizient sein, alle verfügbaren Mittel zielstrebig einsetzen, den Blick auf den Erfolg gerichtet halten – das sind Grundlagen, auf die industria, „Fleiß“, aufbaut und die eine Produktivität im Gefolge haben, deren Gesamtheit ebenfalls als industria beschrieben werden kann. „Industrialisierung“ ist mentalitätsgeschichtlich gesehen nicht zufällig ein lateinstämmiges Wort.
Ebenso wenig ist es ein Zufall, dass Caesar in ebendieser Epoche der beginnenden Industrialisierung als Schulautor Karriere machte. Da waren ja all die „Tugenden“ versammelt, die die neue Zeit brauchte. Und da konnte es nicht schaden, sie der künftigen Elite in Wirtschaft, Verwaltung, Militär, Bildungswesen und Klerus mittels der Lektüre eines Klassikers mit auf den Weg zu geben. Haltungen und Mentalitäten, mit denen Caesar und seine Römer erfolgreich gewesen waren, wiesen den Weg auch zum Erfolg in der Neuzeit, zu neuartigen Erfolgen.
Inwieweit spiegelt sich unsere heutige Mentalität noch oder schon in Caesars Bellum Gallicum? Wo gibt es Parallelen, wo Diskrepanzen? Auch das ist ein ebenso fruchtbarer wie anspruchsvoller Interpretationsansatz, der schlaglichtartig zeigt, wie aktuell dieser Text sein kann. Peter Wülfing hat Caesars Bellum Gallicum einen „Grundtext europäischen Selbstverständnisses“ genannt. Das ist er in mancher Hinsicht; man kann vieles an und aus ihm lernen – auch über sich selbst. Vielleicht ist das auch eine Ermunterung für ältere Semester, die ihren Lateinunterricht längst hinter sich haben, mal wieder zum Bellum Gallicum zu greifen und es mal mit anderen Augen als nur im Hinblick auf ablativi absoluti und indirekte Rede zu lesen. Sie werden erstaunt sein, welch intellektuelles Vergnügen die viel geschmähte Caesar-Lektüre bereiten kann!
Die Römer haben es sich mit ihrer Herrschaftsideologie nicht gar so leicht gemacht, wie manchmal behauptet wird. Gewiss, sie sahen sich als das Volk, das den Göttern besonders folgsam war und das deshalb von den Göttern mit der Weltherrschaft belohnt wurde. Diese Ursache-Folge-Theorie birgt immer die Gefahr des Zirkelschlusses in sich. Könnte es nicht auch umgekehrt so sein, dass man erst ein Weltreich eroberte und das dann als Ergebnis besonderer Religiosität bzw. pietas („Pflichtgefühl“) deutete? Bei Caesar jedenfalls bleiben die Götter meist aus dem Spiel – nicht völlig, aber sie halten sich doch bemerkenswert im Hintergrund; sicher auch, weil damit der Vordergrund für andere Akteure und besonders für den einen Akteur frei bleibt. Caesar legitimiert Roms Berufung zur Herrschaft rationaler. Er zeigt Roms Superiorität auf, indem er die vorhin erwähnten römischen Mentalitäten und „Tugenden“ an konkreten Beispielen illustriert. Im Grunde ist das gesamte Bellum Gallicum eine Reihung solcher exempla, so dass man es auch als Lehrschrift lesen kann. Der Autor Caesar belehrt seine Leser durch Darstellung jener Taten, mit denen der Feldherr Caesar Freund und Feind belehrt hat – vor allem aber Feind.