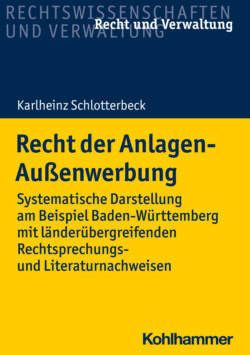Читать книгу Recht der Anlagen-Außenwerbung - Karlheinz Schlotterbeck - Страница 5
Vorwort
ОглавлениеUnter „Außenwerbung“ ist die (allgemein sichtbare) Werbung (Propaganda; Reklame) aller Art im öffentlichen Verkehrs- (Straßen-) Raum zu verstehen, die branchenüblich „Out-of-Home Media“ (OOH), auch „Outdoor Media“, bezeichnet wird. Außenwerbung kommt in verschiedenartigen Formen vor. Sie reicht von der einfachen Plakat-Werbung bis hin zur stark zunehmenden sog. „Digital Out-of-Home“ (DOOH) über Bildschirme, energiesparende LED-Flächen1 und Projektionen im öffentlichen Raum, die, von Computern gesteuert und vernetzt („online“), Werbung ausstrahlen.2 Und sie reicht vom einfachen „Nasenschild“, etwa an der Stätte der eigenen Leistung eines Einzelhandelbetriebes, bis hin zum sog. BlowUp-Poster, einem Riesenposter im sog. urbanen Raum, das Formate von 120 m2 (10 m × 12 m), 144 m2 (12 m × 12 m) oder sogar 225 m2 (15 m × 15 m) aufweisen kann. Außenwerbung kann Eigenwerbung oder – dies vor allem – Fremdwerbung sein. Sie kann gewerblich, handwerklich, beruflich, gemeinnützig, religiös, politisch sein.
Außenwerbung ist für eine breite interessierte Öffentlichkeit gedacht. Sie wartet in einer die Aufmerksamkeit lenkenden Weise dort, wo eine Vielzahl von ansprechbaren Menschen als sog. Rezipienten (Werbungsempfänger) unterwegs ist. Sie ist vor allem für die (gewinnorientierte) Wirtschaft als Teil der sog. kommerziellen Kommunikation von hervorgehobener Bedeutung. Kommerzielle Kommunikation hat jede Form der Kommunikation zum Inhalt, welche der unmittelbaren oder mittelbaren Förderung des Absatzes von Waren, Dienstleistungen oder des Erscheinungsbildes eines Unternehmens, einer sonstigen Organisation oder einer natürlichen Person dient, die eine Tätigkeit im Handel, Gewerbe, Handwerk oder einen freien Beruf als Arzt, Rechtsanwalt, Steuerberater, Architekt u. Ä. m. ausübt.
Außenwerbung tritt neuerdings auch als hochwertige und in optisch-bauästhetischer Hinsicht ansprechende Stadtmöblierung im öffentlichen Verkehrsraum auf; Stadtmöbel können allein für Werbezwecke geschaffen werden. Dies belegen beispielhaft die klassischen City-Light-Poster (CLP), City-Light-Säulen (CLS; Litfaß-Säulen), City-Light-Boards (CLB), die urbanen BlowUp- (Riesen-) Poster sowie die Wartehallen und City-Toiletten mit integrierten Werbeflächen, die Recycling-Behälter mit hinterleuchteter Plakatwerbung, auch die Stadtinformationsanlagen.
Die lokalen Werberechte Privater auf öffentlichem Grund und Boden (Stadtmöblierungsrechte) werden von den Städten und von den Gemeinden zunehmend durch (wirksame) Verwaltungsverträge (§§ 54 Satz 2 und 56 I LVwVfG; sog. Werbe-, Sondernutzungsverträge) und vergaberechtlich durch sog. Dienstleistungskonzessionen an private Werbeunternehmen vergeben (Text Rn 239 ff.). So bietet z. B. die bundesweit bekannte Firma Wall GmbH,3 ein deutsches (Filial-) Unternehmen der französischen JCDecaux SA Gruppe4 mit Sitz in Berlin, den Städten und Gemeinden im Rahmen von Verträgen individuell konzipierte Stadtmöbel an, die sie kostenfrei installiert, reinigt und wartet („Alles-aus-einer-Hand-“ System). Das Unternehmen refinanziert die kostenfreien Produkte und Dienstleistungen über die Vermarktung der in die Stadtmöbel integrierten Werbeflächen. Darüber hinaus werden die Städte und Gemeinden an den Einnahmen der Außenwerbung beteiligt.
Außenwerbung kann auch – und dies nicht selten – in der Form des sog. wilden Plakatierens vorkommen, nämlich durch unbefugtes Anbringen von Plakaten auf dafür nicht vorgesehenen Flächen (Werbung in Form von bloßen Anschlägen). Diese Art von Werbung gehört bewusst nicht zu den Werbeanlagen im Sinne der LBO (§ 2 IX 3 Nr. 2 LBO). Sie ist dem allgemeinen Polizeirecht vorbehalten. Insoweit sind die Ortspolizeibehörden der Gemeinden in Baden-Württemberg ermächtigt, durch Polizeiverordnungen (§ 17 PolG 2020)5 und ggf. durch Einzelmaßnahmen (§§ 1 und 3 PolG 2020) dagegen einzuschreiten (Text Rn 39). Im Übrigen kann sich wildes Plakatieren strafrechtlich als Sachbeschädigung wegen unbefugter Veränderung des Erscheinungsbildes einer fremden Sache erweisen (§ 303 II StGB), was ordnungsrechtlich mit einer Störung der öffentlichen Sicherheit (§ 1 PolG 2020) verbunden ist. Und es kann zivilrechtlich Unterlassungs- bzw. Beseitigungsansprüche (§ 1004 BGB) begründen (vgl. Text Rn 40).
Eine besondere Art von Werbung ist das branchenüblich so bezeichnete Guerilla-Marketing vor allem als Marketing-Mix, dessen geistiger Vater der US-amerikanischen Marketing-Experte Jay C. Levinson6 ist. Damit werden ungewöhnliche Vermarktungsaktionen bezeichnet, die mit geringem Mitteleinsatz eine große (Werbe-) Wirkung versprechen (vgl. Text Rn 47). Es gibt darüber hinaus unterschiedliche Guerilla-Marketing-Taktiken, die von Mund-Propaganda bis hin zur Schleichwerbung reichen.
Neuartig ist das Air Touch Window, eine interaktive Schaufensterwerbung, die branchenüblich zur Out-of-Home Media (Outdoor Media) und damit zur Außenwerbung gerechnet wird (Text Rn 44). Neuartig sind auch die gelegentlich vorkommenden sog. Moving Boards, die ausschließlich zu verkehrsfremden (d. h. Werbungs-) Zwecken eingesetzt werden und die deshalb als straßen- und wegerechtliche Sondernutzung zu qualifizieren sind (Text Rn 233).
Das Recht der Außenwerbung ist – und dies vor allem – Bestandteil des öffentlichen Baurechtes. Das öffentliche Baurecht zerfällt in das (bundesrechtliche) allgemeine und besondere Städtebaurecht (Text Rn 109 ff.) einerseits und in das (landesrechtliche) Bauordnungsrecht (Text Rn 13 ff.) andererseits.7 Es wird ergänzt durch das sog. Baunebenrecht (Text Rn. 91 ff.). Außenwerbung ist deshalb nicht und nicht überall schrankenlos möglich und zulässig. Sie hat mitunter unterschiedliche und verschiedenartige rechtliche (Zulässigkeit-, Zulassungs-) Hürden zu überwinden. Diese Hürden haben sich als (hinderliches) „Fachrecht“ (Text Rn 13 ff.) niedergeschlagen
– in verschiedenartigen (Bundes-, Landes-) Gesetzen8 und Rechtsverordnungen,
Achtung
Soweit es hier um Landesrecht geht, wird beispielhaft auf das baden-württembergische Landesrecht Bezug genommen, das Parallelen zu entspr. Vorschriften in anderen Bundesländern aufweist; die zitierte obergerichtliche Rspr ist deshalb und insoweit nicht auf die Rspr in Baden-Württemberg beschränkt. Auch die angefügten Literaturnachweise sind länderneutral.
– in bestehenden (rechtswirksamen) städtebaurechtlichen (Administrativ-) Satzungen der Städte und Gemeinden, namentlich in Bebauungsplänen als Festsetzungen (§§ 9 und 30 BauGB), in Vorschriften aufgrund von Sanierungssatzungen (§§ 142 I 1 und 144 I 1 BauGB) und aufgrund von Erhaltungssatzungen (§§ 172 I 1, I 2, III und 173 BauGB) sowie in bauordnungsrechtlichen Örtlichen Bauvorschriften der Gemeinden (ÖBauV; § 74 I 1 Nr. 1, I 1 Nr. 2 LBO) und in denkmalrechtlichen Gesamtanlagen- (Ensemble-) Schutzsatzungen der Gemeinden (§ 19 DSchG).
Das Recht der Außenwerbung kann deshalb durchaus als fachübergreifendes Querschnittsrecht (Text Rn 9 f.) bezeichnet werden.
Das dem allgemeinen Städtebaurecht angehörende flächenbezogene sog. Bebauungsrecht (§§ 29 bis 38 BauGB, BauNVO; Text Rn 109 ff.) enthält materielle Anforderungen auch an bauliche Anlagen der Außenwerbung (bauliche Werbeanlagen), die als eigenständige bebauungsrechtliche Vorhaben (§ 29 I BauGB)9 zu betrachten sind und die als Vorhaben vor allem an den hinderlichen Festsetzungen eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB), an Beeinträchtigungen des Ortsbildes in den sog. faktischen Bebauungsbereichen (§ 34 I 2 BauGB)10 und als sonstige Vorhaben an beeinträchtigten öffentlichen Belangen im Außenbereich (§ 35 II, III, V 1 BauGB) scheitern können.
Das Bebauungsrecht wird – in negativer Hinsicht – ergänzt sowohl durch das Veränderungssperrenrecht (§§ 14, 16 bis 18 BauGB, Text Rn 147 ff.)), das zum Erlass von (Gemeinde-) Satzungen ermächtigt, als auch durch das Zurückstellungsrecht (§ 15 I 1, III BauGB; §§ 9 und 22 LVwVfG), die beide (alternativ) zur Sicherung einer bestimmten, bereits hinreichend konkretisierten und zulässigen gemeindlichen Bauleitplanung ab dem wirksam gefassten und bekannt gemachten Planeinleitungsbeschluss (§ 2 I 2 BauGB) – zeitlich beschränkt – vorhabenhindernd eingesetzt werden können. Und es kann bei Bedarf darüber hinaus ergänzt werden durch Satzungen der Gemeinden insb. über förmlich festgelegte Sanierungsgebiete (§ 142 I BauGB; Text Rn 159 ff.) bzw. über Erhaltungsgebiete (§ 172 BauGB; Text Rn 168 ff.), die dem besonderen Städtebaurecht zugeordnet sind und die sich gleichfalls vorhabenhindernd auswirken können.
Das (anlagen-, objektbezogene) Bauordnungsrecht (Text Rn 13 ff.) enthält sowohl formell-rechtliche als auch materiell-rechtliche Anforderungen an Anlagen der Außenwerbung (Werbeanlagen), die in den Bauordnungen der einzelnen Bundesländer im Grundsatz identische inhaltliche Aussagen treffen, zumal sie an der ständig aktualisierten Musterbauordnung (MBO) der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)11 ausgerichtet sind. Die MBO selbst ist kein Gesetz und hat auch sonst keine rechtlichen Auswirkungen. Sie ist lediglich als Vorschlag und Anregung gedacht; sie soll dazu dienen, die kraft Verfassung dem Landesrecht unterliegenden Bauordnungen der einzelnen Bundesländer (vgl. Art. 72 I GG) zu vereinheitlichen, was bisher nur in Ansätzen gelungen ist (zu Werbeanlagen vgl. § 10 MBO). Die einzelnen Bauordnungen enthalten dann auch im Wesentlichen inhaltlich und strukturell übereinstimmende Vorschriften; sie unterscheiden sich nur in mehr oder weniger deutlichen Einzelheiten.12 Im Übrigen ist das öffentlichen Baurecht insgesamt offen, rechtsverbindliche Regelungen über Werbeanlagen in anderen Rechts- und Fachgebieten, vor allem natur- und landschaftsschutz- sowie denkmalschutz- und straßenrechtliche Regelungen ergänzend bzw. aufdrängend hinzunehmen (vgl. § 29 II BauGB).
Das Recht der Außenwerbung ist nicht nur in rechtlicher Hinsicht, und zwar vor allem wegen der vielfach vorkommenden unbestimmten und auslegungsbedürftigen Rechtsbegriffe (z. B. Begriffe, wie Verunstaltungen als handgreifliche Negation des Schönen,13 erhebliche Beeinträchtigungen eines Erscheinungsbildes), sondern auch aus tatsächlicher (beweiserheblicher) Sicht der Dinge geeignet, (entscheidungserhebliche) Zweifelsfragen aufzuwerfen. Eine fast unübersehbare Zahl an (verwaltungs-) gerichtlichen Entscheidungen aller Instanzen in allen Bundesländern belegen diesen nicht ganz einfach zu bewältigenden Rechtsbefund.
Dieses Buch ist das mediale Ergebnis von richterlich gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnissen sowie von – über einen langen Zeitraum – häufig wiederkehrenden Fachveranstaltungen für die Aus- und für die Fortbildung von Praktikern vor allen in Baden-Württemberg. Es soll allen denjenigen, die es mit dem „Recht der Anlagen-Außenwerbung“ gewerblich, handwerklich, beruflich, beratend, behördlich, privat oder in sonstiger Weise – und dies nicht nur in Baden-Württemberg – zu tun haben, zum Nutzen gereichen. Dazu soll die systematische Darstellung dieses umfassenden und vielschichtigen Querschnittrechtsgebietes als Orientierungshilfe in der hier geboten gedrängten Darstellung beitragen.14
Der Autor ist für alle weiterführenden Hinweise sowie für Fragen und Antworten aus der praktischen Arbeit dankbar und – dies vor allem – kritischen Anregungen gegenüber stets offen. Bitte wenden Sie sich an:
W. Kohlhammer GmbH
Lektorat Recht und Verwaltung
Heßbrühlstr. 69
70565 Stuttgart
E-Mail: recht@kohlhammer.de
Im Januar 2021
Karlheinz Schlotterbeck