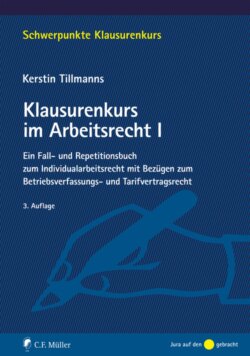Читать книгу Klausurenkurs im Arbeitsrecht I - Kerstin Tillmanns - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. Teil Allgemeiner Teil › I. Hinweise zur Klausurtechnik
I. Hinweise zur Klausurtechnik
1
Studierende in Examensnähe haben bereits eine gewisse Routine im Anfertigen von Klausuren gewonnen. Nicht immer besteht daher die Bereitschaft, sich noch einmal mit der Technik des Klausurschreibens auseinander zu setzen. Das gilt es indes zu überdenken. Viele Studierende erwerben ihre Kenntnisse über die Klausurtechnik ausschließlich von AG-Leitern, später werden ggf. Hinweise von privaten Repetitoren übernommen. Gerade AG-Leiter verfügen in der Regel auch über die Fähigkeit, die Kenntnisse und insbesondere auch das Engagement zur Wissensvermittlung in diesem Bereich. Diese Wissensvermittlung erfolgt jedoch in einem frühen Stadium des Studiums und geht teilweise bis zum Examen wieder verloren bzw. das Wissen wird nicht mehr den Anforderungen des Examens gemäß vertieft. Schließlich möge der Studierende bedenken, dass die genannten Personenkreise nicht originale Examensklausuren korrigieren und daher nur einen beschränkten Einblick in die Fähigkeiten der Examenskandidaten haben, wie sie sich unter echten Examensbedingungen darstellen.
Wenn sich der Leser (die Leserin) bei der Lektüre der folgenden Hinweise ganz überwiegend langweilt, zeigt dies, dass er schon echter Klausurprofi ist. Das ist gut so. Gerade die wenigen Punkte, die ihm neu sind oder wieder ins Gedächtnis kommen, können ihm jedoch dazu verhelfen, dass die Klausur – und zwar jede folgende Klausur in jedem Rechtsgebiet – 1 bis 2 Punkte besser als die vorherigen ausfällt. Dies sollte den Einsatz lohnen. Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass alle Hinweise aus eigener Korrekturerfahrung stammen, d. h. diese Fehler werden in den Klausuren der Ersten Juristischen Prüfung bzw. in Schwerpunktbereichsklausuren tatsächlich, und zwar nicht nur in Einzelfällen gemacht:
1. Hinweise zur Form
a) Überschreiben Sie die Lösung mit Rechtsgutachten! Schreiben Sie am Ende „Ende der Bearbeitung“!
2
Dies wird von manchen Korrektoren gewünscht, von manchen wird es nicht für erforderlich gehalten. Verschenken Sie keine Zeit, indem Sie in der Klausur darüber nachdenken. Schreiben Sie es einfach hin.
b) Nummerieren Sie die Seiten und schreiben Sie Ihren Namen auf jede Seite!
Klausuren können – insbesondere beim Vergleichen der Lösungen – durcheinander geraten. Sie können so sicherstellen, dass keine Ihrer Seiten einem anderen Kandidaten zugeordnet wird.
c) Schreiben Sie gut leserlich! Gönnen Sie Ihrem Handgelenk und dem Korrektor ein gutes Schreibgerät!
Letzteres ist besonders wichtig, wenn Sie über keine schöne Handschrift verfügen. In diesem Fall sollten Sie zudem gerade am Anfang der Klausur versuchen, möglichst leserlich zu schreiben. Auf diese Weise kann der Korrektor sich in Ihre Schrift „hineinlesen“ und sie besser entziffern, wenn am Ende der Klausur keine Zeit mehr bleibt, auf die Leserlichkeit zu achten.
d) Zitieren Sie das Gesetz richtig! Vergessen Sie nicht die Paragraphenzeichen!
Z. B. § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 1. Alt. 1. Spiegelstrich, alternativ § 1 I 1 Nr. 1, 1. Alt., 1. Spiegelstrich. Wenn Sie statt „Alt.“ den Ausdruck „Variante“ verwenden, kürzen sie diesen mit „Var.“ ab, nicht mit „V“, weil ansonsten eine Verwechslung mit „V“ für die römische Zahl „5“ auftreten kann.
Vergessen Sie das Paragraphenzeichen nicht, auch nicht „§§“, wenn auf zwei oder mehr Paragraphen verwiesen wird. Gerade die jüngere Korrekturerfahrung zeigt, dass auf Paragraphenzeichen gerne (aus Zeitgründen?) verzichtet wird. Der Korrektor wird dafür kein Verständnis zeigen. Gewöhnen Sie sich an, auch in sonstigen Texten, bei Mitschriften usw. immer das Paragraphenzeichen zu verwenden. Wenn dies nicht in „Fleisch und Blut“ übergeht, werden Sie es im Stress der Examensklausur vergessen!
e) Zitieren Sie eine Norm niemals ohne Gesetzesangabe!
Dies ist gerade im Arbeitsrecht bei der Vielfalt der unterschiedlichen Gesetze unverzichtbar. In anderen zivilrechtlichen Klausuren ist der Hinweis, dass alle folgenden Paragraphen, wenn nicht anders benannt, solche des BGB sind, nützlich.
2. Hinweise zur inhaltlichen Abfassung
a) Jede Klausurlösung beginnt mit einem Obersatz!
3
Das gilt grundsätzlich auch für eine Anwaltsklausur; hier können ggf. einige einleitende Sätze erfolgen (vgl. Fall 9). Bei reinen Themenklausuren ist es jedenfalls hilfreich, sich die Frage „Wer könnte was von wem woraus verlangen?“ zu stellen.
b) Beantworten Sie nur die Fallfrage!
Unnötige Ausführungen kosten Zeit und führen zu einer falschen Schwerpunktsetzung.
c) Verwenden Sie weder „da“ noch „weil“! Bleiben Sie im Gutachtenstil!
Das Auge des Korrektors „springt“ auf diese Wörter. Gewöhnen Sie sich an, sie in Klausuren überhaupt nicht zu verwenden.
d) Der Jurist lässt die Sache sprechen!
Schreiben Sie niemals in der ersten Person! Auch Ausdrücke wie m.E. (meines Erachtens) usw. sind unschön und haben allenfalls in wissenschaftlichen Abhandlungen eine Berechtigung. Dass (angeblich) eine herrschende Meinung zu einer bestimmten Streitfrage besteht, ersetzt nicht das inhaltliche Argument.
Das Zitieren anderer Personen mit Namen ist in einer Klausur kaum möglich, da man dann eine entsprechende Fundstelle hinzufügen müsste, die man aber im seltensten Fall im Kopf hat.
e) Verweisen Sie innerhalb Ihrer Klausur auf genaue Gliederungspunkte oder Seiten!
Selbstverständlich gilt es, in der Klausur Wiederholungen zu vermeiden. Der Hinweis „s.o.“ oder Ähnliches ist indes nicht ausreichend. Wenn häufiger Verweisungen erfolgen müssen, bleibt vielleicht keine ausreichende Zeit, die entsprechenden Stellen zu finden. Zeigen Sie dann dem Korrektor, dass Sie die juristische Arbeitstechnik beherrschen, indem Sie beim ersten Mal den Verweis korrekt ausführen. Wenn dann im Folgenden keine Zeit dafür bleibt, wird er Verständnis zeigen, jedenfalls wenn eindeutig ist, worauf Sie verweisen möchten.
f) Verwenden Sie Abkürzungen allenfalls in echter Zeitnot am Klausurende!
Vielfach sind Abkürzungen bei privaten Repetitoren beliebt – für Korrektoren von Examensklausuren gilt das Gegenteil. Der Studierende mag den Eindruck gewinnen, Abkürzungen seien Ausweis einer gewissen „Professionalität“. Das ist nicht der Fall. „Professionell“ ist ein Urteil des BGH. Dort werden Sie keine Abkürzungen finden.
Sehr unschön sind z. B. WE (Willenserklärung), PV (Pflichtverletzung), Vss (Voraussetzungen), SV (Sachverhalt), KggV (K gegen V), SEA (Schadensersatz), ~ (analog).
g) Verweisen Sie in Ihrer Lösung nicht auf den Sachverhalt („Laut Sachverhalt …“)!
Der Verweis auf den Sachverhalt ist auch bei Examenskandidaten noch sehr beliebt. Er ist jedoch überflüssig und kostet Zeit. Der Korrektor kennt den Sachverhalt auswendig. In echter Not, d. h. wenn Sie wirklich meinen, es sei notwendig, den Korrektor auf eine Sachverhaltspassage aufmerksam zu machen, klingt „im vorliegenden Fall“ besser.
Wenn Sie – verständliche – Schwierigkeiten haben, auf diese Floskel zu verzichten, schreiben Sie den Satz hin wie üblich und streichen Sie dann „laut Sachverhalt“ weg. Ihr Satz klingt sofort besser, weil Sie ihm nicht mehr den Stempel „dies ist nur eine Prüfungsklausur“ aufdrücken, sondern die Lösung sich jetzt auch auf einen realen Fall beziehen könnte.
h) Lassen Sie den bestimmten Artikel vor Personenbezeichnungen grundsätzlich weg!
Schreiben Sie statt „Der A hat einen Anspruch gegen den B“ „A hat einen Anspruch gegen B“. Dies spart Zeit und klingt weniger nach der Sprache von Kleinkindern.
i) Lassen Sie vermeintlich „bekräftigende“ Ausdrücke weg!
Vermeiden Sie z. B.:
| – | zweifellos, ohne Zweifel, ohne Frage |
| – | natürlich, selbstverständlich |
| – | unproblematisch |
| – | jedenfalls, auf jeden Fall |
| – | eindeutig |
Diese Ausdrücke sind im harmlosen Fall überflüssig. Häufig aber zeigen sie dem Korrektor, dass Sie Zweifel haben, das Problem jedoch „verdrängt“ wurde. Sie setzen damit ein Signal für eine etwaige Lücke in der Klausurlösung. Wenn Sie Ihre Lösung „bekräftigen“ wollen, verwenden Sie einen apodiktischen Stil.
j) Lassen Sie auch „relativierende“ Ausdrücke weg!
Dies sind z. B.
| – | „wohl“ |
| – | „quasi“ |
Sie machen deutlich, dass Sie sich nicht sicher sind, also das Problem nicht lösen konnten.
3. Beispiel
Falsch:
„Der B hat m.E. unproblematisch einen Anspruch aus § 433 gegen den A, weil der A und der B laut Sachverhalt wohl einen KV (s. o.) geschlossen haben.“
Richtig:
„A und B haben einen Kaufvertrag geschlossen (oben Frage 1, A.I.). Daher hat B gegen A einen Anspruch aus § 433 II BGB .“