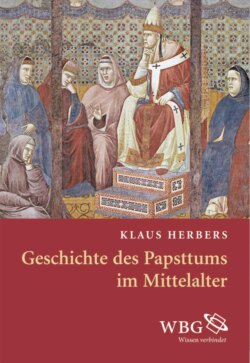Читать книгу Geschichte des Papsttums im Mittelalter - Klaus Herbers - Страница 46
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Gregor IV., das Frankenreich und die pseudo-isidorischen Fälschungen
ОглавлениеDer schon im Herbst 827 gewählte, aber erst nach kaiserlicher Zustimmung im Frühjahr 828 geweihte Gregor IV. hatte von allen Päpsten des 9. Jahrhunderts die Cathedra Petri am längsten inne († 844). Der Liber pontificalis hebt wie bei anderen Päpsten auch bei ihm die Sorge um Bauten und Kirchen der Stadt Rom hervor und bemerkt nur knapp, dass und wie sich der Papst auf Bitten Lothars in die kriegerischen Streitigkeiten zwischen Kaiser Ludwig dem Frommen und seinen Söhnen in der Auseinandersetzung auf dem „Lügenfeld“ bei Colmar 833 einschaltete, was insgesamt zu einem Misserfolg führte.60 Der zunehmenden Bedrohung durch sarazenische Piraten versuchte er dadurch entgegenzutreten, dass er beim römischen Hafen Ostia eine Befestigung anlegen ließ, die später nach seinem Namen Gregoriopolis genannt wurde.61 Diesem Beispiel – das seit Konstantin mit dem kaiserlichen Namen für Konstantinopel grundgelegt war – sollten Leo IV. (civitas leonina und Leopolis) sowie Johannes VIII. (Johannopolis) folgen (siehe unten S. 87).
In Gregors Pontifikatszeit legt die jüngere Forschung inzwischen die Entstehung der pseudo-isidorischen Fälschungen.62 Dieses Werk ist bis heute umstritten, manchen gilt es immer noch als der größte Betrug der Weltgeschichte und als Grundlage für das päpstliche Machtstreben, wie gut aus den Diskussionen auf dem Ersten Vatikanischen Konzil 1870/71 hervorgeht. Der Autorname (Isidor Mercator) ist ein Pseudonym. Die Zusammensteller der Schriften nutzten damit die Autorität einer bekannten Person, Isidors von Sevilla. In diesem Sammelwerk finden sich viele normative Verlautbarungen des Apostolischen Stuhles. Unterscheiden lassen sich vier Hauptteile:
1. die Collectio Hispana Gallica Augustodunensis, eine bearbeitete Rechtssammlung aus dem westgotischen Gallien,
2. die Capitula Angilramni, eine angebliche Sammlung von Rechtssätzen Papst Hadrians I. für Bischof Angilram von Metz († 791),
3. die Kapitulariensammlung des Benedictus Levita,
4. die Dekretalen des Isidor Mercator, die echte sowie größtenteils gefälschte oder verfälschte Konzilsbestimmungen und päpstliche Dekretalen von der Frühzeit bis zu Gregor dem Großen († 604) enthalten.
Die Texte mischen Echtes und Falsches, kürzen, erweitern oder spitzen zu. Vor allem der vierte Teil, der anfangs im Frankenreich, später in Rom rezipiert wurde, ist für eine Papstgeschichte wichtig. Wenn auch nicht ein Ziel, so scheint zumindest eine Folge gewesen zu sein, die Stellung der Bischöfe zu stärken. Sie wurden durch manche Bestimmungen dem Zugriff der Erzbischöfe entzogen und mussten in den eigenen Diözesen nicht mehr die Konkurrenz der Chorbischöfe (Land- bzw. Hilfsbischöfe) fürchten. In diesem Zusammenhang gewann der Papst als wichtige Appellationsinstanz an Gewicht, denn eine der zentralen Botschaften bestand darin, dass nicht die Erzbischöfe, sondern der Papst – entsprechend den Bestimmungen des Konzils von Sardika (343) – wichtige Angelegenheiten (causae maiores) entscheiden sollte, wie zum Beispiel zwei Auszüge verdeutlichen:
Papst Anaklet, 1, 17: „Auf Befehl des Erlösers (selbst) haben die Apostel angeordnet, daß in allen Sachen von größerer Wichtigkeit und Schwierigkeit die Bischöfe an den apostolischen Stuhl appellieren sollen […]“ Felix II., 2, 13: „Zu ihm (gemeint ist Papst Julius I., 337–352; die Stelle bezieht sich auf die Synode zu Sardica 343) als dem Haupt der ganzen Welt habt ihr eure Zuflucht genommen, wie es immer diesem heiligen Stuhl (gemeint ist der römische Stuhl) zugekommen ist.“63
Mit Zielrichtung und Überlieferung hängen die vielfachen Thesen und Vermutungen zur Entstehung zusammen. Lange Zeit vermutete man hinter dem Werk allgemein den Kreis von Klerikern, der von Erzbischof Ebo von Reims (816–835; 840–841) geweiht, aber von dessen Nachfolger Hinkmar (845–882) zurückgesetzt worden war. Inzwischen haben neue Handschriftenstudien ergeben, dass wohl Corbie die Heimat der Zusammensteller war und dass Paschasius Radbertus an deren Spitze gestanden haben könnte. Dies entsprach politischen Entwicklungen im Frankenreich um 835, die zu einer Neutralisierung kirchlicher, teilweise für die Reichseinheit eintretender Reformkreise geführt hatten.64
Neben der Frage nach den Urhebern bleibt diejenige nach den Wirkungen. Anfangs wurden vielleicht einige Gedanken oder Passagen der Sammlung tagespolitisch verwendet. Schon Florus von Lyon 838 und wenig später Hinkmar von Reims haben die Texte oder Teile der Sammlung erwähnt bzw. gekannt.65 Rothad von Soissons soll die pseudoisidorischen Dekretalen 864 nach Rom gebracht haben; 871 wurde in päpstlicher Umgebung vielleicht erstmals aus der Sammlung zitiert.66 Trotzdem wurden die dort niedergelegten Rechtssätze zugunsten des Papsttums und päpstlicher Vorrechte in größerem Maße erst ab dem 11. Jahrhundert genutzt. Weil Entstehungsanlass und Wirkungen zu unterscheiden sind, ist die Sammlung kaum (wie zuweilen geschehen) einfach als Zeugnis päpstlichen Machtstrebens zu bezeichnen. Auch diente sie nicht als Hebel, um später das „Papalsystem“ in Gang zu setzen, denn Schriften wirken vor allem dann, wenn ein Umfeld zur Rezeption bereitet ist. Insofern boten die zusammengestellten Dekretalen zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten, waren aber nicht selbst der Motor für päpstliche Machtansprüche.