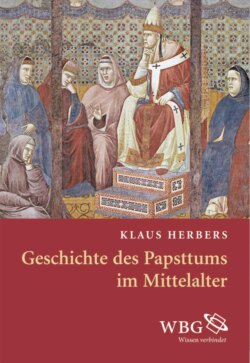Читать книгу Geschichte des Papsttums im Mittelalter - Klaus Herbers - Страница 47
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Macht und Ohnmacht der Päpste im zerfallenden Karolingerreich
ОглавлениеDie nach dem Vertrag von Verdun (843) vollzogenen Teilungen im Karolingerreich wirkten auch auf die Papstgeschichte zurück. Vorerst blieb das Kaisertum weitgehend mit dem regnum Italiae verbunden; dies betraf zunächst noch die Karolinger wie Lothar I., Ludwig II., Karl den Kahlen und Karl III., sodann jedoch auch eher in Italien lokal agierende Herrscher wie die Spoletiner (Wido, Lambert). Diese Entwicklung brachte es mit sich, dass die italischen Probleme zunehmend ohne Unterstützung der transalpinischen Teilreiche gelöst werden mussten, zum Beispiel die Bedrohung durch die Sarazenen. Diese Gefahr für Rom und das Patrimonium Petri beschäftigte Leo IV. (847–855), nachdem die Sarazenen 846 erstmals St. Peter geplündert hatten. Unter Johannes VIII. (872–882) wurde der Druck der Sarazenen erneut massiv. Der meist als überragende Gestalt des 9. Jahrhunderts bezeichnete Papst Nikolaus I. (859–867) führte das Papsttum zu einer relativ starken Unabhängigkeit, indem er in byzantinischen Auseinandersetzungen um den Patriarchen Photios Stellung bezog und auch für verschiedene Streitfälle des Westfrankenreiches Entscheidungsgewalt beanspruchte. Vor allem in der Frage nach der Gültigkeit der Ehe Lothars II. entschied er indirekt über das Ende des lotharingischen Mittelreiches (869) mit. Erst nach Johannes VIII., dessen Pontifikat aufgrund einer überlieferten Teilabschrift seines Registers als der mit am besten dokumentierte des 9. Jahrhunderts bezeichnet werden kann, begann eine Zeit relativ kurzer Pontifikate, die eine neue Phase einleiteten.