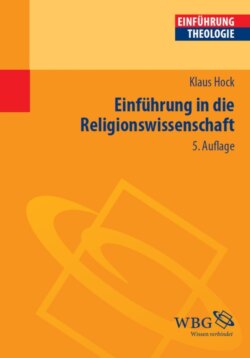Читать книгу Einführung in die Religionswissenschaft - Klaus Hock - Страница 10
2. Zur Geschichte der Religionsgeschichte
ОглавлениеDie geschichtliche Betrachtung der Religionen beginnt selbstverständlich nicht erst zu dem Zeitpunkt, als sich die Religionsgeschichte als wissenschaftliche Disziplin formierte. Ihre Anfänge reichen vielmehr bis weit in die vorchristliche Zeit zurück. „Religionsgeschichte“ kam damals allerdings nicht als eigenständiger Gegenstand in den Blick, sondern wurde in Gestalt philosophischer oder historischer Darstellungen thematisiert.
die Anfänge der Religionsgeschichte
Für die frühe Entwicklung der Religionsgeschichte als wissenschaftlicher Disziplin war insbesondere das 1780 posthum veröffentlichte Werk von Charles de Brosses (1709–1777), Du culte des dieux fetiches ou parallèle de l’ancienne religion de l’Égypte avec la religion actuelle de Nigritie, von Bedeutung. In dieser Untersuchung entwickelt der Autor auf der Grundlage des religionsgeschichtlichen Vergleichs die Theorie vom „Fetischismus“: Die Verehrung besonderer Objekte stelle die älteste Form der Religion dar. Für die Bezeichnung dieser „besonderen Objekte“ verwendet de Brosses das portugiesische Wort feitiço (vom Lateinischen facticius, „künstlich hergestellt“). Mit seiner Untersuchung verschaffte er nicht nur dem Begriff „Fetisch“ einen festen Platz in der religionsgeschichtlichen Terminologie, sondern legte auch die Grundlage für das insbesondere im 19.Jh. weithin verbreitete Interesse an der Frage, was denn die „Urform“ der Religion sei. Wenige Jahrzehnte nach de Brosses’ Veröffentlichung kann sich die Religionsgeschichte nach und nach als wissenschaftliche Disziplin konstituieren.
Die Historische Religionswissenschaft ist also ein Kind des 19.Jahrhunderts, einer Zeit, in der die „Entdeckung der Religionsgeschichte“ (H. Kippenberg) die Entdeckung der Dimension der Geschichte spiegelt. Dabei gibt es zwei bedeutsame Voraussetzungen für das Aufkommen der Religionsgeschichte und für ihre baldige Verfestigung als akademische Disziplin: Zum einen hatte sich inzwischen der Religionsbegriff von seiner christlich-dogmatischen Identifikation mit dem Christentum befreit, zum anderen wird Religion nun als konkrete historische Größe aufgefasst; anstelle abstrakter Spekulationen über „die Religion“ soll mit der geschichtlichen Analyse die „tatsächliche“ Religionsgeschichte rekonstruiert werden – die Geschichte der Religionen, „wie sie wirklich gewesen ist“. Religionsgeschichte und Religionswissenschaft fallen in eins.
Weitere Faktoren kommen hinzu: die Entstehung der modernen Sprachwissenschaften, die sich unter anderem dem Interesse der Romantiker an fremden Literaturen und Kulturen verdankt, die aufstrebende historisch-kritische Bibelwissenschaft innerhalb der theologischen Forschung und das Interesse an archäologischen Funden.
die modernen Sprachwissenschaften
Ein Schlüsselereignis auf dem Weg zur Entstehung der Religionsgeschichte als wissenschaftlicher Disziplin ist die 1771 erfolgte Veröffentlichung des Avesta in französischer Sprache durch Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron (1731–1805). Die Publikation dieses Textes gab das Startsignal für weitere Übersetzungen religionsgeschichtlicher Texte in europäische Sprachen, die Begeisterung der Romantiker für den Orient tat ein Übriges. In diesem Zusammenhang wäre etwa Friedrich Schlegels (1772–1829) 1808 erschienene Abhandlung Über die Sprache und Weisheit der Indier zu erwähnen. Bemerkenswert ist vor allem die Übersetzertätigkeit Friedrich Rückerts (1788–1866), der sich in seiner Koranübersetzung besonders darum bemüht, die ästhetischen Besonderheiten des arabischen Originals auch in der deutschen Übertragung zum Ausdruck zu bringen.
Die Entwicklung der Philologie und der Vergleichenden Sprachwissenschaft bereiten weiteren Studien den Boden, die vornehmlich um die sprachliche Erschließung religionsgeschichtlicher Quellen bemüht sind. Höhepunkt dieser Entwicklung ist die seit 1879 erscheinende, insgesamt 49 Bände umfassende, von F. Max Müller (1823–1900) begründete und herausgegebene Reihe Sacred Books of the East. Damit ist zugleich die Grundlage für eine umfassende Aufbereitung und Übersetzung religionsgeschichtlicher Quellentexte gelegt. Sie findet unter anderem in der Arbeit des englischen Orientalisten T. W. Rhys Davids (1843–1922) und der von ihm gegründeten Pali Text Society mit der Literatur des Theravâda-Buddhismus und noch später im Werk von Daihatsu T. Suzuki (1870–1966) mit dem Schriftgut des Zen-Buddhismus ihre Fortsetzung. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts werden auch die Texte des Zoroastrismus erschlossen und herausgegeben. Kompilationen wie das Corpus Inscriptionum Latinarum oder das Corpus Inscriptionum Graecarum sowie die Publikation germanischer, keltischer u.a. nordeuropäischer Texte tragen zur religionsgeschichtlichen Erschließung von Quellen aus anderen geographischen und historischen Kontexten bei.
die historisch-kritischen Bibelwissenschaften
Ein weiteres bedeutsames Stichdatum ist die sog. Ägypten-Expedition Napoleon Bonapartes, die zur militärischen Eroberung und wissenschaftlichen Erforschung des Landes führt. In ihrem Gefolge bringt die Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen und der Keilschriften des Zweistromlandes ebenso wie die historisch-kritische Exegese in den Bibelwissenschaften einen bedeutenden Innovationsschub für die junge Disziplin der Religionsgeschichte. Insbesondere die Erschließung zunächst der altarabischen Quellen durch Gelehrte wie Heinrich Georg August Ewald (1803–1875) und Julius Wellhausen (1844–1918), dann der mesopotamischen Schriften durch George Smith (1840–76) oder Friedrich Delitzsch (1850–1922) gibt um die Wende vom 19. zum 20.Jh. den Anstoß zu diversen Schulbildungen: Die sog. Myth-and-Ritual-School – im Deutschen auch als „Kultgeschichtliche Schule“ bekannt –, die sich ausdrücklich gegen Theorien eines religionsgeschichtlichen Evolutionismus wendet (s.u. S. 38ff.), ist in zwei Spielarten vertreten: einer durch Vilhelm Peter Groenbech (1873– 1918) angeregten und durch Sigmund Mowinckel (1884–1965) fortgeführten skandinavischen Richtung, der u.a. auch Geo Widengren (1907–1996) angehört, und einer britischen, deren prominentester Vertreter Samuel H. Hooke (1874–1968) war. Der britische Zweig greift die von Friedrich Delitzsch formulierte These des „Panbabylonismus“ auf, d.h. die Annahme einer im Alten Orient existierenden Einheitskultur, und entwickelt darauf aufbauend die Theorie, es habe in der gesamten Region ein einheitliches Muster (pattern) an Riten und diese begleitenden Mythen gegeben, in denen die Jahreszyklen kultisch begangen wurden. Auch der skandinavische Zweig – die sog. „Uppsala-Schule“ – nimmt ein einheitliches Kultschema an und richtet sein Interesse dabei auf die sog. „Königsideologie“ als Bindeglied zwischen den rituellen Ausformungen in den verschiedenen Regionen des Alten Orients.
Die u.a. vom Alttestamentler Hermann Gunkel (1862–1932) mitbegründete Religionsgeschichtliche Schule profiliert sich in einer Phase der Blütezeit religionsgeschichtlicher Forschung überhaupt und sorgt zu Beginn des 20. Jahrhunderts innerhalb der Theologie für Aufsehen: Sie setzt die gegen Ende des 19. Jahrhunderts erarbeiteten Ergebnisse der historisch-kritischen Bibelexegese voraus und radikalisiert sie, indem die biblischen Texte nicht nur ganz konsequent in den Kontext ihrer außerbiblischen Umwelt gestellt, sondern in radikaler Weise als geschichtlich gewachsene Texte begriffen werden, als Texte, die selbst „Geschichte“ sind: Kult und Gemeinde des frühen Christentums beispielsweise erweisen sich als Kontext und Quelle großer Teile des Neuen Testaments. Nach dem relativ frühen Tod mehrerer ihrer führenden Vertreter (Wilhelm Bousset, 1865–1920; Hugo Greßmann, 1877–1927; Ernst Troeltsch, 1865–1923), im geschichtlichen Umfeld der Kulturkrise nach dem Ersten Weltkrieg und angesichts einer Neuorientierung in der Theologie, die einem historischen Ansatz äußerst ablehnend gegenübersteht, kann die Religionsgeschichtliche Schule nicht mehr an ihre große Zeit vor dem Ersten Weltkrieg anknüpfen (s.u. S. 163f.).
Streit über Ursprung und Entwicklung von Religion
Was die Religionsgeschichte als akademische Disziplin im 19.Jh. und bis weit ins 20.Jh. hinein stärker prägt als die genannten Schulrichtungen, sind jedoch der Entwicklungsgedanke und die damit häufig verbundene Suche nach dem „Ursprung“ der Religion, von dem her die gesamte Religionsgeschichte verstanden werden sollte. Die verschiedenen „Ursprungs-“ und „Entwicklungs“theorien wirken dabei weit über die Religionsgeschichte als Teildisziplin der Religionswissenschaft und werden beispielsweise auch in der Religionssoziologie oder in der Religionspsychologie rezipiert. Doch alle jene „Ursprungs-“ und „Entwicklungs“theorien treffen auch auf heftigen Widerstand anderer Denkrichtungen – beispielsweise des o.g. skandinavischen Zweiges der Kultgeschichtlichen Schule – oder werden durch neue Ansätze in Frage gestellt bzw. weiterentwickelt – so etwa durch die auf den Ethnologen Leo Frobenius (1873–1938) zurückgehende sog. „Kulturkreislehre“, die religionsgeschichtliche Parallelen nicht mit der Hypothese gesetzmäßiger Entwicklungsphasen, sondern mit der Annahme einer historisch-geographischen „Diffusion“ (Zerstreuung) einzelner Kulturelemente bzw. -komplexe erklärt (s.u. S. 42).
der Aufschwung der Archäologie
Die großen archäologischen Entdeckungen des 19. und 20. Jahrhunderts dürfen in ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Religionsgeschichte nicht unterschätzt werden. Funde von prähistorischen Kunstwerken – insbesondere Höhlenmalereien in Südfrankreich – regen Forschungen über die frühgeschichtliche Religionsgeschichte an. Ausgrabungen in Troja, auf Kreta, in der Türkei, in Ägypten und anderen Regionen des Nahen Ostens erweitern die Kenntnisse über die griechisch-römische Antike und den Alten Orient. Der englische Archäologe Sir John Hubert Marshall (1976– 1958) trägt mit der archäologischen Erschließung der frühen Zivilisationen im Industal dazu bei, dass ältere religionsgeschichtliche Theorien über die Entwicklung der vedischen Religion revidiert werden müssen. Weitere Entdeckungen wie die von Angkor Wat (im heutigen Kambodscha) oder Borobudur (Indonesien) erweitern nicht nur unsere religionsgeschichtlichen Kenntnisse, sondern schaffen die Grundlage dafür, dass die Ikonographie, also die Erforschung von Inhalt und Funktion sichtbarer, gegenständlicher Kunstwerke, auch in der Religionsgeschichte an Bedeutung gewinnt.
Neue Akzente
Neben manchen anderen Entwicklungen sind für die religionsgeschichtliche Forschung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts insbesondere drei Aspekte erwähnenswert: Zum einen erweitert sich nochmals die Masse der zur Verfügung stehenden religionsgeschichtlichen Quellen; durch die Entdeckung von altorientalischen Texten im vorderasiatischen Bereich oder von manichäischen u.a. Quellen entlang der alten Seidenstraße und durch Funde wie die von Qumran usw. steht der religionsgeschichtlichen Forschung neues Material zur Verfügung, dessen Aufarbeitung z.T. noch lange nicht abgeschlossen ist. Zum anderen treten die großen religionsgeschichtlichen Entwürfe des ausgehenden 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts – insbesondere die Ursprungs- und Entwicklungstheorien – nach und nach in den Hintergrund, mehr noch: die Selbstverständlichkeit, mit der bislang die Religionsgeschichte insbesondere das außereuropäische Material nach ihren eigenen Kriterien maß, ordnete und auswertete, wird zunehmend in Frage gestellt. Im Zuge dieser Skepsis geraten schließlich selbst neuere religionswissenschaftliche Ansätze in die Kritik: Bietet „Das Heilige“, von Rudolf Otto (1869–1936) in seinem großen gleichnamigen Werk als religionswissenschaftliche Kategorie entfaltet, tatsächlich ein Konzept, das die religionsgeschichtliche Forschung in ihrer Arbeit weiterbringen wird?
die Rolle der Forschenden
Die Religionsgeschichte ist eine junge Disziplin, noch kaum ihren Kinderschuhen entwachsen. Wie bereits erwähnt, steht ihre grundlegende Bedeutung für die religionswissenschaftliche Forschung außer Frage. Ebenso unstrittig ist jedoch, dass die Religionswissenschaft als Ganze nicht in der Religionsgeschichte aufgeht, oder anders ausgedrückt: Religionsgeschichte ist eine Teildisziplin der Religionswissenschaft. Dabei arbeitet sie als Historische Religionswissenschaft grundsätzlich nicht anders als alle anderen Geschichtswissenschaften und unterliegt denselben Bedingungen, Problemen – vielleicht sogar Aporien – und Begrenzungen. Dazu gehört, dass die Religionsgeschichte nicht „objektive“, quasi naturgesetzlich gegebene Tatsachen feststellt. Vielmehr steht der Forscher, die Forscherin selbst in einem geschichtlichen Kontext, aus dem heraus er oder sie die zur Verfügung stehenden Quellen befragt und mit ihnen in eine dynamische Beziehung tritt. Die Beschreibung der untersuchten Religion oder des analysierten Gegenstandes der Untersuchung ist also keine Festschreibung von Gegebenem, sondern Ergebnis einer Interaktion zwischen den Forschenden und ihren Quellen, bei der den Forschenden durchaus ein Stück weit die Rolle eines „Konstrukteurs“ zukommt.
Diese Beobachtung ist für die Diskussion über Möglichkeiten und Grenzen religionsgeschichtlichen Forschens von nicht unerheblicher Bedeutung. Daraus ergibt sich nämlich die Forderung, dass Forschende in Sachen Religion ihre Instrumentarien – ihre Kriterien und Kategorien, ihre wissenschaftliche „Metasprache“ – immer wieder zu hinterfragen haben. Das bedeutet aber auch, dass sie ihr eigenes Tun, ihre eigene Rolle als „Konstrukteure“ in diesem Prozess der Interaktion mit den religionsgeschichtlichen Quellen kritisch reflektieren und problematisieren müssen.