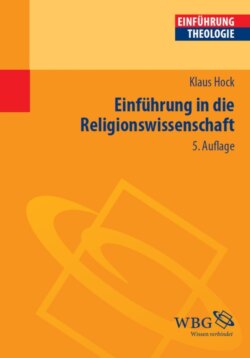Читать книгу Einführung in die Religionswissenschaft - Klaus Hock - Страница 14
c) Dokumentation religiöser Darstellungsebenen
ОглавлениеFormen der Dokumentation religionsgeschichtlicher Informationen im Wandel der Zeit
Religionsgeschichtliche Informationen müssen festgehalten, dokumentiert werden. Am einfachsten ist es mit schriftlichen Quellen, die heutzutage der religionswissenschaftlichen Forschung leicht zugänglich sind: Im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit können selbst Heilige Schriften in beliebiger Auflage vervielfältigt werden, auch wenn dies vielleicht manchen Gläubigen nicht ganz geheuer sein mag; ob der Koran auch in gedruckter Form erscheinen darf, war zur Zeit der Einführung der Druckerpresse im Osmanischen Reich heftig umstritten – und ist es in manchen ländlichen Regionen der islamischen Welt bis heute.
Mündliche Mitteilungen bereiten ebenfalls kein Problem: Sie können elektronisch aufgezeichnet und, so dies nötig sein sollte, transkribiert werden. Doch selbst averbale Informationen lassen sich auf verschiedene Weise dokumentieren, und auch sie sind in Sprache „übersetzbar“ und schriftlich darstellbar; so hat der Anthropologe Peter Lienhardt einige Ausschnitte der gesungen vorgetragenen Ballade vom „Medizinmann“ in Notenschrift transkribiert. Gerüche, Bilder, Handlungen und religiöse Gerätschaften lassen sich beschreiben.
Aber auch andere Formen der Dokumentation sind möglich: Gemälde oder Zeichnungen, Fotografien, Film- und Videoaufnahmen. Schon früh wurden die europäischen Forscher bei ihren Expeditionen von Künstlern begleitet, die darauf spezialisiert waren, alles festzuhalten, was von wissenschaftlichem Interesse sein könnte – darunter auch Bilder von religiösen Experten, Kultgegenständen oder rituellen Praktiken. Bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam dann die Fotografie zum Einsatz; die immense Bedeutung früher Fotografien beispielsweise für die Erforschung der Missionsgeschichte wird erst jetzt im vollen Umfang deutlich. Die Film- und Videotechnik ermöglicht wiederum ganz neue religionswissenschaftliche Dokumentationsformen; beispielsweise wurden über viele Jahre, inzwischen Jahrzehnte hinweg seit den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts wichtige Aspekte des rituellen Lebens der Dogon, einer ethnischen Gruppe in Westafrika, dokumentiert, und vor beinahe drei Jahrzehnten entstand unter dem Titel Schamanen im blinden Land ein vielstündiger Film, der – auf zweieinhalb Stunden heruntergekürzt – auch mehrfach im Fernsehen ausgestrahlt worden ist.
Neue Medien als religionsgeschichtliche Quellen
Die Medien des industriellen und nachindustriellen Zeitalters – Radio, Fernsehen, Internet – haben nicht nur veränderte Kommunikationsformen eröffnet, sondern erschließen der religionsgeschichtlichen Forschung auch neue Quellen. In Radio oder Fernsehen übertragene Gottesdienste, Meditationen oder Textauslegungen verlangen neue Formen der religiösen Selbstdarstellung, die weitere Veränderungen nach sich ziehen können: neue Themen und Inhalte, aber auch bislang unbekannte Organisationsformen – als Beispiel sei auf die meist „fundamentalistisch“ geprägten sog. Electronic Churches in den USA verwiesen. Noch weitergehende Perspektiven ergeben sich aus den Möglichkeiten des Internet: multimedial ausgebaute religiöse Botschaften, Chatrooms zur seelsorgerischen Betreuung, virtuelle Gebete … den Ausdrucksformen scheinen kaum Grenzen gesetzt. Zugleich ermöglicht es das Internet auch kleinen religiösen Gemeinschaften, die über eine nur dünne finanzielle Basis verfügen, durch ihre globale Präsenz im Netz zur „Weltreligion“ zu werden – zumindest virtuell. Für die religionswissenschaftliche Forschung ergeben sich daraus ganz neue Perspektiven für die Arbeit am Schreibtisch: Desk Top Research im Cyberspace.
Doch die meisten Religionen existieren nicht nur im virtuellen Raum. Insofern wird religionsgeschichtliche Forschung darum bemüht sein, sich nicht bloß auf eine Darstellungsebene zu konzentrieren, sondern möglichst umfassend diejenigen Quellen zu analysieren, die ihr im Rahmen der jeweiligen Fragestellung und im Blick auf die untersuchte Religion zuverlässig Aufschluss bieten. Dabei lassen sich allerdings nicht von vornherein starre „Hierarchien der Darstellungsebenen religiöser Botschaft“ (Stolz) für die religionsgeschichtliche Forschung festlegen, d.h. die Frage, wie Bild, Sprache oder Handlung in einer Religion zueinander zu gewichten sind, ist – wenn überhaupt – erst nach einer detaillierten Analyse der einzelnen Bereiche zu beantworten. Dabei muss sowohl die Verknüpfung zwischen diesen Bereichen als auch der historische Wandel ihrer jeweiligen Bedeutung und somit die Möglichkeit einer Umgewichtung berücksichtigt werden.