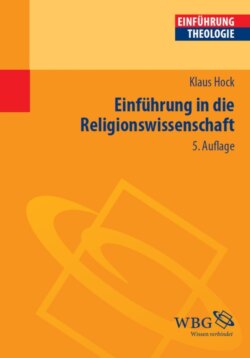Читать книгу Einführung in die Religionswissenschaft - Klaus Hock - Страница 6
I. Systematisches Stichwort
ОглавлениеReligionswissenschaft ist die empirische, historische und systematische Erforschung von Religion und Religionen. Entsprechend umfasst sie eine Vielzahl von Disziplinen, die unter je spezifischen Fragestellungen Religionen und religiöse Phänomene untersuchen und darstellen.
Herkömmlicherweise wird zwischen Historischer Religionswissenschaft und Systematischer Religionswissenschaft unterschieden: Die religionsgeschichtliche Forschung ist am geschichtlichen Werden interessiert und konzentriert sich auf die Untersuchung und Beschreibung des Besonderen, oft in Gestalt historischer Längsschnitte; die religionssystematische Forschung richtet demgegenüber ihre Aufmerksamkeit auf das Allgemeine und ist darum bemüht, in Form von Querschnitten Typisches herauszuarbeiten. Beide Zweige sind dabei eng aufeinander bezogen: Die Systematische Religionswissenschaft entwickelt ihre Systematik und ihre Typologien auf der Grundlage des empirischen Materials, das ihr die religionsgeschichtliche Forschung bietet; umgekehrt stellt die systematische Religionsforschung der Historischen Religionswissenschaft die Kriterien und Kategorien bereit, die für ein geordnetes Erfassen der geschichtlichen Vielfalt notwendig sind.
Seit ihrer Emanzipation als eigenständige Disziplin im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts hat sich die Religionswissenschaft in mehrere Teildisziplinen ausdifferenziert. Die Religionsgeschichte selbst blieb lange Zeit einer strikt philologischen Orientierung verhaftet; dies legte sich schon deshalb nahe, weil sie es vornehmlich mit schriftlichen Texten zumeist außereuropäischer Kulturen oder vergangener Epochen zu tun hatte.
Innerhalb der Systematischen Religionswissenschaft erlangte seit Beginn des 20. Jahrhunderts die Religionsphänomenologie so maßgebliche Bedeutung, dass die Termini „Religionsphänomenologie“ und „Systematische Religionswissenschaft“ bisweilen beinahe synonym gebraucht wurden. Ziel der Religionsphänomenologie war es, die verschiedenen religiösen Phänomene systematisch zu ordnen, ihre religiösen Inhalte zu bestimmen und auf diese Weise das „Wesen“ der Religion zu begreifen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist die Religionsphänomenologie in ihrer traditionellen Form unter heftige Kritik geraten. Erste zaghafte Neuansätze verzichten deshalb bewusst auf diese „Wesensschau“ und richten ihr Augenmerk auf die Frage nach den Intentionen, mit denen die Menschen den Phänomenen einen religiösen, d.h. für sie bindenden und nicht hinterfragbaren Sinn zuschreiben.
Die Religionssoziologie beschäftigt sich mit Fragen der Beziehung zwischen Religion und Gesellschaft. Als Bezeichnung für eine wissenschaftliche Disziplin geht sie auf Max Weber zurück und hat sich seither vornehmlich auf die Erforschung von Religionen in modernen, komplexen Gesellschaften konzentriert. Dabei ist sie insbesondere an Fragen wie der nach dem Verhältnis von Religion und gesellschaftlichen Organisationsformen, Religion und Politik, Religion und sozialer Schichtung oder Religion und Familie interessiert; „Säkularisierung“, „Fundamentalismus“ und „Zivilreligion“ gehören z.T. schon seit vielen Jahrzehnten zu den wichtigsten Themen der Religionssoziologie.
Gegenüber der Religionssoziologie hat sich die Religionsethnologie vornehmlich auf die Erforschung von Religionen in ehemals schriftlosen Kulturen – genauer: in weniger komplexen Gesellschaften – spezialisiert. Außerdem markiert das Kriterium des „kulturell Fremden“ eine weitere Differenz zwischen beiden Disziplinen, die sich in ihren Methoden kaum voneinander unterscheiden. Auf der theoretischen Ebene ihres Gegenstandsbereichs ist die Religionsethnologie u.a. mit der Analyse von Mythen befasst – den mündlichen Äquivalenten zu den „Heiligen Schriften“ –, auf der Ebene der religiösen Praxis beschäftigt sie sich beispielsweise mit der Untersuchung verschiedener Formen des Rituals; beide Ebenen werden allerdings stets in enger Wechselbeziehung gesehen. Bei ihrem Versuch, kulturell Fremdes wissenschaftlich zu erschließen, hat die Religionsethnologie seit einiger Zeit den Schwerpunkt auf die Erforschung von symbolischen Ausdrucksformen gelegt, über die sie Zugang zum Verständnis religiöser Bedeutungssysteme zu gewinnen hofft.
Die Religionspsychologie ist demgegenüber vornehmlich mit der Frage nach dem Verhältnis von Individuum und Religion befasst. Sie nimmt dabei ihren Ausgang bei der Feststellung, dass Religion – insbesondere auf der Ebene der religiösen Erfahrung und der religiösen Praxis – einen Ort im individuellen Erleben der Menschen hat. Sowohl empirisch arbeitende als auch tiefenpsychologisch orientierte Richtungen haben zur Entwicklung der Disziplin maßgeblich beigetragen; in jüngerer Zeit gewinnt die empirische Religionspsychologie aufgrund ihrer großen Erfahrung mit quantitativen und qualitativen Methoden für die Religionsforschung zunehmend an Bedeutung.
Neben diesen „klassischen“ religionswissenschaftlichen Disziplinen sind noch weitere Forschungsrichtungen zu nennen, die in den letzten Jahrzehnten zur Entwicklung der Religionswissenschaft nicht unerheblich beigetragen haben: Die Religionsgeographie beschäftigt sich – häufig auch unter der Bezeichnung „Religion-Umwelt-Forschung“ oder „Geographie der Geisteshaltung“ – mit der Wechselwirkung von Religion und Umwelt, wobei sie sowohl die Prägung der Umwelt durch die Religion (Umweltprägung) als auch die Prägung der Religion durch die Umwelt (Umweltabhängigkeit) untersucht; die Religionsästhetik fragt nach dem, was an Religionen sinnlich wahrnehmbar ist, und versucht die komplexe Beziehung zwischen Religion und Wahrnehmungsprozessen zu analysieren; die Religionsökonomik als aufstrebende Subdisziplin der Religionssoziologie wiederum ist an der Frage nach dem Zusammenhang von Religion und Wirtschaft interessiert, wobei sie sowohl die wirtschaftlichen Bedingungen als auch die ökonomischen Folgen religiösen Handelns in den Blick nimmt.
Religionsbegründung und Religionskritik gehören ebenso wie die Religionsphilosophie zum Objektbereich akademischer Religionsforschung. Ihrem Selbstverständnis als Wissenschaft entsprechend, tritt die Religionswissenschaft dabei allerdings ihrem Gegenstand – den Religionen – notwendigerweise „kritisch“ gegenüber. Eine Perspektive der Zusammenarbeit zwischen Religionswissenschaft und Philosophie eröffnet sich im gemeinsamen Bemühen um die Erarbeitung einer formalen Wissenschaftssprache auf der Grundlage klarer methodologischer Standards und Verfahrensweisen.
Besonders strittig ist die Frage nach dem Verhältnis von Theologie und Religionswissenschaft. Weder die Synthetisierung in Gestalt einer „theologischen Religionswissenschaft“, noch die Abschottung einer vermeintlich wertfrei-objektiv arbeitenden Religionswissenschaft gegenüber der Theologie sind zukunftsfähige Modelle. Angesichts theologischer Vereinnahmungsstrategien sowie im Blick auf Immunisierungsstrategien von religionswissenschaftlicher Seite gilt es daran festzuhalten, dass die Religionswissenschaft als eigenständige akademische Disziplin mit der Theologie eine ganze Reihe von Berührungspunkten aufweist. Auch im Falle ihrer institutionellen Anbindung an theologische Fakultäten geht die Religionswissenschaft allerdings nicht in der Theologie auf. Gerade die Unterscheidbarkeit von Religionswissenschaft und Theologie eröffnet über ein methodisch kontrolliertes Nebeneinander hinaus die Perspektive auf ein sachlich gebotenes Miteinander.
Im Laufe ihrer jungen Geschichte hat die Religionswissenschaft als akademische Disziplin ihre Position sowohl in den philosophischen und kulturwissenschaftlichen als auch in den theologischen Fakultäten – wenngleich hier im geringeren Maße – festigen können. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie gerade an den deutschen Universitäten nach wie vor in hohem Grade institutionell marginalisiert ist – und das angesichts einer Situation, in der Religion und Religionen in das Zentrum des aktuellen (welt-)politischen Geschehens gerückt sind: Mit Fragen wie der nach den Religionen als Akteuren globaler kultureller Konflikte, nach der Bedeutung sog. Neuer Religiöser Bewegungen oder nach der Dynamik religiöser Faktoren im Kontext von Migration und Integration stehen plötzlich hochbrisante politische Themen auf der religionswissenschaftlichen Tagesordnung. Wo Religion im Zusammenhang mit „kulturellen Konflikten“ ins Zentrum des öffentlichen Interesses tritt, ist die Religionswissenschaft in besonderer Weise ausgewiesen, diese Themen angemessen zu bearbeiten. Schon vor längerem hat sie nämlich einen Perspektivenwechsel vollzogen, der kürzlich auch in anderen akademischen Disziplinen beobachtet wurde: die Wende hin zu kulturwissenschaftlichen Fragestellungen. Indem sie Religion als kulturelles System begreift, positioniert sich die Religionswissenschaft als kulturwissenschaftliche Disziplin, deren Forschungsarbeit von nicht unerheblicher gesellschaftlicher Relevanz ist.