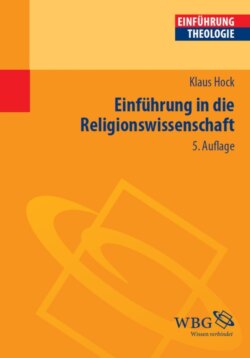Читать книгу Einführung in die Religionswissenschaft - Klaus Hock - Страница 13
b) Averbale Quellen
ОглавлениеMusik und Kunst
Der religionshistorischen Forschung stehen Quellen nicht nur in Gestalt von Texten in schriftlicher oder mündlicher Form zur Verfügung. Das breite Spektrum der kulturellen Schöpfungen – die Musik, die Kunst, die gesamte materiellen Kultur, in der sich eine religiöse Gemeinschaft bewegt, selbst Gerüche! – bietet ein reichhaltiges, ja überquellendes Reservoir religionsgeschichtlicher Quellen, seien sie nun sichtbar oder unsichtbar. Die Töne des Gongs oder der Trommel dienen nicht nur der Kommunikation zwischen den Menschen oder ihrer Unterhaltung – sie können auch religiöse Botschaften übermitteln und entsprechende Wirkungen auslösen. So vermag bei den westafrikanischen Hausa der Klang der goge, einer Art einsaitige Violine, im sog. Bori-Kult Geister zu bannen, wenn das Instrument von einem entsprechenden religiösen Experten gespielt wird; und im abendländischen Christentum bringt „geistliche Musik“ auch ohne Worte religiöse Botschaften zum Ausdruck. Anschaulicher wird Religiöses jedoch – im unmittelbaren Sinne des Wortes – in Werken der Bildenden Kunst. Selbst dort, wo ein weit verbreitetes Bilderverbot diese Möglichkeit einschränkt, haben wir entsprechende sichtbare Quellen: Arabesken oder Kalligraphien, die religiöse Botschaften in ihrer Anschaulichkeit darstellen. Die Architektur zeugt von religionsgeschichtlichen Wandlungsprozessen und haut religiöse Botschaften in Stein: Das Minarett hat der Islam dem Christentum entlehnt, und ein Bauwerk wie der buddhistische Borobudur auf Java erzählt nicht nur in seinen Friesen u.a. von Leben und Legende des Buddha, sondern spiegelt in Grundriss und Aufbau die buddhistische Lehre wider. Die Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen.
Gegenständliches und Nichtgegenständliches
Zu diesem Typ averbaler, wortloser religionsgeschichtlicher Quellen gehören aber nicht nur künstlerisch und ästhetisch besonders anspruchsvolle oder kostbare Werke, sondern auch „einfache“ Gerätschaften, religiöse Gebrauchsgegenstände sozusagen: Orakelstäbchen, Schamanentrommeln, Abendmahlskelche usw. – schier unendlich ist die Zahl solcher Gegenstände. Die 1926 gegründete Religionskundliche Sammlung in Marburg hat sich von Beginn an zum Ziel gesetzt, religiöse Gerätschaften als Anschauungsmaterial zusammenzutragen. In der Regel begegnen wir solchen sichtbaren, averbalen Quellen jedoch dort, wo sie im Gesamtzusammenhang ihrer jeweiligen Religion „leben“.
Sichtbar, aber nicht gegenständlich sind Handlungen oder Bewegungen (Tanz!) als religionsgeschichtliche Quellen, so etwa in Form bestimmter Handzeichen und Gesten (fromme Katholiken bekreuzigen sich beispielsweise in bestimmten Situationen), als Verbeugung vor bzw. Umkreisen von Buddha-Statuen oder als komplexe Abläufe z.B. in Form hinduistischer Opferrituale. Oft sind sie mit anderen Elementen (Sprache, Musik, Gerüche, Bilder oder Gegenstände) kombiniert, können aber auch isoliert auftreten.