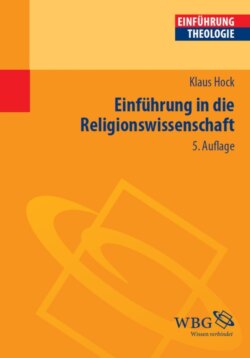Читать книгу Einführung in die Religionswissenschaft - Klaus Hock - Страница 15
d) Religionswissenschaftliche Arbeitsteilung
ОглавлениеWenn bisher mehrfach davon die Rede war, dass Religionsgeschichte heute als Teildisziplin der Religionswissenschaft verstanden wird, so ergibt sich eine solche Einschätzung zum einen aus der oben kurz skizzierten wissenschaftsgeschichtlichen Entwicklung, zum anderen aber aus der inneren Logik und der daraus abgeleiteten Systematik des Faches. Diese Systematik orientiert sich vornehmlich an den zur Verfügung stehenden Quellen. Was ich frage, welche Religion ich befrage und welche Quellen mir zur Verfügung stehen – das sind drei Faktoren, die in äußerst dynamischer Weise aufeinander bezogen sind und sich wechselseitig bedingen.
Systematik religionswissenschaftlicher Arbeitsweisen
Die religionsgeschichtliche Forschung muss hierauf möglichst flexibel reagieren, will sie weiterführende Ergebnisse zu Tage fördern. Immerhin lassen sich jedoch ganz grob bestimmte Grundtypen von Religionen bestimmten Quellen und bestimmten Zugangsarten zuordnen: Im Zentrum klassischer religionsgeschichtlicher Forschung stehen die sog. Hochreligionen, denen sich die Religionsgeschichte in erster Linie durch die Untersuchung ihrer schriftlichen Dokumente nähert. Auf der Folie eines geschichtswissenschaftlichen Zugangs können darüber hinaus weitere Quellen analysiert werden und zum Verständnis der jeweils untersuchten Aspekte beitragen. – Die Erforschung der schriftlosen Religionen hingegen ist weithin der (Religions-)Ethnologie und der Religionsphänomenologie überlassen. Von ihr wird erwartet, dass sie mit allgemeinen Begriffen wie Geheimbund, Magie, Mythos, Tabu, Totem etc. den untersuchten Gegenstand systematisch beschreibt. – Die Beschäftigung mit Neuen Religiösen Bewegungen und gegenwärtigen Ausprägungsformen der Religionen wird wiederum anderen Disziplinen übertragen, allen voran der Religionssoziologie.
Komplementarität religionswissenschaftlicher Arbeitsweisen
Diese Art der strikten Trennung zwischen unterschiedlichen Zugangsweisen ist jedoch auf Dauer weder zufriedenstellend noch angemessen – zumal sich die hier unterschiedenen Religionstypen zunehmend überlagern und nicht mehr die „historischen“ Fragestellungen der Religionsgeschichte gegen die vermeintlich „ahistorischen“ der Ethnologie oder Soziologie ausgespielt werden können. Dennoch ist es bis heute bei einer gewissen Arbeitsteilung geblieben, wenngleich die zuvor deutlich abgesteckten Arbeitsbereiche durchlässiger geworden sind. So hatten sich beispielsweise Christian Sigrist und Rainer Neu in den 70er Jahren auf ein traditionell religionsgeschichtliches und theologisches Gebiet begeben und ethnologische Fragestellungen an religionsgeschichtliche Quellen angelegt. Umgekehrt wird seitens der Ethnologie schon seit langem angemahnt, dass die ihrem Fachgebiet zugeschlagenen schriftlosen Religionen ebensowenig „geschichtslos“ sind wie die sog. historischen Religionen. Außerdem ist die strikte Scheidung zwischen Schriftkulturen und schriftlosen Kulturen ohnehin problematisch; viele der letzteren besaßen durchaus voreuropäische Schriftsysteme, wie beispielsweise die in Südostnigeria beheimateten Igbo oder andere Ethnien in der Gegend des heutigen Nordkamerun. Die Scheidung zwischen den einzelnen Disziplinen kann und darf also nicht absolut sein; oftmals wird die religionswissenschaftliche Forschung arbeitsteilig vorgehen, und in vielen Fällen ergänzen sich die einzelnen Herangehensweisen komplementär.