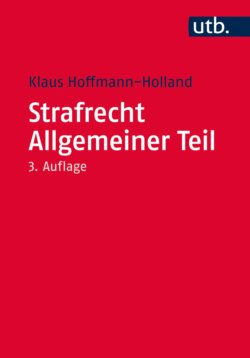Читать книгу Strafrecht Allgemeiner Teil - Klaus Hoffmann-Holland - Страница 14
4. Analogieverbot und zulässige Auslegung
Оглавление26Das Gebot, dass die Strafbarkeit bestimmt sein muss (§ 1 StGB), richtet sich auch an den Rechtsanwender. Die Bestimmtheit des Strafgesetzes muss auch auf der Ebene der Gesetzesanwendung verwirklicht werden. Die Grenzen des Strafbaren werden vom Gesetzgeber durch die Verwendung von Gesetzesbegriffen – d.h. Worten – festgelegt. Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass eine Rechtsanwendung dann gegen das Gesetzlichkeitsprinzip verstößt, wenn sie den möglichen Wortsinn überschreitet. Eine über den Wortsinn hinausgehende Analogie zu Lasten des Täters, d.h. die Anwendung einer Strafnorm in Fällen, die von ihrem Wortlaut nicht erfasst werden, ist unzulässig.[38] Eine Analogie zugunsten des Täters, d.h. die Nichtanwendung einer dem Wortlaut nach einschlägigen Strafnorm, ist demgegenüber zulässig.
27Abzugrenzen von der unzulässigen strafbarkeitserweiternden Analogie zu Lasten des Täters ist die erlaubte und notwendige Auslegung des gesetzlichen Tatbestands. Auch eine für den Täter ungünstige Auslegung ist nicht verboten. Auslegung ist die Ermittlung des Gesetzesinhaltes. Dabei kann in Anlehnung an den „Kanon der Gesetzesauslegung“ von Friedrich Carl v. Savigny auf vier Auslegungsmethoden, die nebeneinander zur Anwendung kommen können, zurückgegriffen werden: Die grammatische, die systematische, die historische sowie die teleologische Auslegung.[39] Zwar existiert keine bestimmte Rangfolge unter den Auslegungsarten, jedoch stellt der Wortlaut eine absolute Grenze dar. Häufig sind mehrere Sichtweisen vertretbar.
28Die grammatische Auslegung geht vom Wortlaut des Gesetzes aus. Sie markiert die Grenze zwischen Auslegung und Analogie. Gefragt wird, ob eine bestimmte Interpretation mit dem allgemeinen Sprachgebrauch oder der üblichen Rechtssprache in Einklang steht.
29Systematische Auslegung betrachtet die Stellung der Vorschrift im Gesetz (Gesetzessystematik) und die Stellung des Gesetzes innerhalb der Rechtsordnung (Rechtssystematik).
30|11|Nach den Motiven des Gesetzgebers fragt die historische Auslegung. Entscheidend ist die Entstehungsgeschichte. Quelle zur Ermittlung der Motive sind insbesondere die Gesetzgebungsmaterialien. Dazu gehören v.a. Bundestags- sowie Bundesratsdrucksachen und Protokolle.
31Die teleologische Auslegung stellt auf Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung ab. Entscheidend ist insbesondere der Schutzzweck der Strafnorm.
32In bestimmten Konstellationen kann es neben den soeben benannten „klassischen“ Auslegungsmethoden auch erforderlich sein, die Grundsätze der verfassungskonformen[40] oder unionsrechtskonformen[41] Auslegung heranzuziehen. Der grundsätzliche Vorrang des primären und sekundären Rechts der EU[42] gilt auch gegenüber dem nationalen Strafrecht. Dies hat zur Folge, dass von mehreren möglichen Bedeutungen einer Strafnorm diejenige zu wählen ist, die mit dem Recht der EU übereinstimmt. Zugleich sind jedoch die allgemeinen Grundsätze des nationalen Rechts zu beachten, insbesondere darf eine unionsrechtskonforme Auslegung nicht dazu führen, dass das Bestimmtheitsgebot, das Rückwirkungs- oder das Analogieverbot faktisch außer Kraft gesetzt wird.[43] Grenze der Auslegung bleibt also auch hier der Gesetzeswortlaut. Die verfassungskonforme Auslegung verfährt auf ähnliche Weise wie die unionsrechtskonforme. Dabei wird die Möglichkeit der Auslegung einer Norm in der Weise eingeschränkt, dass die Auslegung verfassungskonform sein muss, d.h. nicht gegen Wertentscheidungen des GG verstoßen darf.[44]