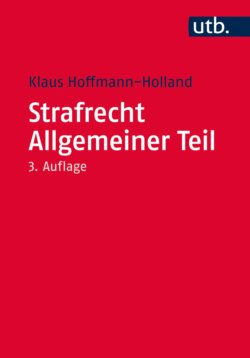Читать книгу Strafrecht Allgemeiner Teil - Klaus Hoffmann-Holland - Страница 16
ОглавлениеIV. Aufbau der Straftat
1. Grundlagen
37Der Grundbegriff der „Straftat“ setzt sich aus drei Grundelementen zusammen: Dem Tatbestand, der Rechtswidrigkeit und der Schuld.
Tab. 1:
38Dreigliedriger Straftataufbau
| 1. | Tatbestand |
| 2. | Rechtswidrigkeit |
| 3. | Schuld |
39Diese Aufbauelemente sind im Gesetz vorgezeichnet. Zunächst kann man Unrecht und Schuld unterscheiden. Einerseits gibt es z.B. nach § 34 StGB Taten, die gerechtfertigt sind, andererseits Taten, die – z.B. nach § 35 StGB – entschuldigt sind. Das Unrecht ist der Inbegriff für die allgemeine strafrechtliche Verbotenheit eines Verhaltens (objektiv-genereller Unrechtsvorwurf), während die Schuld die Frage der personalen Zurechnung, die persönliche Vorwerfbarkeit (individueller Schuldvorwurf) betrifft. Beließe man es bei dieser Unterteilung, ergäbe sich ein zweigliedriger Straftataufbau.[45]
40Doch kann das Unrecht seinerseits in Tatbestand und Rechtswidrigkeit untergliedert werden.[46] Im Tatbestand wird beschrieben, wann ein Unwert verwirklicht wird, der strafrechtserheblich ist. Der Deliktstypus wird festgelegt. Auf der Ebene der Rechtswidrigkeit wird geprüft, ob trotz der Unwertverwirklichung das Verhalten rechtmäßig ist. Tötet bspw. A den O in Notwehr, stellt der Tod des O zwar einen strafrechtsrelevanten Unwert dar (§ 212 StGB), jedoch bezeichnet § 32 Abs. 1 StGB das Handeln in Notwehr als „nicht rechtswidrig“. Darin kommt zum Ausdruck, dass das Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes (hier die Notwehr) nicht die Tatbestandsmäßigkeit entfallen lässt, sondern im Rahmen einer Wertung die Rechtswidrigkeit ausschließt. Dabei ist entgegen einer verbreiteten Formel nicht davon auszugehen, dass der Tatbestand die Rechtswidrigkeit indiziere. Zwar lässt sich etwa bei einer Vergewaltigung (§ 177 Abs. 1, 2 Nr. 1 StGB) kaum der Fall einer Rechtfertigung konstruieren. Andererseits aber dürften viele Freiheitsberaubungen nach § 239 Abs. 1 StGB, die tatbestandlich Eingriffe in die persönliche Fortbewegungsfreiheit|14| voraussetzen, gerechtfertigt sein (insbesondere in Fällen der Freiheitsentziehung im Strafvollzug).
41Auch der Tatbestand kann unterteilt werden in einen objektiven und einen subjektiven Tatbestand. Der Deliktstypus wird zum einen durch objektive (äußere) Elemente geprägt, z.B. beim Diebstahl (§ 242 Abs. 1 StGB) dadurch, dass eine fremde bewegliche Sache weggenommen wird. Zum anderen wird der Deliktstypus aber auch durch subjektive (innere) Elemente bestimmt, die einem subjektiven Tatbestand zuzuordnen sind. Die Unwertbeschreibung des Diebstahls wäre unvollständig, wenn nicht die Absicht rechtswidriger Zueignung davon umfasst wäre. Aber auch der Vorsatz (vgl. § 15 StGB) ist dem subjektiven Tatbestand zuzuordnen. Er unterscheidet bspw. den Deliktstypus des Totschlags, § 212 Abs. 1 StGB, von dem der fahrlässigen Tötung, § 222 StGB.
42Aus diesen Unterteilungen kann das allgemeine Schema in Tab. 2 für das vollendete, vorsätzliche Begehungsdelikt als Grundform der Straftat abgeleitet werden:
Tab. 2:
43Vollendetes, vorsätzliches Begehungsdelikt
| Prüfungsstufe | Inhalt | |
| I. | Tatbestand | |
| 1. Objektiver Tatbestand | Täter, Tathandlung, Taterfolg (im BT beschrieben) Kausalität objektive Zurechnung | |
| 2. Subjektiver Tatbestand | Vorsatz Deliktsspezifische subjektive Tatbestandsmerkmale (im BT beschrieben) | |
| II. | Rechtswidrigkeit | Rechtfertigungsgründe objektive und subjektive Rechtfertigungselemente |
| III. | Schuld | Schuldfähigkeit (§§ 19, 20 StGB) spezielle Schuldmerkmale (im BT beschrieben) Fehlen von Entschuldigungsgründen |
2. Koinzidenzprinzip und Hinweis für die Fallbearbeitung
44Aus dem sog. Koinzidenzprinzip folgt, dass eine Strafbarkeit nur vorliegt, wenn sämtliche Voraussetzungen der Straftat in einem bestimmten Zeitpunkt gleichzeitig erfüllt sind.[47] Wer die tatbestandsmäßigen Voraussetzungen des |15|Totschlags erfüllt (d.h. vorsätzlich einen anderen Menschen tötet), ist daher nur dann nach § 212 Abs. 1 StGB zu bestrafen, wenn er in genau diesem Moment auch rechtswidrig und schuldhaft handelt. Liegen die Voraussetzungen von Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit und Schuld zeitgleich (und sei es auch nur kurz) vor, kann sich der Täter demgegenüber nicht darauf berufen, dass er zu einem anderen Zeitpunkt die Voraussetzungen eines der Strafbarkeitselemente nicht erfüllte. Wer einen Menschen erschießt und im Zeitpunkt der Abgabe des Schusses rechtswidrig und schuldhaft handelt, kann einer Bestrafung nach § 212 Abs. 1 StGB also nicht dadurch entgehen, dass er sich darauf beruft, am vorrangegangenen Abend eine (die Schuldunfähigkeit begründende) BAK von 3,2 ‰ aufgewiesen zu haben.
45In der Fallbearbeitung sind die Voraussetzungen von Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit und Schuld nacheinander zu prüfen. Wird dabei auf einer Ebene festgestellt, dass die Strafbarkeitsvoraussetzungen nicht vorliegen, ist die Prüfung in der Regel zu beenden und nicht mehr auf die weiteren Stufen im Deliktsaufbau einzugehen, da die Straflosigkeit der betroffenen Person (hinsichtlich des geprüften Tatbestandes) bereits feststeht.