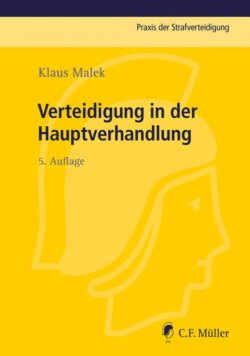Читать книгу Verteidigung in der Hauptverhandlung - Klaus Malek - Страница 34
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Exkurs: Ein wenig Psychologie
Оглавление60
Der Verteidiger muss wissen, dass in weitaus größerem Ausmaß als gemeinhin vermutet, psychische Faktoren, die den Beteiligten zumeist nicht einmal bewusst sind, auf die Entscheidungsfindung des Gerichts Einfluss haben.[4] Grundlage dieser Annahme sind die Ergebnisse zahlreicher psychologischer Experimente, die – zunächst ohne jeden Bezug zum Strafprozess – seit vielen Jahren durchgeführt und publiziert worden sind. Zu nennen sind vor allem die Erkenntnisse von Daniel Kahnemann, die dieser, teilweise gemeinsam mit seinem Kollegen Amos Tversky, seit den frühen 1970er Jahren veröffentlicht hat[5], und Leon Festinger[6], dessen Theorie von der kognitiven Dissonanz zum festen Bestand sozialpsychologischer Erkenntnisse gehört.[7]
61
Da eine ausführliche Darstellung psychologischer Forschungsergebnisse zu diesem Themenkreis an dieser Stelle schon aus Platzgründen nicht möglich ist, soll lediglich punktuell auf solche Erkenntnisse verwiesen werden, die von der Verteidigung im Rahmen der Hauptverhandlung ggf. fruchtbar gemacht werden können. An den Unzulänglichkeiten menschlicher Informationsgewinnung und -verarbeitung, „kognitiven Verzerrungen“, kann der beste Verteidiger nichts ändern. Möglicherweise hilft aber deren Kenntnis, ihre Auswirkungen, soweit sie zu Lasten des Angeklagten gehen, abzumildern.
62
Den vermutlich wichtigsten und bestens experimentell abgesicherten, bei der Urteilsfällung wirkenden psychischen Mechanismus stellt der sogenannte Ankereffekt dar. Darunter versteht die Psychologie einen Effekt, der beim Schätzen und Beurteilen von Quantitäten auftreten kann. Er bezeichnet die Assimilation eines numerischen Urteils an einen vorgegebenen Vergleichsstandard, der zwar nicht zwangsläufig, aber durchaus auch unabhängig von dessen inhaltlicher Relevanz wirkt.[8] Der Vergleichsstandard zieht wie ein „Anker“ die endgültige Schätzung oder Beurteilung in seine Richtung.[9] Zwar handelt sich bei diesem Effekt um ein allgemeines Phänomen, die Wirksamkeit im juristischen Kontext ist aber ebenfalls zuverlässig nachgewiesen.[10] Der Ankereffekt ist äußerst robust und wirkt sogar auch dann, wenn die Versuchspersonen um die Beliebigkeit des vorgegebenen Ankers wissen. Auch berufliche Kenntnisse ändern die Wirksamkeit nicht.[11] So zeigen erfahrene Strafrichter denselben Effekt wie Rechtsreferendare, mit dem einzigen Unterschied, dass sich die Richter in ihrem Urteil sicherer fühlen.[12]
63
Experimente belegen, dass der erste Anker wirkt. „Gegenanker“ bleiben weitgehend wirkungslos. In einer nicht veröffentlichten Studie wiesen Englich und Rost[13] nach, dass alleine die Änderung der Reihenfolge bei den Schlussvorträgen von Staatsanwalt und Verteidiger das Urteil entscheidend beeinflusst.[14]
64
Misslich für die Verteidigung ist die Erkenntnis, dass Ankereffekte weder durch Aufklärung noch durch besonders starke Motivation entscheidend korrigierbar sind.[15] So bleibt in der Hauptverhandlung lediglich die Möglichkeit, an den Stellen, an denen die Fallkonstellation und das Gesetz dies zulassen, selbst den Anker zu setzen, an dem sich das Gericht orientieren soll. Dabei kann der Verteidiger natürlich nicht, wie beim Tversky/Kahnemann’schen Glücksrad, ohne Zusammenhang mit dem konkreten Fall Zahlen in den Raum werfen, ohne sich bei den übrigen Prozessbeteiligten lächerlich zu machen. Seine Vorstellungen von dem zu erwartenden Ergebnis sollten also solide begründet werden. In der Hauptverhandlung bieten sich für entsprechende Ausführungen das Opening Statement (hierzu Rn. 233 ff.), im weiteren Verlauf die Begründung von Beweisanträgen, Erklärungen nach § 257 Abs. 2 und Verständigungsgespräche i.S.v. § 257c an. Prinzipiell wäre auch das Plädoyer hierfür geeignet, doch fühlen sich die Gerichte durch den Wortlaut des § 258 und eine darauf fußende lange Tradition genötigt, dem Staatsanwalt zuerst das Wort für die Schlussvorträge zu erteilen, aus psychologischer Sicht ein entscheidender Nachteil für die Verteidigung.[16] Zwingend ist die gesetzliche Regelung nicht,[17] so dass also durchaus ein Antrag auf Änderung der vorgesehenen Reihenfolge gestellt werden kann.[18] In der Berufungshauptverhandlung ist die Reihenfolge der Schlussvorträge in § 326 S. 1 zwar anders geregelt, doch wiegt hier gegen den berufungsführenden Angeklagten der „Anker“ des erstinstanzlichen Urteils in der Regel schwerer. Hier kann aber die gesetzlich nicht zwingend vorgeschriebene Berufungsbegründung (§ 317) helfen (vgl. Rn. 761).