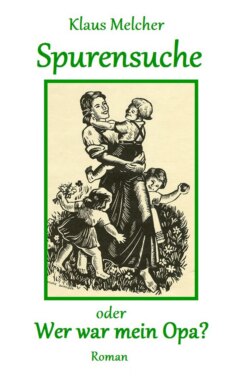Читать книгу Spurensuche - Klaus Melcher - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
10. Kapitel
ОглавлениеDollien, Ende 1916
Das Jahr neigte sich dem Ende entgegen und damit das dritte Kriegsjahr. Und jetzt spürte man überall den Mangel. Den Mangel an Männern, den Mangel an Eisenwaren und den Mangel an Nahrungsmitteln. Steckrüben waren die Hauptnahrung, vor allem in den Städten. Hier auf dem Lande hatte man noch etwas Abwechslung, auch Fleisch stand auf dem Speiseplan. Manchmal.
Sehr genau studierte der Baron jetzt die Zeitungen. Er gab sich nicht mehr mit der Meldung zufrieden, die er las. Er hinterfragte sie.
Feierte etwa die „Königlich Privilegierte Berlinische Zeitung“ die gesicherte Versorgung der Bevölkerung mit Bodenfrüchten, dann wusste der Baron, es gab nur noch Steckrüben.
Meldete sie, dass die Menschen in Berlin, Hamburg, Köln, München und anderen Großstädten geduldig warteten, bis die Geschäfte geöffnet wurden, dann las der Baron: Es gab nicht genug Lebensmittel, und die Menschen standen Schlange.
Und wenn sich Tausende von Frauen aufopfernd um ihre heimgekehrten Männer kümmerten, dann wusste er, dass Tausende von Schwerverletzten in die Heimat geschickt worden waren, weil man sie in den Lazaretts und staatlichen Erholungsheimen nicht versorgen konnte.
Es wurde so schlimm, dass er alles, aber wirklich alles hinterfragte. Dass er sich ständig überlegte, was meint mein Gegenüber damit? Nie war die einfachste, die am nächsten liegende Auslegung die richtige. Es gab immer noch ein, zwei andere. Und die wahrscheinlich abwegigste war vermutlich die richtige.
Obgleich er seinem Enkel die alleinige Verwaltung des Gutes nicht zutraute und ihn auch charakterlich nicht für geeignet hielt, zog er sich immer mehr von seiner Arbeit zurück. Beinahe täglich hatte er Petermann zu Gast und schickte auf dessen Hof einen von seinen Tagelöhnern als Ersatz. Er ließ sich erzählen vom Stellungskrieg, vom Trommelfeuer, vom Giftgas, von den Verwundeten und Toten.
Und über alles führte er Buch.
Und wenn ein anderer Soldat auf Heimaturlaub kam, dann bat er ihn auf das Gut, befragte ihn und schrieb alles gewissenhaft auf.
„Woher weißt du, dass sie die Wahrheit sagen und nicht nur erzählen, was du hören willst?“, wagte einmal seine Frau beim Frühstück zu fragen.
„Die haben das erlebt! Warum sollten sie lügen?“, war seine Antwort, und er stand auf, ohne dass er seine Tasse leer getrunken hätte, und ging in sein Zimmer.
Er war an einem Punkt in seinem Leben angekommen, den er nie für möglich gehalten hätte. Alles, woran er einmal geglaubt hatte, war nichts mehr wert. Ehre, Treue, Tapferkeit waren leere Worthülsen geworden.
Er konnte sich nicht vorstellen, dass diese Begriffe einem jungen Menschen noch vermittelbar waren, wenn er selbst sie schon in Zweifel zog.
Und der, der bisher fast wie ein Gott über ihnen gestanden hatte, ihr „geliebter“ Kaiser, ihr „oberster Kriegsherr und Friedensfürst“, was war aus ihm geworden?
Fragt die Frauen und Kinder der vielen Toten und Invaliden, ob sie den Kaiser lieben!
Fragt die Generäle nach den Qualitäten ihres Kriegsherren!
Und fragt alle, die unter dem Krieg tagtäglich ächzen, wann endlich ihr Friedensfürst seine Stimme erhebt!
Immer öfter ertappte er sich dabei, dass er seine Duellpistolen aus dem Schreibtisch zog und betrachtete. Er dachte dabei an nichts Bestimmtes, aber es beunruhigte ihn doch, wenn er sie in seiner Hand spürte.
Nicht, dass er sich das Leben nehmen wollte. Er war schließlich nicht sein Schwiegersohn. Und er hatte die Verantwortung für das Gut und die Menschen in den umliegenden Dörfern. Und für seine Familie. Jedenfalls so lange, bis Max wieder nach Hause käme.
Max, dachte er, ja Max, das war ein Mensch, von dem es mehr geben müsste. Er hatte Verantwortung übernommen, schon lange, bevor er in die Familie aufgenommen worden war. Verantwortung für das Gut und die vom Gut abhängigen Bauern. Und sicher würde er sie auch in Zukunft übernehmen. Ihm würde er wieder die Verwaltung des Gutes übertragen. Und später, nach seinem Tod, würde er das Gut übernehmen.
Die entsprechenden Papiere hatte er erst kürzlich unterzeichnet. Er wollte nichts dem Zufall überlassen.
Das Verhältnis zwischen Großvater und Enkel gestaltete sich immer schwieriger. Ludwig, fest davon überzeugt, er würde das Gut einmal übernehmen, spielte sich immer mehr als Herr auf. Hoch zu Ross preschte er über den Gutshof, um seine Befehle zu erteilen. Trieb die Tagelöhner, Knechte und Mägde zur Eile an, drohte mit Entlassung, wenn die Arbeit nicht in der vorgegeben Zeit geschafft wurde.
„Ihr seid nicht hier, um zu faulenzen! Hunderte warten auf eine Anstellung!“
Und wenn mal jemand wagte zu murren, dann wurde er entlassen. Ohne jede Rücksicht.
Als er einen Tagelöhner mitten im Winter mit der Peitsche vom Hof jagte, weil er angeblich schlecht gearbeitet hatte, entschloss sich der Baron, sich doch wieder um sein Gut zu kümmern.
Er rief seine Tochter zu sich und eröffnete ihr, er würde ihren Sohn entlassen. In spätestens einem Monat hätte er das Gut zu verlassen. Er hätte schließlich den Hof in Friedrichshagen, den solle er bewirtschaften.
Luise war betroffen, aber sie hatte diese Entwicklung kommen sehen. Natürlich war ihr nicht verborgen geblieben, wie Ludwig sich gebärdete.
„Herrisch ist er geworden. Ich bekomme langsam Angst vor ihm. Wie soll das bloß enden?“, hatte sie nicht nur einmal zu ihrer Mutter gesagt.
Der Abschied war kurz und schmerzlos.
Der Baron ließ sich gar nicht sehen. Er hatte seinem Enkel zwei Leiterwagen zur Verfügung gestellt, auf denen er einiges Ackergerät und Werkzeug befördern konnte, das er als Starthilfe betrachten sollte. Dazu hatte er ihm etwas Bargeld ausgehändigt, praktisch den Lohn für seine Arbeit als Verwalter.
Seine Großmutter fand die Reaktion ihres Mannes zu hart und jammerte ohne Unterlass.
Luises Gefühle schwankten. Sie billigte Ludwigs Verhalten in keiner Weise, und sie verstand ihren Vater.
Aber es war ihr Sohn.
Nur die beiden Knechte, die Ludwig bis nach Friedrichshagen begleiten sollten, standen auf dem Hof und warteten darauf, den Kutschbock zu besteigen.
Ludwig nahm seine Großmutter und Mutter kurz in den Arm, saß auf und gab den Knechten das Zeichen zum Aufbruch, und der kleine Wagenzug setzte sich in Bewegung.
„Schreib bald!“, rief die Großmutter noch.
Aber Ludwig reagierte nicht.
Er hatte es wohl nicht gehört.
Es war das letzte Mal, dass sie ihren Enkel sah.