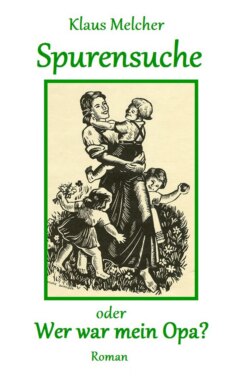Читать книгу Spurensuche - Klaus Melcher - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6. Kapitel
ОглавлениеDollien, August 1914
Den ganzen Nachmittag war Luise mit den Kindern an einem der vielen kleinen Seen gewesen, die zu dem Gut gehörten. Sie liebte diesen Platz, eine Wiese am Rande eines kleinen Kiefernwaldes. Wie eine Halbinsel streckte sich diese Badestelle in das klare Wasser.
Vor Jahren, als sie noch Kinder waren, hatte ihr Vater hier eine Badehütte und einen Bootssteg bauen lassen, hatte dann aber kaum Zeit gefunden, mit seiner Familie hier die Sommernachmittage zu verbringen. Mag auch sein, dass ihn nur die Ruhe langweilte. Luise sah ihn noch vor sich, wie er steif und schweigend auf der Decke saß, vollkommen bekleidet, einen Strohhut auf dem Kopf. Ein schreiend stiller Vorwurf.
Irgendwann hatte es ihrer Mutter gereicht.
„Du musst nicht mitkommen“, hatte sie gesagt, „du verdirbst uns nur den Spaß.“
Er war dankbar – und sie genossen von nun an die Nachmittage allein
***
Als Luise die Halle betrat, fiel ihr sofort die ungewohnte Betriebsamkeit auf. Die Köchin, die um diese Zeit grundsätzlich in der Küche zu tun hatte, und sich bisher immer erfolgreich dagegen gewehrt hatte, irgendwelche Aufgaben außerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches zu übernehmen, kam von der Galerie geeilt, verschwand im Arbeitszimmer und lief gleich wieder nach oben.
Hans, der erste Knecht, hastete ins Arbeitszimmer, empfing irgendeinen Befehl und verschwand in der Remise.
„Was um alles in der Welt ist hier los?“, wandte sie sich an die erste, die sie anhalten konnte.
„Krieg! Wir haben Krieg!“, rief die alte Wirtschafterin und verschwand im Wirtschaftsraum.
Langsam ging Luise durch die Halle und trat in den Salon. Auf der gegenüberliegenden Seite stand ihre Mutter und sah aus dem Fenster. Sie schien sie nicht bemerkt zu haben, jedenfalls sagte sie nichts und sah sich auch nicht um.
Endlos lange schien sie so zu stehen, völlig erstarrt, die Arme an den Körper gepresst, die Hände zu Fäusten geballt.
Luise durchzuckte ein Gedanke, der sie erschrecken ließ. Zum ersten Mal nach Achims Tod bedauerte sie die Frauen, deren Männer noch am Leben waren.
„Muss Vater?“ Sie war zu ihrer Mutter getreten.
„Nein, noch nicht. Er muss sich nur in Bereitschaft halten. Aber deine Brüder, alle drei.“
Es war erstaunlich. Obgleich die ganze Welt mit Deutschland im Krieg lag, änderte sich in Dollien nichts. Zuerst hatten die Kriegserklärungen Deutschlands die Straßen gefüllt, hatten den Kriegerverein mobilisiert, hatten ein Meer von schwarz-weiß-roten Fahnen an die Häuser gezaubert, die die Schäbigkeit der meisten Fassaden mit ihrer vaterländischen Euphorie übertünchten.
Jetzt war man Deutscher.
Mehr noch, man war Nibelunge.
Glücklich schätzte sich der, der in dieser Zeit lebte, vor allem der Mann, der das Glück hatte, für Kaiser und Vaterland in den Krieg ziehen zu dürfen.
Luise sah diese Kinder.
Kinder waren es in ihren Augen, die sich auf dem Marktplatz versammelten und darauf warteten, nach Friedrichswalde gefahren zu werden, um dann in den Zug nach Potsdam oder Berlin zu steigen.
An den Haaren hätte sie sie von den Wagen wegziehen mögen, sie ohrfeigen, bis sie ganz kleinlaut zu ihren Müttern zurückkehren würden.
Sie wusste, sie könnte es nicht. Und wenn sie es versuchen würde, sie anschreien würde, dass der Krieg kein Kinderspiel wäre, dass sie alle sterben würden, nein, krepieren würden, den Mund voll gestopft nicht mit französischer Ente, sondern französischer Erde, Dreck und Schlamm, es würde nichts nützen.
Schon sangen sie, siegestrunken, ihre vaterländischen Lieder.
Wo hatten sie die so schnell gelernt? Luise konnte sich nicht erinnern, von ihren Kindern gehört zu haben, dass man sie in der Schule eingeübt hatte. Text und Melodie.
Und immer wieder schallte es: „Weihnachten sehen wir uns wieder!“
Bis der Apotheker und Leiter des Männergesangsvereins nach vorne trat, die Sänger Aufstellung nahmen und das schreckliche Lied „Heil dir im Siegerkranz“ intonierten.
Was bringt erwachsene Männer nur dazu, solchen Schwachsinn zu singen? fragte sie sich. Aber da sah sie die leuchtenden Gesichter der Sänger, die strahlenden Augen der jungen Männer auf ihren Karren, die sie – sie stockte, wollte den Gedanken verdrängen, vergeblich, er kehrte immer wieder – zum Schafott bringen sollten.
Weg, weg von hier!
Sie floh von diesem Platz, weg von dieser grauenhaften Fröhlichkeit.
Am Gasthaus „Unter der Linde“ hatte sie ihr Pferd festgebunden. Eilig band sie es los, bestieg den Landauer und fuhr durch die weiten Felder zurück zum Gutshaus.
Das Korn war schon fast reif, goldgelb hob es sich vom blauen Himmel ab, an dem sich nur einige Schönwetterwolken aufplusterten.
Bald würde man ernten. Und das war auch gut so. Da kam man nicht zum Nachdenken.
Man durfte nicht nachdenken. Oder man würde verrückt werden.
Luise unterließ es, ihren Eltern von ihren Erlebnissen am Nachmittag zu erzählen. Sie hätten sie nicht verstanden, und es hätte nur Streit gegeben.
Warum sollte man den auch noch heraufbeschwören?
***
Es hatte sich so ergeben, ganz zufällig und unbemerkt von allen.
Ohne dass es eine Heimlichkeit gegeben hätte.
Es geschah so unauffällig wie eine Stunde verstreicht, wenn man nicht in Eile ist, oder das Korn reif wird und man nicht darauf wartet, weil das Wetter nicht umzuschlagen droht.
Wenn man es merkt, ist es zu spät. Man kann nicht mehr eingreifen, kann sich nur mit den Gegebenheiten abfinden, versuchen, das Beste daraus zu machen und es zu genießen.
Die letzten Tage hatten gereicht, das Korn reifen zu lassen. Kerzengerade stand es auf dem Halm. Eine goldene Pracht, so weit das Auge reichte. Kein Hagelschauer war niedergegangen, keine Bö hineingefahren.
Es war Zeit zum Mähen.
Es fehlte nur die Anweisung des Barons. Und der war jetzt ausgerechnet in Berlin. Sein Verwalter hatte alle Vollmachten, und er hatte bisher in einem solchen Falle immer zur Zufriedenheit des Barons gehandelt, doch diesmal zögerte er.
Er ging ins Herrenhaus und fragte nach Ludwig.
„Wollen wir ernten, was meinen Sie?“, fragte er, als Ludwig vor ihm stand.
Ludwig sah ihn erstaunt an. Max von Walther hatte ihn immer respektiert und ihm das Gefühl gegeben, er sei gleichberechtigt, doch dass er ihn fragte, war noch nicht vorgekommen. Natürlich würde er doch tun, was er für richtig hielt, unabhängig von Ludwigs Meinung, schließlich hatte er die Erfahrung – und trug er die Verantwortung, aber es schmeichelte doch sehr.
„Ich denke, ja. Oder?“, antwortete Ludwig. Und damit war beschlossen, übermorgen würde geerntet werden.
„Warum erst übermorgen?“, fragte Clementine.
Sie hatte das Gespräch ihres Bruders mit Max von Walther mitgehört und sich gewundert, dass Männer so eine einfache Sache wie Korn Mähen so kompliziert machen konnten. Was war schon dabei, ein paar Halme abzusäbeln?
Sie nahm sich vor, das Max zu fragen.
Sie spürte, wie ihr das Blut in den Kopf schoss. Wie kam sie dazu, den Verwalter einfach Max zu nennen? Sie war keineswegs vertraut mit ihm. Hatte immer die nötige Distanz gewahrt, die gleiche, die er auch wahrte. Als hätten sie sich abgesprochen: bis hier und nicht weiter! Mal ein Scherz, vielleicht ein koketter Blick als Dank für seine Hilfe beim Satteln des Pferdes, wie zufällig eingefangen. Vielleicht wäre sie auch mit weniger Hilfestellung in den Sattel gekommen. Aber sie genoss diese Hilfe.
Es war doch nichts dabei.
Sie war nicht verliebt. Da war sie sich ganz sicher.
Max – sie hatte einfach für sich beschlossen, von Walther nur noch beim Vornamen zu nennen – war schließlich Verwalter bei ihrem Großvater, mehr nicht.
Aber er sah doch verdammt gut aus. Vor allem seine Augen. Stundenlang könnte sie in diese Augen sehen. Wenn er ihren Blick auffing, wurde sie immer ganz verlegen. Das war schon sehr früh geschehen, nicht erst jetzt. Aber jetzt sah sie ihm öfter in die Augen, heimlich. Und wenn er es merkte, lachte sie und sagte: „Sie haben da einen braunen Punkt.“
Wenn er es nicht schon wusste, inzwischen wusste er es ganz sicher. So oft hatte er es gehört. Aber er sagte es nicht. Er ließ ihr ihre kleine Schwärmerei.
Max und Ludwig waren gemeinsam aufgebrochen, um die Felder, die zu mähen waren, abzureiten, um die Erntehelfer einzuteilen.
Bisher hatten sie den Sommerweg am Rande der Chaussee gewählt, doch jetzt mussten sie sich trennen. Links und rechts ging es auf Sandwegen in die endlosen Kornfelder, die nur hier und dort durch einige kleinere Baumgruppen unterbrochen wurden.
Ein paar Stunden würden sie in der Sommernachmittagshitze aushalten müssen, bis sie gegen Abend im Herrenhaus ankommen würden.
Während Ludwig die Felder östlich der Straße übernommen hatte, lenkte Max von Walther sein Pferd auf den westlichen Teil des Gutes. Hier lagen die Felder nicht alle beisammen, waren durch Bäche und keine Waldstreifen getrennt. Ludwig war noch nicht hier gewesen, hier musste sich jemand umsehen, der sich auskannte.
Vor Max lag der Ellenbogen, dieser schmale Heidegürtel, bewachsen mit Birken, Büschen und gedrungenen Kiefern. Und natürlich Heidekraut und Wacholder. Nur drei- oder viermal im Jahr kam er in diese abgelegene Gegend. Dann machte er, wenn es die Arbeit erlaubte, einen Abstecher zu dem kleinen See. Weiher, wäre eigentlich passender. Er hatte nicht einmal einen Namen, war auf keiner Karte verzeichnet. Aber er hatte einen ungeheuren Reiz. Das Wasser war dunkel und doch kristallklar. In allen Farben schillernde Libellen standen über den Seerosen, die fast die Hälfte des Sees bedeckten. Schossen durch die Luft und blieben wieder ruckartig stehen, um sich gleich wieder hochzuschrauben oder zu senken.
Diese Tiere hatten ihn schon immer fasziniert. Das müssten Menschen können, dachte er. Ein Wunschtraum der Menschheit würde in Erfüllung gehen.
Aber es würde wohl ein Wunschtraum bleiben.
Beide hatten nicht damit gerechnet, sich hier zu begegnen, und doch waren sie nicht erstaunt oder gar erschrocken, wie es sich zumindest für Clementine gehört hätte. Kein „Uch!“, kein hektisches Zusammenraffen des Kleides.
Sie saß auf dem schmalen Sandstreifen am Rande des Sees, hatte die Beine angezogen und hielt ihre Knie umklammert. Den Kopf hatte sie auf die Knie gelegt und sah wie selbstvergessen über die Wasserfläche.
Als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt, trat Max näher, zog seinen Hut, der ihn bisher vor der Sonne geschützt hatte, und blieb neben ihr stehen.
„Darf ich?“, fragte er und setzte sich, als sie nickte.
„Das ist nicht ungefährlich, ohne Begleitung hierher zu reiten“, versuchte er eine Unterhaltung, und als sie nicht reagierte, „man kann sich leicht verirren. Hierher findet man leicht, aber zurück? Da sieht alles gleich aus.“
Als sie immer noch nicht reagierte, sondern ihn nur aus seltsam traurigen, fast verlorenen Augen ansah, hätte er sich schlagen können. Warum musste er so plump sein?
„Verzeihen Sie, ich war nicht ganz anwesend.“
Sie machte eine Pause und blickte wieder über den See.
„Wissen Sie, ich mache mir Vorwürfe. Uns geht es gut, wir haben alles, was wir brauchen, vielleicht auch etwas mehr. Und unsere Männer sind im Krieg. Glauben Sie, dass sie glücklich sind, wenn sie für ihren Kaiser und das Reich krepieren?
Glauben Sie, dass sie ‚Heil dir im Siegerkranz’ singen, wenn sie von einer Granate zerrissen werden? Glauben Sie, dass sie ihren obersten Kriegsherrn preisen werden, wenn ihnen ein Bein amputiert wird – oder zwei?“
Von Walther wollte etwas sagen, irgendetwas, das sie beruhigen, auf andere Gedanken bringen könnte. Ihm fiel nichts ein. Sie hatte ja Recht. Auch er konnte diese Begeisterung nicht verstehen, doch deshalb machte er sich keine Vorwürfe. Er hatte nicht den Krieg erklärt, seinen Ausbruch nicht gefeiert. Ihn traf keine Schuld. Wie viel weniger erst dieses junge Mädchen!
„Erinnern Sie sich an den Christian, den Sohn von der Frau Wolf? Er war einer der Lautesten. Zu Fuß wäre er an die Front gelaufen. Ließ sich nicht halten, so sehr ihn seine Mutter auch bat. Beschworen haben wir ihn. Er sei verantwortlich für die Familie, jetzt wo sein Vater krank sei. Wissen Sie, was er geantwortet hat? Er sei verantwortlich für Deutschland. – Und nun“, flüsterte sie, „ist er tot.“
Max von Walther machte gar nicht den Versuch, Clementine abzulenken oder gar aufzuheitern, und so ritten die beiden schweigend nebeneinander her. „Entschuldigen Sie, ich muss nur kurz den Weizen prüfen“, unterbrach von Walther das Schweigen, schwang sich vom Pferd, griff ein paar Ähren und zerrieb sie in den Händen. Er betrachtete den Inhalt, probierte einige Körner und warf die restlichen auf das Feld.
Das machte er noch einige Male, bis sie wieder die Chaussee erreicht hatten.
„Bitte, sagen Sie nichts meiner Mutter“, bat Clementine, als sie die Pferde versorgten.
***
Fünf Tage lag die Ernte zurück, fünf Tage mit Sonnenschein, wolkenlosem Himmel, Hitze. Die Luft flirrte und war immer noch voller Kornstaub.
Es war wie in jedem Jahr. Die Bauern waren entlassen und brachten ihre eigene Ernte ein.
Nur die Helfer, die Max von Walther angeworben hatte, waren noch auf dem Gut. Hinten, hinter der großen Scheune war ihre Unterkunft, ein eingeschossiges Fachwerkhaus, das zwei Schlafsäle mit je 12 Betten, zwei Waschräume und einen großen Aufenthaltsraum beherbergte. Da die Arbeiter aus der Gutsküche versorgt wurden, hatte man auf eine Kochstelle im Haus verzichtet, schon aus Feuerschutzgründen. Aus dem ursprünglich als Küche vorgesehenen Raum hatte man die gemauerten Herde und Spülbecken entfernt und nutzte ihn jetzt als Lager für Strohsäcke, stapelte Bettgestelle und brachte alles unter, was in der Unterkunft irgendwann mal gebraucht werden könnte.
Selbst ein kleines Krankenzimmer mit zwei Betten, einem einfachen Behandlungsstuhl, einem runden Waschtisch und einem Medizinschrank an der Wand war vorhanden. Er wurde selten gebraucht, aber der Baron war stolz darauf, ihn eingerichtet zu haben.
„Man kann nie wissen“, hatte er gesagt, „irgendwann passiert was. Der Arzt kommt schneller hierher als der Kranke zum Arzt.“
Mit schnellen Schritten eilte Bettina von Wernher über den Gutshof zur Unterkunft der Erntehelfer.
„Wo ist er?“, rief sie schon vom Eingang, als sie die Tür geöffnet hatte.
Die Männer zeigten auf den zweiten Schlafsaal und machten den Weg frei. Dort saß einer von ihnen, kreidebleich und hielt sich sein Bein.
„Lassen Sie mal los“, bat sie und zog vorsichtig das Hosenbein nach oben.
Der Mann hatte sich eine scheußliche Wunde am Schienbein zugezogen. Er hatte seine Sense gedengelt, und beim Prüfen hatte er nicht aufgepasst.
„Sie bleiben erst mal hier“, verfügte sie und versorgte die Wunde notdürftig.
„Das muss sich ein Arzt ansehen.“
Während sie auf den Arzt warteten, entschied sie: Sie würde Krankenschwester werden. Und bis sie alt genug für die Ausbildung wäre, würde sie bei Dr. Hellmann lernen.
Wenn er sie nähme.