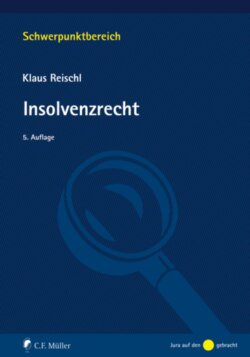Читать книгу Insolvenzrecht - Klaus Reischl - Страница 88
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Gesellschaftsrechtliche Auswirkungen
Оглавление191
Ist die Schuldnerin als Gesellschaft organisiert, hat die Insolvenzeröffnung deren Auflösung zur Folge (§§ 262 Abs. 1 Nr 3 AktG, 60 Abs. 1 Nr 4 GmbHG, 101 GenG, 131 Abs. 1 Nr 3, 161 Abs. 2 HGB, 42 Abs. 1 BGB, 728 Abs. 1 BGB, 9 PartG). Die Gesellschaft wird in das Abwicklungsstadium übergeführt, wobei die Insolvenzverwaltung das Liquidationsverfahren im Sinne der gesellschaftsrechtlichen Vorschriften (§§ 262 ff AktG, 83 ff GenG, 10 PartG, 145 ff, 161 Abs. 2 HGB, 47 ff BGB) vollständig verdrängt, da es erst nach Vollbeendigung aufgehoben wird (§ 199 S. 2 InsO).
Im eröffneten Insolvenzverfahren bleibt die Struktur der Gesellschaft bestehen, so dass die Organträger zwar weiterhin im Amt sind, ihre Kompetenzen jedoch nur noch wahrnehmen können, soweit diese nicht auf den Insolvenzverwalter übergegangen sind. Den Organen sind alle Befugnisse hinsichtlich des insolvenzfreien Vermögens sowie die innergesellschaftliche Organisation (zB Gesellschafterversammlungen, Wahl und Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern, Anmeldungen beim Handelsregister, Gewinnfeststellung) als sog. insolvenzneutraler Schuldnerbereich vorbehalten[29], außerdem spielen sie gegenüber dem Insolvenzverwalter die Rolle des Schuldners (§ 101 InsO). Infolge der Trennung zwischen Bestellungsakt und Anstellungsvertrag kann und wird der Insolvenzverwalter diesen Vertrag kündigen, weil er durch die Insolvenzeröffnung nicht beendet wird (§§ 108 Abs. 1, 113 InsO). Die Kündigung kann ggf auch fristlos wegen Unzumutbarkeit erfolgen (§ 626 Abs. 1 BGB), nämlich wenn den Geschäftsführern – wie so häufig – Insolvenzdelikte, wie Antragsverschleppung, vorgeworfen werden können[30] oder wenn diesbezüglich zumindest hinreichender Verdacht besteht.
192
Wird das Insolvenzverfahren nur über das Vermögen eines Mitglieds einer juristischen Person eröffnet, führt dies nicht zur Auflösung der Gesellschaft, sondern allenfalls zum satzungsmäßigen Ausscheiden oder zur Einziehung des Anteils gegen Abfindung, die vom Insolvenzverwalter einzuziehen ist. Entsprechendes gilt für OHG, KG und Partnerschaftsgesellschaft, lediglich bei der BGB-Gesellschaft führt die Insolvenzeröffnung bei Gesellschaftern zunächst zur Auflösung (§ 728 Abs. 2 S. 1 BGB), soweit keine Fortsetzung (§ 736 BGB) vereinbart worden ist, die wiederum einen Abfindungsanspruch (§ 738 BGB) begründet, der zur Insolvenzmasse gehört. Dabei ist die gesellschaftsrechtliche Durchsetzungssperre zu beachten, wonach vom Ausgeschiedenen (bzw dessen Insolvenzverwalter) grundsätzlich keine Einzelansprüche mehr geltend gemacht werden können, sondern nur noch ein sich aus der Abfindungsbilanz ergebender etwaiger Überschuss. Eine Abfindungsausschlussklausel ist unwirksam und könnte unter Umständen auch angefochten werden, vgl §§ 133, 134 InsO. Handelt es sich um eine Zweipersonengesellschaft mit Fortsetzungsklausel, kommt es bei Ausscheiden eines Gesellschafters zur liquidationslosen Vollbeendigung unter Anwachsung des Restvermögens beim anderen Gesellschafter; ein gleichwohl ergehender Eröffnungsbeschluss über das Vermögen der GbR ist nichtig, da der Schuldner nicht (mehr) existent ist[31].
Soweit die Insolvenz zu einer Teilung einer Gemeinschaft oder zur Auseinandersetzung einer Gesellschaft führt, richten sich diese Vorgänge nach den allgemeinen Vorschriften, nicht nach dem Insolvenzrecht, § 84 Abs. 1 S. 1 InsO. Das bedeutet jedoch nicht, dass dadurch insolvenzrechtliche Vorschriften zwischen dem Schuldner (Insolvenzverwalter) und den Gesellschaftern ausgeschlossen werden, insbesondere gelten dort natürlich die §§ 129 ff, 96 Abs. 1 Nr 3 InsO[32]. Dabei ist aber zu beachten, dass die im Rahmen der Abfindungsbilanz vorzunehmende Saldierung der aktiven und passiven Rechnungspositionen im Sinne einer Kontenangleichung keine gem § 96 Abs. 1 Nr 3 InsO unzulässige Aufrechnung darstellt; auch hier kann also der Insolvenzverwalter nur ein etwaiges Auseinandersetzungsguthaben verlangen, nicht aber auf Einzelpositionen zugreifen[33].
193
Ein Hauptthema der Insolvenz einer Kapitalgesellschaft sind schließlich die Haftungsansprüche, die der Insolvenzverwalter (vgl § 92 InsO) gegen den Geschäftsleiter wegen Pflichtverletzungen geltend machen kann. Insoweit kommen insbesondere die §§ 43, 64 GmbHG sowie § 823 Abs. 2 iVm § 15a InsO oder § 263 StGB in Betracht. Nach § 43 Abs. 1 GmbHG ist der GmbH-Geschäftsführer stets verpflichtet, die Vermögensinteressen der Gesellschaft bestmöglich zu wahren. Diese Haftung verschärft sich mit objektivem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, denn ab diesem Zeitpunkt haftet der Geschäftsführer persönlich für alle erdenklichen Masseschmälerungen nach § 64 S. 1 GmbHG, sofern er damit nicht konkrete Vorteile für die Gläubiger einkauft oder einer Pflichtenkollisionen mit Strafnormen (zB § 266a StGB) ausgesetzt ist. Ansprüche aus § 823 Abs. 2 BGB iVm § 15a InsO oder 263 StGB können insbesondere von Neugläubigern gegen den Geschäftsführer persönlich geltend gemacht werden, wenn diese nach Eintritt der Insolvenzreife Schäden erlitten haben, zB durch unbezahlt gebliebene Warenbestellungen des Schuldners; diese Einbußen fallen als Individualschäden nicht unter das Insolvenzverwaltervorrecht nach § 92 InsO[34]. Da das Privatvermögen der Geschäftsführer insolventer Gesellschaften meistens begrenzt ist und nach Insolvenzeröffnung regelmäßig weitere Individualgläubiger auf ihn zukommen (zB das Finanzamt nach § 69 AO oder die Krankenkasse nach §§ 823 Abs. 2 BGB, 266a StGB), wird der Insolvenzverwalter durch Abschluss eines Vergleichs versuchen, noch an Geld zu kommen. Unbeschadet des gesetzlichen Verzichts- und Vergleichsgebotes nach § 9b Abs. 1 GmbHG sind derartige Vereinbarungen jedenfalls dann nicht pflichtwidrig, wenn sie von der Gläubigerversammlung gebilligt worden sind, § 160 Abs. 2 Nr 3 InsO. Dem wird zwar vereinzelt die Indisponibilität dieser Verbotsvorschriften entgegengehalten[35]. Aber das Insolvenzverfahren ist nach Eröffnung in Gläubigerhand (Rn 20), so dass sich in Bezug auf Verwertungs- und Befriedigungsfragen die Beschlüsse der institutionalisierten Gläubigerversammlung auch gegenüber abweichenden gesetzlichen Vorschriften durchsetzen.
§ 5 Die Rechtswirkungen der Insolvenzeröffnung › II. Die Verfahrenseröffnung aus Sicht des Insolvenzverwalters