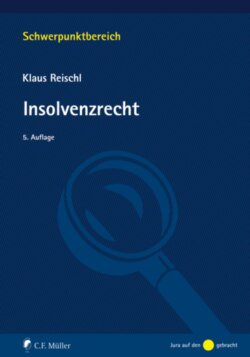Читать книгу Insolvenzrecht - Klaus Reischl - Страница 91
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Rechtliche Stellung des Insolvenzverwalters
Оглавление201
Weder KO noch InsO enthalten eine direkte Aussage zur Rechtsstellung des Insolvenzverwalters, so dass seit jeher ein Theorienstreit[41] darüber geführt wird. Durchgesetzt hat sich dabei die sog. Amtstheorie[42], vor allem auch, weil sie sich als brauchbar erwiesen hat. Danach handelt der Insolvenzverwalter zwar im eigenen Namen, aber er übt dabei als Amtstreuhänder die vermögensbezogenen Rechtsbefugnisse des Schuldners aus, dem diese mit Verfahrenseröffnung entzogen und zur Sicherung auf den Insolvenzverwalter übertragen wurden (§ 80 Abs. 1 InsO). Amt und Tätigkeit des Insolvenzverwalters sind rein privatrechtlich[43], seine Befugnisse schöpft er jedoch aus dem gerichtlichen Bestellungsbeschluss sowie den konkretisierenden Regelungen der InsO. Damit lassen sich zum Beispiel Verfügungen, Verpflichtungen sowie Freigabeerklärungen (vgl Rn 270) des Insolvenzverwalters systemkonform als Betätigungen der auf ihn übergegangenen schuldnerischen Befugnisse bezüglich des verwalteten Vermögens erklären.
202
Die frühere sog. Vertretertheorie[44] betrachtete den Insolvenzverwalter als Vertreter der Gläubiger[45] und fand damit Anhänger vor allem außerhalb des Insolvenzrechts. In neuerer Zeit wurde dieser Ansatz zu einer modifizierten Vertretungs- oder Repräsentationstheorie weiterentwickelt, die den Insolvenzverwalter nur bei natürlichen Personen als Vertreter (mit Massebegrenzung), bei Gesellschaften hingegen als Organ betrachtet[46]. Hiergegen wird vor allem eingewandt, dass ein Vertreter (selbst unter Bindung an den Verfahrenszweck und Begrenzung auf die Masse) nicht mehr Rechte haben kann, als der Vertretene selbst. Dies ist beim Insolvenzverwalter jedoch schon wegen der Anfechtungsmöglichkeiten (§§ 129 ff InsO) sowie der Befugnisse nach §§ 92, 93 InsO sehr wohl der Fall[47]. Man wird sich nach Beschäftigung mit den entwickelten Theorien der Erkenntnis nicht verschließen können, dass sich die Kompetenzen und Wirkungen des Insolvenzverwalters nicht auf ein zu Grunde liegendes System zurückführen lassen, sondern zweckgeprägt aus der InsO herauszulesen sind, die stark von wirtschaftlichen Kategorien geprägt ist (siehe Rn 7 ff); eines „Transformators“ im Sinne einer Theorie bedarf es nicht[48]. Insbesondere schaffen auch die hier dargestellten Theorien keine besseren oder effektiveren Strukturen als die in Rn 201 skizzierte Amtstheorie[49].
203
Den bloßen Vermögensbezug des Verwalterhandelns offengelegt hatte ursprünglich die sog. Organtheorie, nach deren Grundthese die Masse als rechtlich selbstständiges Subjekt anzusehen sei, dem der Insolvenzverwalter als Organ vorstehe. Ihr ist aber nach wie vor das Fehlen einer entsprechenden gesetzlichen Regelung vorzuhalten, zudem bleibt der Schuldner weiterhin Eigentümer der Massegegenstände. Aus der in § 80 Abs. 1 InsO getroffenen Regelung einer Abspaltung von Rechtsbefugnissen ergibt sich zwangsläufig, dass die Masse kein eigenes Rechtssubjekt ist.
204
Tätigt der Insolvenzverwalter Verpflichtungs- oder Verfügungsgeschäfte für die Masse, nimmt er diese nicht für den Schuldner vor, ebenso wenig erhebt er eine Klage für diesen, sondern persönlich in seiner Eigenschaft „als Insolvenzverwalter über das Vermögen des Schuldners“[50]; benötigt der Insolvenzverwalter Prozesskostenhilfe, muss er diese in seiner Eigenschaft als Partei kraft Amtes beantragen, § 116 S. 1 Nr 1 ZPO. Auf der anderen Seite muss ein Gläubiger, der die Zwangsvollstreckung in einen Gegenstand der Insolvenzmasse betreibt, grundsätzlich eine Titelumschreibung auf den Insolvenzverwalter vornehmen lassen.
205
Zudem besteht eine strikte Trennung zwischen den unter den Insolvenzbeschlag fallenden Vermögenswerten der Insolvenzmasse und dem (wenig werthaltigen) insolvenzfreien Vermögen des Schuldners, §§ 35 Abs. 2, 36 InsO, über das der Insolvenzverwalter nicht verfügen kann.
206
Lösung Fall 11 (Rn 177):
Im Fall 11 kann K die Mängelrechte im Sinne von § 437 BGB trotz Ablaufs der an sich verkürzten (vgl § 475 Abs. 2 BGB) Verjährungsfrist geltend machen, wenn IV sich wegen § 444 BGB nicht auf die Haftungsbegrenzung berufen darf. Zudem könnte er den Kaufpreis nach § 812 Abs. 1 S. 1 BGB zurückverlangen, weil sein Rückzahlungsbegehren auch als (zivilrechtliche) Anfechtungserklärung im Sinne von §§ 143 Abs. 1, 123 Abs. 1 Var. 1 BGB auszulegen (§§ 133, 157 BGB) und der Vertrag damit nichtig geworden sein könnte, § 143 Abs. 1 BGB. In beiden Fällen ist zu beachten, dass die Täuschungshandlung noch von S begangen worden ist, während der Vertrag bereits mit IV zustande kam. Da IV (nach der Amtstheorie) im eigenen Namen und weder als Vertreter oder Wissensvertreter des Schuldners im Sinne von § 166 Abs. 1 BGB handelt, kommt es in Bezug auf Kenntnis und Kennenmüssen von Umständen auf den Insolvenzverwalter an[51]. Folglich ist der Schuldner auch als Dritter im Sinne von § 123 Abs. 2 BGB anzusehen, so dass sich ein Vertragspartner auf eine vom Schuldner vor Insolvenzeröffnung begangene arglistige Täuschung nur berufen kann, wenn der Insolvenzverwalter die Täuschung kannte oder kennen musste. Auch § 444 BGB greift nicht ein, so dass der Haftungsausschluss zu Gunsten der Masse wirkt.
Im Fall 11 kann daher K keine Ansprüche gegen die Insolvenzmasse erheben.
§ 5 Die Rechtswirkungen der Insolvenzeröffnung › II. Die Verfahrenseröffnung aus Sicht des Insolvenzverwalters › 3. Persönliche Haftung des Insolvenzverwalters