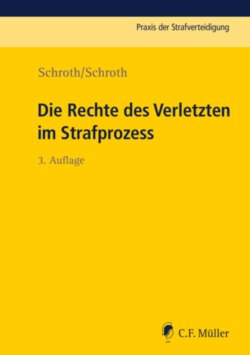Читать книгу Die Rechte des Verletzten im Strafprozess - Klaus Schroth - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеTeil 1 Die Entwicklung der Schutzrechte zugunsten des Verletzten › X. EU-Richtlinie über Mindeststandards für die Rechte und den Schutz von Opfern von Straftaten vom 25.10.2012
X. EU-Richtlinie über Mindeststandards für die Rechte und den Schutz von Opfern von Straftaten vom 25.10.2012
Teil 1 Die Entwicklung der Schutzrechte zugunsten des Verletzten › X. EU-Richtlinie über Mindeststandards für die Rechte und den Schutz von Opfern von Straftaten vom 25.10.2012 › 1. Vorgeschichte
1. Vorgeschichte
41
Bereits im Jahr 2001 hatte der ER einen „Rahmenbeschluss über die Stellung von Opfern im Strafverfahren“ erlassen, der auf eine grundlegende Angleichung der prozessualen Rechte von Verletzten in den Mitgliedsstaaten zielte, die durch Verbrechen zu Schaden gekommen waren. Die „Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25.10.2012 über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001/220/JI“[1] vom 14.11.2012 hatte die weitere Stärkung und Harmonisierung der Rechte von Verbrechen Betroffenen zum Ziel und diente nicht zuletzt auch der Umsetzung des „Stockholmer Programms“ des ER, in dem die Leitlinien der Union im Bereich der Innen- und Sicherheitspolitik für die Jahre 2010–2014 festgelegt worden waren. Dort wurde betont, dass jedenfalls bestimmte Gruppen von Verletzten einer besonderen Unterstützung sowie eines besonderen rechtlichen Schutzes bedürfen und dies einen „integrierten und koordinierten Ansatz“ auf dem Gebiet der Rechte des Verletzten erforderlich mache.[2] In Umsetzung dieser Bestrebungen erfolgte schließlich im Mai 2011 die Vorlage eines ganzen Maßnahmenpaketes zur Stärkung der Verletztenrechte in der EU, das auf drei Säulen stand: Einerseits einer „Mitteilung über die Stärkung der Opferrechte in der EU“[3], andererseits einem „Richtlinienvorschlag über Mindeststandards für die Rechte und den Schutz von Opfern von Straftaten sowie für die Opferhilfe“ und schließlich einem „Verordnungsvorschlag über die gegenseitige Anerkennung von Schutzmaßnahmen im Bereich des Zivilrechts“[4].[5]
Teil 1 Die Entwicklung der Schutzrechte zugunsten des Verletzten › X. EU-Richtlinie über Mindeststandards für die Rechte und den Schutz von Opfern von Straftaten vom 25.10.2012 › 2. Wesentlicher Inhalt
2. Wesentlicher Inhalt
42
Zu den wesentlichen Vorgaben in der EU-Richtlinie[6] gehörte ein weiter Verletztenbegriff, unter den alle natürlichen Personen fallen, die durch eine Straftat einen Schaden erlitten haben, unabhängig davon, ob dieser körperlicher, psychischer, seelischer oder wirtschaftlicher Natur ist. Ergänzend dazu wurde klargestellt, dass bei Tötungsdelikten auch nahe Familienangehörige des Getöteten als Verletzte angesehen werden, wobei hierunter gem. Art. 2 lit. a und b nicht nur Ehepartner oder Angehörige in direkter Linie, sondern auch Geschwister, Unterhaltsberechtigte und sogar auch diejenigen Personen gehören, die durch die Straftat den Lebensgefährten verloren haben. Dabei ist auffällig, dass bei natürlichen Personen ein denkbar weiter Anwendungsbereich eröffnet wurde, andererseits juristische Personen von der Richtlinie in keiner Weise erfasst sind.
In dem Bestreben, den Verletzten in die Lage zu versetzen, seine Rechte auch effektiv und vollumfänglich wahrnehmen zu können, wurden die Informationsrechte des Geschädigten weiter ausgestaltet. Grundlage dabei bildet Art. 3, wonach der Geschädigte das Recht hat, „zu verstehen und verstanden zu werden“, wodurch letztlich eine effektive und an der individuellen Situation des Verletzten angepasste Informationsweitergabe sichergestellt werden soll. Dies stellt letztlich eine Art Programmsatz dar, der die Praxis zu einem sensiblen Umgang mit dem Betroffenen und dessen individueller Situation anhalten soll. Soweit mögliche Sprachbarrieren eine sachgerechte Information des Betroffenen unmöglich machen, besteht gem. Art. 7 ein Anspruch auf Hinzuziehung eines Dolmetschers und Übersetzung der relevanten Schriftstücke. Bereits beim ersten Kontakt mit den Strafverfolgungsbehörden sind dem Verletzten gem. Art. 4 grundlegende Informationen über seine Rechte und den weiteren Verfahrensablauf zur Verfügung zu stellen. Des Weiteren hat der Verletzte gem. Art. 5 ff. einen Anspruch auf Informationen über Einstellungsentscheidungen, Ort und Zeitpunkt der Hauptverhandlung, die gegen den Täter erhobenen Beschuldigungen, ergangene rechtskräftige Entscheidungen, den Fortgang des Verfahrens sowie bspw. über den Umstand, dass der Beschuldigte aus der U-Haft geflohen oder freigelassen worden ist.
Neben der reinen Information sieht die Richtlinie auch verschiedene prozessuale Rechte für den Verletzten vor. Hierzu gehört etwa der Anspruch auf schriftliche Bestätigung der Anzeige gem. Art. 5 oder das Recht auf Gewährung rechtlichen Gehörs gem. Art. 10 der Richtlinie. Neben der Möglichkeit, Prozesskostenhilfe oder Erstattung der Auslagen gem. Art. 13 f. zu erhalten, wird dem Verletzten auch das Recht eingeräumt, Entscheidungen über den Verzicht auf Strafverfolgung gem. Art. 11 überprüfen zu lassen, wovon sowohl Verfahrenseinstellungen aufgrund nicht hinreichenden Tatverdachts, als auch aus Opportunitätsgründen erfasst sind. Einen weiteren Schwerpunkt der Richtlinien bildet der Anspruch des Geschädigten auf Wiedergutmachung und Entschädigung, wozu neben einer zeitnahen Rückgabe von Vermögenswerten gem. Art. 15 oder einer zügigen Entscheidung über die Entschädigung im Rahmen des Strafverfahrens gem. Art. 16, auch die in Art. 12 geregelte Pflicht der Mitgliedstaaten gehört, Wiedergutmachungsverfahren, sofern diese sachdienlich sind, vorzusehen. Allerdings wurden in diesem Punkt gleichzeitig wiederum einige einschränkende Bedingungen aufgestellt: So wird bspw. verlangt, dass das Ausgleichsverfahren im Interesse des Verletzten liegt, dieser darin einwilligt und die im Raume stehende Vereinbarung freiwillig erfolgt. Des Weiteren muss der Täter zumindest in wesentlichen Zügen geständig sein.
Schließlich befasst sich die Richtlinie auch noch mit Aspekten des Schutzes des Verletzten. Dabei geht es einerseits um den konkreten Schutz des Verletzten vor neuerlichen Übergriffen oder Einschüchterungsversuchen seitens des Täters andererseits soll eine sog. sekundäre Viktimisierung durch das Verfahren bzw. die übrigen Verfahrensbeteiligten vermieden werden. Art. 18 bezieht nicht nur den eigentlichen Verletzten in den Anwendungsbereich dieses Schutzes ein, sondern erweitert diesen auch auf dessen Familienangehörige. Während nach Art. 19 primär Begegnungen zwischen dem mutmaßlichen Täter und Geschädigten außerhalb der Hauptverhandlung zu vermeiden sind, gewährt Art. 20 das Recht, dass sich der Verletzte von einer Vertrauensperson begleiten lässt. Um einen angemessenen Umgang mit Verletzten mit besonderen Schutzbedürfnissen sicherzustellen, sieht Art. 23 diverse Maßnahmen vor, zu denen etwa eine möglichst schonende Ausgestaltung von Vernehmungen während des Ermittlungsverfahrens, gleichgeschlechtliche Vernehmungspersonen oder das Verhindern einer unnötigen Preisgabe von privaten Informationen im Rahmen der Hauptverhandlung gehört. Wann dem Verletzten ein besonderes Schutzbedürfnis zukommen soll, richtet sich nach Art. 22, wenngleich die dort geforderte, frühzeitige und individuelle Begutachtung und damit Festlegung der Verletzteneigenschaft zu deutlichen Spannungen mit der Unschuldsvermutung führt.[7]