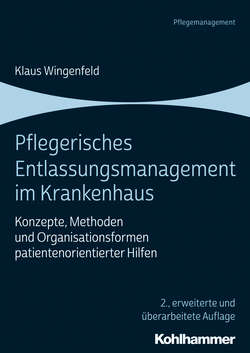Читать книгу Pflegerisches Entlassungsmanagement im Krankenhaus - Klaus Wingenfeld - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Welche Patienten benötigen Unterstützung?
ОглавлениеGenau genommen benötigen alle oder fast alle Patienten in irgendeiner Form Unterstützung, denn alle haben nach der Entlassung bestimmte Anforderungen im Umgang mit Krankheits- und Behandlungsfolgen zu beachten. Beispielsweise geht jede Operation mit einem Bedarf an Nachbehandlung und Maßnahmen der Selbstpflege einher. Sie stellt die Patienten daher vor bestimmte Erfordernisse. Dazu gehören Selbst- bzw. Symptombeobachtung, Arztbesuche, der Umgang mit der Operationswunde einschließlich der Einhaltung spezieller Hygienevorschriften, ggf. auch die Einnahme von Medikamenten und die Anpassung des Alltagshandelns (z. B. Vermeidung von Handlungen, die Scherkräfte im Bereich der Wunde auslösen, Umstellung von Freizeitaktivitäten etc.).
Häufig kann sich die Unterstützung, die dadurch notwendig wird, auf Information und Aufklärung durch einen Arzt beschränken. Ein strukturiertes Entlassungsgespräch, das grundsätzlich einen Bestandteil der medizinischen und pflegerischen Versorgung im Krankenhaus darstellen sollte, wird daher bei der Mehrheit der Patienten ausreichen. Aus zwei Gründen können jedoch weitergehende Hilfen notwendig sein:
1. Möglicherweise ergeben sich aus der Erkrankung oder der ärztlichen Behandlung ungewöhnlich hohe Anforderungen oder schwerwiegende Probleme, die das Wissen und die Fertigkeiten des Patienten übersteigen.
2. Es kann jedoch auch bei weniger komplexen Krankheitsfolgen zu einer Überforderung des Patienten kommen, wenn dessen Wissen und Fertigkeiten schon bei verhältnismäßig geringen Anforderungen an ihre Grenze stoßen – vielleicht bedingt durch gesundheitliche Störungen, vielleicht aber auch durch eine prekäre soziale Situation ( Abb. 2.2).
In beiden Fällen wird der Patient ohne Unterstützung nicht zurechtkommen, wodurch die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es zu Komplikationen kommt. Ein erhöhtes Risiko poststationärer Komplikationen ergibt sich also immer dadurch, dass die dem Patienten zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht ausreichen, um die Belastungen, Probleme und Anforderungen, die nach der Krankenhausentlassung auftreten, allein zu bewältigen. Diese Sichtweise steht übrigens in Einklang mit der Neufassung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs in der Pflegeversicherung, die seit 2017 verbindlich ist: Menschen benötigen pflegerische Unterstützung nicht, weil sie krank sind, sondern weil sie nicht über die Ressourcen verfügen, um gesundheitliche Probleme und ihre Folgen zu bewältigen.
Abb. 2.2: Probleme/Anforderungen und Ressourcen
Das initiale Assessment zielt im Grunde darauf ab, ein Ungleichgewicht zwischen Problemen/Anforderungen und Ressourcen aufzudecken, ohne sämtliche Einzelheiten in Erfahrung zu bringen. Kommt der Patient beispielsweise in dehydriertem Zustand im Krankenhaus an, so kann dies als Hinweis gelten, dass seine Ressourcen – einschließlich der Ressourcen seiner Umgebung – möglicherweise nicht ausreichen, um elementare gesundheitliche Anforderungen zu bewältigen. Dies gilt es dann im nächsten Schritt, d. h. mit dem differenzierten Assessment, näher zu prüfen.