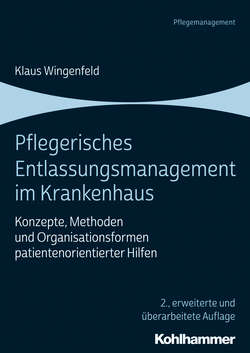Читать книгу Pflegerisches Entlassungsmanagement im Krankenhaus - Klaus Wingenfeld - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kriterien für das initiale Assessment
ОглавлениеEs ist bei manchen Patienten schwer zu entscheiden, ob ein hohes oder niedriges Risiko vorliegt. Denn von Bedeutung sind hierbei viele Faktoren, die in unterschiedlichen Kombinationen auftreten können bzw. unterschiedlich zusammenwirken. Der Expertenstandard liefert in dieser Hinsicht keine eindeutige Definition, er benennt nur die wichtigsten Faktoren, die beim initialen Assessment berücksichtigt werden sollten. Dies ist auch sinnvoll, weil damit den Krankenhäusern und ihren Fachabteilungen die Möglichkeit bleibt, eine Lösung zu finden, die zur jeweiligen Patientenstruktur und den verfügbaren Ressourcen passt. Das bedeutet allerdings: Eine Klärung bzw. eine konkrete Definition der Kriterien, mit denen das Risiko poststationärer Komplikationen erfasst werden kann, ist beim pflegerischen Entlassungsmanagement immer erforderlich.
Die Kriterien müssen insbesondere zwei Anforderungen erfüllen: Sie müssen genügend sensitiv sein, um alle Patienten mit einem erhöhten Risiko verlässlich zu erfassen. Sie müssen zugleich so definiert werden, dass ihre Verwendung ohne großen Zeitaufwand möglich ist. Komplizierte Einschätzungsmethoden oder umfangreiche Assessmentbögen haben im heutigen Krankenhausalltag keine Chance auf Verwendung. Im Idealfall wird ein Instrument genutzt, welches das Aufnahmegespräch mit dem Patienten oder seinen Angehörigen um nicht mehr als ein bis zwei Minuten verlängert. Weil alle Patienten im Hinblick auf poststationäre Risiken in den Blick genommen werden sollen (Screening), ist dieser Punkt von besonderer Bedeutung.
Aufgrund vieler Forschungsergebnisse ist bekannt, welche Kriterien besonders wichtig und aussagekräftig bei der Risikoermittlung sind (vgl. dazu Wingenfeld 2005). Dazu gehören:
• Ungeplante Wiederaufnahme: Ist beispielsweise bekannt, dass der Patient vor drei Wochen aus dem gleichen Krankenhaus entlassen und nunmehr ungeplant wiederaufgenommen wurde, so liegt ein erhöhtes Risiko für poststationäre Probleme vor.
• Mehrfache Krankenhausaufenthalte innerhalb des letzten Jahres: Musste der Patient in der jüngeren Vergangenheit wiederholt im Krankenhaus behandelt werden, so ist das ein Zeichen für eine labile gesundheitliche oder eine labile Versorgungssituation. Unter diesen Umständen ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich auch nach dem aktuellen Krankenhausaufenthalt Probleme einstellen. Ähnliches gilt für das mehrfache Aufsuchen einer Notaufnahme.
• Prästationäre Pflegebedürftigkeit: Menschen, die bereits im Vorfeld des Krankenhausaufenthalts (und unabhängig vom aktuellen Krankheitsereignis) auf pflegerische Unterstützung angewiesen waren, weisen ebenfalls ein hohes Risiko für poststationäre Probleme auf. Allein der Umstand, dass ein Patient einen Pflegegrad hat, ist ein verlässlicher Hinweis auf ein erhöhtes Risiko. Obwohl das Vorhandensein eines Pflegegrads bei der Patientenaufnahme meist leicht geklärt werden kann, wird diese Information in manchen Krankenhäusern leider nicht erfasst (oder erst spät, nachdem die Stellen für das Entlassungsmanagement eingeschaltet sind).
• Kognitive Einbußen: Es liegt auf der Hand, dass Menschen, deren Wahrnehmungsfähigkeit und Denkprozesse beeinträchtigt sind, nicht ohne Unterstützung Krankheits- oder Therapiefolgen bewältigen können. Sie erkennen möglicherweise nicht, wenn eine gesundheitlich problematische Situation eintritt, oder wissen nicht, was sie dann tun sollen. Ist bekannt, dass ein Patient kognitive Einbußen hat, so ist auch dies ein hinreichender Anhaltspunkt für das Risiko poststationärer Komplikationen.
• Psychische Problemlagen und Verhaltensauffälligkeiten: Hierfür gilt Ähnliches. Bei Menschen mit psychischen Störungen oder Verhaltensauffälligkeiten ist ebenfalls zu vermuten, dass sie Schwierigkeiten haben, gesundheitliche und andere Probleme nach dem Krankenhausaufenthalt ohne Hilfe zu bewältigen.
• Erhebliche Beeinträchtigungen der Mobilität/Motorik: Patienten, die bei der Fortbewegung auf Hilfen angewiesen sind oder Beeinträchtigungen der Grob- oder Feinmotorik zeigen, weisen ein allgemeines Handicap in der Bewältigung von Alltagsanforderungen, aber auch von besonderen krankheits- und therapiebedingten Anforderungen auf. Selbst einfache Handlungen, wie beispielsweise der Arztbesuch oder das Öffnen einer Tablettenpackung, können für diese Personen Probleme mit sich bringen. Ein erhöhtes Sturzrisiko kann ebenfalls daraus erwachsen.
• Beeinträchtigung der Sinneswahrnehmung: Wer nur noch einen geringen Teil seiner Sehfähigkeit besitzt oder wessen Gehör stark beeinträchtigt ist, kann ggf. große Schwierigkeiten haben, die Probleme und Anforderungen nach dem Krankenhausaufenthalt selbständig zu bewältigen. Auch die davon betroffenen Menschen gehören zu den »Risikogruppen«.
• Hohes Alter: Viele Forschungsergebnisse zeigen, dass ältere Menschen ein deutlich höheres Risiko poststationärer Komplikationen tragen als jüngere. Allerdings ist nicht definiert, was mit »hohem Alter« gemeint ist. Forschungsergebnisse setzen die Grenze häufig beim Alter von 65 Jahren an. Dies ist allerdings nicht zwingend. Es ist ebenso denkbar, andere, höhere Grenzen anzusetzen.
• Geringes Alter: Ebenso gilt, dass Kinder auf Unterstützung angewiesen sind. Das mag selbstverständlich erscheinen, ist aber wichtig dafür, dass in solchen Fällen verstärkt die Situation der Eltern in den Blick genommen wird. Ihnen bzw. ggf. anderen nahen Bezugspersonen kommt die Aufgabe zu, anstelle der Kinder die Bewältigungsarbeit zu übernehmen.
• Voraussichtlich andauernde, hohe Anforderungen und Belastungen: Bei Patienten, bei denen absehbar ist, dass eine ausgeprägte Schmerzsymptomatik auch nach der Krankenhausentlassung weiter anhält, ist ebenfalls überdurchschnittlich häufig mit Komplikationen zu rechnen. Vergleichbares gilt für andere Belastungen, die mit einer Erkrankung oder den Therapiefolgen zusammenhängen, beispielsweise häufige Übelkeit oder andauernde Erschöpfungszustände. Besondere pflege- oder therapiebedingte Anforderungen gehören ebenfalls in diesen Zusammenhang. Allerdings ist bei ihnen nicht eindeutig zu definieren, wie hoch die Anforderungen sein müssen, um von einem Bedarf an Unterstützung ausgehen zu können. Dies bleibt dann der weiteren, differenzierteren Einschätzung vorbehalten. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass mitunter die Belastungen weniger die Patienten selbst als die Angehörigen tragen. Zum Teil ist es hilfreich, die jeweils vorliegende Erkrankung als Hinweis auf das voraussichtliche Andauern von Belastungen und Anforderungen zu verwenden (oder die anstehende Therapie). Bei bestimmten Erkrankungen, etwa einem Schlaganfall, einem Herzinfarkt oder Tumorerkrankungen, ist die Frage nach der Schwere von Belastungen und Anforderungen leicht zu beantworten. Gleiches gilt für therapeutische Prozeduren wie Herzoperationen, Transplantationen oder eine Chemotherapie. In vielen Fällen liegen die Dinge jedoch weniger klar auf der Hand.
• Prekäre Lebens- oder Versorgungssituation: Damit sind wohnungslose Patienten ebenso angesprochen wie Patienten aus instabilen sozialen Lebensverhältnissen. Auch wenn es offensichtliche Hinweise auf prästationäre Versorgungsdefizite gibt, ist von einem erhöhten Risiko poststationärer Komplikationen auszugehen.
• Patienten mit infauster Prognose: Menschen mit einer krankheitsbedingt verkürzten Lebenserwartung gehören per se zu den Patientengruppen, die überdurchschnittlich häufig auf Unterstützung in Form des Entlassungsmanagements angewiesen sind.
Ein Beispiel für die Überführung dieser Risikofaktoren in ein Instrument zur kriteriengestützten Einschätzung findet sich im Anhang A ( Anhang A).
In manchen Fachbereichen ist grundsätzlich von einem erhöhten Risiko für poststationäre Probleme auszugehen. Dies gilt beispielsweise für Frühgeborenenstationen, die Geriatrie oder psychiatrische Fachabteilungen. Bei den betreffenden Patienten kann das initiale Assessment übersprungen und sofort mit dem differenzierten Assessment begonnen werden, d. h. mit der Prüfung der Frage, ob bzw. welcher Unterstützungsbedarf vorliegt.
Auch bestimmte Erkrankungen geben Hinweise auf ein erhöhtes Risiko, unabhängig davon, ob es sich um die Haupt- oder die Nebendiagnose handelt. Dazu gehören
• psychische Erkrankungen bzw. Störungen,
• demenzielle Erkrankungen,
• schwerwiegende Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z. B. Schlaganfall, Herzinsuffizienz),
• Krebserkrankungen,
• Verletzungen mit langanhaltenden Folgen wie Oberschenkelhalsfraktur oder Hirnschädigungen.
Diese Liste ist nicht abschließend. Sie soll nur verdeutlichen, dass es neben den oben genannten Kriterien auch möglich ist, ergänzend bestimmte Erkrankungen zum Kriterium zu machen. Es sind im Regelfall solche Erkrankungen, die die Gesamtkonstitution des Patienten schwächen, seine Fähigkeiten zur allgemeinen Alltagsbewältigung stark beeinträchtigen oder mit besonderen Anforderungen an sein Alltagshandeln und sein Selbstmanagement einhergehen.
Bei der Festlegung von Kriterien muss man sich immer bewusst machen, dass es im ersten Schritt nur darum geht, Patienten mit einem erhöhten Risiko für poststationäre Probleme zu identifizieren. Ob Patienten, die ein solches erhöhtes Risiko aufweisen, dann tatsächlich der Unterstützung in Form des Entlassungsmanagements bedürfen, ist eine zweite Frage. So kann es sein, dass ein Patient zwar erhebliche Mobilitätseinbußen und vielleicht auch weitere funktionelle Beeinträchtigungen aufweist, dass jedoch die daraus resultierende Beeinträchtigung der Selbstversorgungsfähigkeit durch seine Angehörigen vollständig kompensiert wird. Ähnliches gilt im Grundsatz sogar für Personen mit schwerwiegenden Erkrankungen. Auch hier findet man Patienten, die zwar erhebliche Belastungen und Anforderungen nach der Entlassung zu bewältigen haben, aber durch Angehörige, Ärzte und andere Dienste bereits ausreichend unterstützt werden und auch keinen Informations- oder Beratungsbedarf aufweisen.
Dies wird erst im nächsten Schritt des Entlassungsmanagements festgestellt, nicht bereits beim Risikoscreening. Denn die Bedarfseinschätzung erfordert ein deutlich differenzierteres Vorgehen als das Risikoscreening. Vereinfacht gesagt: Das Risikoscreening liefert eine Antwort auf die Frage, welche Patienten einen Bedarf an Hilfen in Form des Entlassungsmanagements haben könnten. Ob sie ihn tatsächlich haben, wird dann mit dem differenzierten Assessment festgestellt ( Kap. 2.2).
Einen Sonderfall für die Risikoeinschätzung stellt der gesamte Bereich der Geburtshilfe dar. Die meisten der oben aufgeführten Kriterien wären hier unpassend, insbesondere wenn sie auf die Situation vor dem Krankenhausaufenthalt Bezug nehmen. Selbst eine mit Komplikationen verbundene Schwangerschaft stellt nicht unbedingt einen verlässlichen Anhaltspunkt dar. Sie gibt eventuell Hinweise auf ein Risiko bei der Geburt, aber nicht unbedingt für die Zeit nach der Krankenhausentlassung. Für den Bereich der Geburtshilfe ist es empfehlenswert, die Gesundheit des Kindes zum Kriterium zu machen. Bei allen Kindern, die gesundheitlich auffällig sind (einschließlich Frühgeborene), ist das Risiko gesundheitlicher Probleme nach der Entlassung höher als bei anderen Kindern. In diesen Fällen sollte daher überprüft werden, ob alle Unterstützungsleistungen nach der Entlassung verfügbar sind (sowohl der Eltern als auch eventuell benötigte professionelle Hilfen) und ob das Kind in eine geeignete Versorgungsumgebung wechselt. Die Kriterien für das Risikoscreening sind hier also sehr überschaubar.
Kritisch zu sehen ist der Hinweis im Expertenstandard, bei kognitiv beeinträchtigten Patienten solle schon beim Risikoscreening eine Einbeziehung der Angehörigen erfolgen. Hier wird die Funktion des Risikoscreenings verkannt: Ist bereits offenkundig oder liegt eine Information des einweisenden Arztes vor, dass der Patient kognitiv beeinträchtigt ist, so muss schon allein deshalb von einem erhöhten Risiko für poststationäre Probleme ausgegangen werden. Die zusätzliche Einbeziehung der Angehörigen in das Risikoscreening ist, anders als bei der differenzierten Bedarfseinschätzung, in diesem Fall nicht erforderlich.