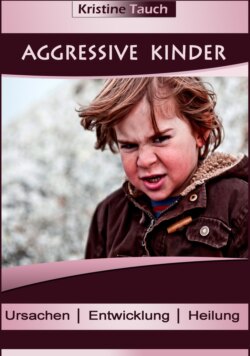Читать книгу Aggressive Kinder - Kristine Tauch - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1.1 Ethologische und kybernetische Bezüge
ОглавлениеBowlby bezieht einige seiner Begriffe aus der Kybernetik, so spricht er zum Beispiel von „Verhaltenssystemen“, „Anpassung“ und „Arbeitsmodellen“ (Bowlby 1975). Wenn er schreibt, er wolle die Struktur eines Systems untersuchen (a.a.O., S. 60), so sind damit innere und äußere Prozesse menschlichen und auch tierischen Verhaltens gemeint. Ebenso wie die Vertreter systemischer Theorien betont Bowlby die Notwendigkeit des Einbeziehens der Umwelt des zu untersuchenden Gegenstandes, als Bedingung für ein hinreichendes Verständnis desselben. Die Umwelt des Menschen, ebenso wie die des Tieres, nennt er die „Umwelt von dessen evolutionärer Angepasstheit“ (ebd.), womit er kenntlich macht, dass das System bereits einen Entwicklungsprozess innerhalb seiner Umwelt durchlaufen hat.
Bowlby verknüpft nun die systemischen Begriffe mit ethologischen, indem er den Instinktbegriff in seine Theorie einführt. Als instinktiv gelten nach Bowlby Verhaltensweisen, die auffallend vielen Lebewesen einer Spezies gemeinsam sind und der Erhaltung des Individuums und seiner Art dienen. Es gibt jedoch im Sinne Bowlbys keinen angeborenen Instinkt, sondern dieser bildet sich in der Auseinandersetzung von genetischer Ausrüstung mit der Umwelt (a.a.O., S. 49f). Die Tatsache, dass das instinktive Verhalten in eine spezifische Umwelt eingepasst ist, eröffnet einerseits die Möglichkeit einer gewissen Wandelbarkeit des Verhaltens, da es nicht genetisch festgelegt ist, andererseits ist das System, welches sich angepasst hat, in bestimmtem Umfang auf seine gewohnte Umgebung angewiesen. Bowlby nennt beispielhaft für eine problematische Flexibilität eines Systems, dass Gänse in ihrem Werbe- oder Balzverhalten sogar auf eine Hundehütte fixiert sein können, wenn diese zum entsprechenden Zeitpunkt, in einer prägenden Phase, als einzige zur Verfügung stand. Kein System kann so flexibel sein, dass es in jeder Umwelt angemessen funktioniert und darin sieht Bowlby pathologische Implikationen (a.a.O., S. 56f).
So wie das Werben der Gans fehlgeleitet ist und dadurch pathologisch wirkt, weil die Bedingungen in ihrer Umwelt keine normale Entwicklung zulassen, so können auch andere Verhaltenssysteme, wie zum Beispiel mütterliches Verhalten, nur in Bezug auf ihre Umgebung wirksam werden (a.a.O., S. 57). Bowlby nimmt an, dass dem erweiterten und verschiedenartig differenzierten Instinktverhalten von Mensch und Tier (es handelt sich insbesondere um Säugetiere und Primaten) eine gemeinsame Struktur zugrunde liegt (a.a.O., S. 51). Mütterliches Verhalten betreffend bedeutet dies, dass verschiedene Arten trotz evidenter Unterschiede und Abweichungen gewisse Gemeinsamkeiten aufweisen. So zeigen viele Tierarten ein ähnliches Pflege- und Bindungsverhalten wie der Mensch.
Bowlby erwähnt zunächst das Verhalten von Vögeln und Säugetieren, welche zwei dem Pflege- und Bindungsverhalten zugrunde liegende Eigenschaften besitzen: Erstens entwickeln Eltern und Junge kurz nach der Geburt die Fähigkeit sich gegenseitig zu erkennen und von nun an anders zu behandeln als unbekannte Individuen. Zu dieser Behandlung gehört zweitens das Suchen nach der Nähe des anderen (a.a.O., S. 174). Der Vergleich des Menschen mit nichthumanen Primaten scheint Bowlby jedoch angebrachter, da diese eine gemeinsame evolutionäre Entwicklungslinie verbindet (a.a.O., S. 176). Er beschreibt Beobachtungen an Rhesus-Makaken, Pavianen, Schimpansen und Gorillas und stellt heraus, dass alle Affenarten ein stark ausgeprägtes Bindungsverhalten aufweisen, das dem des Menschen sehr ähnlich ist (a.a.O., S. 177ff). So wacht die Affenmutter ständig über ihre Jungen, während diese ebenfalls meist in ihrer Nähe bleiben und immer wieder körperlichen Kontakt zur Mutter aufnehmen (a.a.O., S. 285f).
Das Verhaltenssystem, welches das Bindungsverhalten steuert, erfüllt eine wichtige Schutzfunktion, indem die beiden Parteien ständig in Reichweite bleiben und die Mutter ihr Junges so vor Gefahren bewahren kann. Dies ist das natürliche Bindungsverhalten, das Ethologen seit langem beobachten konnten. Bei den Menschen gibt es jedoch Mütter, die ihre Kinder abweisen und auch bei Affen kommt es gelegentlich vor, dass sie ihre Jungen fortjagen (zum Beispiel in Zoos lebende Tiere). Es liegt nahe, einen Blick auf die Umwelt der abweisenden Mütter zu werfen. Bowlby bemerkt, dass die Verhaltenssysteme des mütterlichen Verhaltens nur in bestimmten sozialen und physischen Umweltbereichen funktionsfähig sind (a.a.O., S. 57). Ich möchte noch einmal auf Bowlbys Instinktlehre zurückkommen. Er verbindet die Lehre der natürlichen Selektion (Ethologie) mit den Verhaltenssystemen der Menschen (Kybernetik), die entsprechend dieses Darwin’schen Prinzips der Arterhaltung dienen. Wie funktionieren diese Systeme?
Bowlby unterscheidet zwischen einfachen und zielgerichteten Verhaltenssystemen (Bowlby 1975, S. 73). Die einfachen Systeme werden durch Reizung der Sinnesorgane aktiviert und benötigen für ihren vollständigen Verlauf kein weiteres Feedback. Zielgerichtete Verhaltenssysteme hingegen erfassen aufgrund eines äußeren oder inneren Feedbacks die Wirksamkeit eines begonnenen Verhaltens und können dessen weiteren Verlauf steuern. Bowlby spricht einem beachtlich großen Teil des menschlichen Verhaltens diese Fähigkeit zu (ebd.).
Das Bindungsverhaltenssystem des Säuglings entwickelt sich im zweiten Abschnitt des ersten Lebensjahres zu einem zielgerichteten Verhaltenssystem. So beschreibt Bowlby, dass ein Kind ab dem achten oder neunten Monat Bedingungen entdeckt, die ihn an sein Ziel (die Beeinflussung der Mutter) führen und, dass von nun an sein Verhalten planbar wird (a.a.O., S. 319). Es ist also im Stande, auf ein auf sein Verhalten folgendes Feedback zu reagieren beziehungsweise darin enthaltene Informationen zur Kenntnis zu nehmen. Anhand dieser Informationen kann das Kind einen Plan erstellen, den Bowlby zielkorrigierten Verhaltensplan nennt. Dieser zielt darauf ab, das Verhalten des Interaktionspartners zu verändern oder ein bestimmtes Verhalten hervorzurufen (a.a.O., S. 320).
Die Verwendung zielkorrigierter Verhaltenspläne setzt voraus, dass das Kind Arbeitsmodelle entwickelt hat, in welchen Informationen über sich selbst und über die Bindungsfigur(en) gespeichert sind (vgl. ebd.). Die Arbeitsmodelle sind der Grundstein für ein Vertrauen in die Bindungsfigur und deren Verfügbarkeit (Bowlby 1976, S. 247f) und somit, analog zu Eriksons Urvertrauen, für ein Grundvertrauen in die Welt, also eine positive Einstellung dieser gegenüber.
Die Entstehung der Arbeitsmodelle kann mit Daniel Stern folgendermaßen expliziert werden: Stern geht in Übereinstimmung mit der Säuglingsforschung von einer frühen Mutter-Kind- Beziehung aus, die durch rege Interaktionen gekennzeichnet ist. Die Interaktionserfahrungen, die aus Affekten und Handlungsmustern bestehen, sind die Grundlage für die Ausbildung innerer Repräsentanzen, welche Stern „Generalisierte Interaktionsrepräsentationen“ nennt. Diese seien die Bausteine für innere Arbeitsmodelle (zitiert nach Brisch 2000, S. 70). In einem solchen Arbeitsmodell entsteht allmählich das „Bild“ der Mutter, das anfangs noch sehr unvollständig ist (Bowlby 1975, S. 322). Die Entwicklungsaufgabe besteht nun darin, zu begreifen, dass auch die Mutter Ziele hat, was das Kind etwa mit zwei Jahren erkennt, und später, ihre wirklichen Ziele zu verstehen, das heißt Einfühlungsvermögen zu zeigen, was Bowlby im Alter von sieben Jahren ansetzt (a.a.O., S. 321).
In der Zeit der Sprachentwicklung ist das Kind laut Bowlby besonders stark mit der Entwicklung von Arbeitsmodellen beschäftigt (a.a.O., S. 322). Die Arbeitsmodelle von sich und von seiner Bindungsfigur führen schließlich zur Bildung von Bindungsplänen, welche nach Bowlby unter den Aspekten ihrer Wahrnehmungsbeeinflussung, ihrer Gültigkeit oder Verzerrung von größter Bedeutung für das kindliche Bindungsverhalten sind (a.a.O., S. 322f).