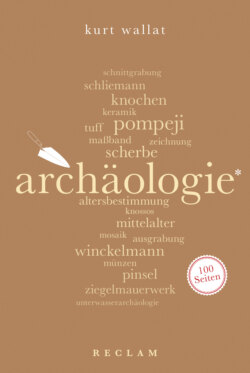Читать книгу Archäologie. 100 Seiten - Kurt Wallat - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеArchäologie – was genau ist das?
Die Öffentlichkeit hat vermutlich ein typisches Bild vor Augen: Menschen kauern auf dem Boden und legen mit Metallkellen oder einem Pinsel Dinge frei, die noch teilweise im Erdreich stecken – dies mit einer endlosen Geduld und unerschütterlicher Akribie. Sie kennt die spektakulären Berichte über Funde, die in unregelmäßigen Abständen durch die Medien geistern und zuweilen einen regelrechten Hype auslösen: Funde von Opfern des Vulkanausbruchs in Pompeji – über 1900 Jahre alt. Freilegung eines Tempels in Ägypten – ca. 3500 Jahre alt. Saurierknochen – Millionen Jahre alt. All diese Dinge treten bei »Ausgrabungen« zutage, sind jedoch fachlich weitestgehend unterschiedlichen Bereichen der Wissenschaft zuzuordnen. Und zwischen den Nachbardisziplinen existieren teils sehr große, teils gar keine Überschneidungen.
Im Wort »Archäologie« verbergen sich die altgriechischen Begriffe »ἀρχαῖος« (archaios, übersetzt ›alt‹) und »λόγος« (lógos, übersetzt ›Wort‹ oder ›Lehre‹) – sinngemäß ist sie also »die Lehre / das Wissen vom Vergangenen«.
Ein »Klassischer Archäologe« versteht sich als Wissenschaftler, der vorwiegend die Kulturen des Mittelmeerraums studiert, mit einer klaren Präferenz für Griechenland und Italien. Grabungen in diesen geographischen Breiten, die Funde von ca. 1200 v. Chr. bis ca. 350 n. Chr. erwarten lassen, sind seine Aufgabe. Die Interaktion der alten Griechen und des römischen Imperiums mit ihren Nachbarvölkern führt zu weiteren Teilbereichen, etwa in den ehemaligen Provinzen Germaniens – hier ist dann der Provinzialrömische Archäologe gefragt. Sollte, was nicht sehr wahrscheinlich ist, die Spitze eines Obelisken zum Vorschein kommen, müsste man einen Ägyptologen zurate ziehen. Würde zufällig ein Faustkeil gefunden, wäre ab sofort der ur- und frühgeschichtliche Kollege zuständig. Und falls man so weit in die Tiefe vorstoßen sollte, dass Schieferplatten mit Resten eines gefiederten Wesens oder versteinerte Knochen von veritabler Größe auftauchen, wäre der Paläontologe an der Reihe.
Dann gibt es da noch den Mittelalter- und den Neuzeitarchäologen, denn eine wichtige Aufgabe ist auch die Dokumentation jüngerer Gebäude oder Orte. So wird nicht selten eine stillgelegte Industrieanlage aufgrund ihrer Einzigartigkeit für einen bestimmten Produktionsprozess mit Mitteln der Archäologie akribisch dokumentiert und rekonstruiert, um dieses Wissen für die nachfolgenden Generationen zu erhalten. Unter Umständen können noch lebende Zeitzeugen wertvolle Erkenntnisse zur Erforschung beitragen. Als Beispiel seien hier Industrieanlagen zur Stahlproduktion im Saarland oder im Ruhrgebiet genannt. Solche Untersuchungen gehen weit über die bloße Katalogisierung technischer Details hinaus, vielmehr nimmt die so genannte »Industriearchäologie« auch das soziale Umfeld ins Visier, das sich etwa an Siedlungen normierter Häuser und an deren Wandel im Laufe der Generationen ablesen lässt.
Ein oft sehr persönliches Ziel dagegen verfolgen Suchgrabungen an Orten kriegerischer Handlungen in der Neuzeit, bei denen archäologische Methoden zur Anwendung kommen (Schlachtfeldarchäologie). Hier ist das Ziel auch die Identifikation von Opfern, um noch lebenden Nachkommen eine verlässliche Information über deren Schicksal übermitteln zu können.
Und Disziplinen gibt es noch viele weitere – einigen davon werden wir noch begegnen. Es würde den Rahmen dieses Buches aber sprengen, wollte man auch noch auf die Kulturen Vorderasiens eingehen, etwa Mesopotamien. Oder auf die zahllosen Kulturen Südamerikas und deren historisches Erbe, auf die Stufenbauten in Mexiko oder Mauerreste im Dschungel Perus. Oder auf Details zu Asien, mit China, dessen Kulturgeschichte parallel zu der des Mittelmeerraums verlief und das über die Seidenstraße eng mit letzterem verknüpft war: Die Terrakotta-Armee aus einem Grabmal in Zentralchina aus dem späten 3. Jahrhundert v. Chr. zum Beispiel zählt zu den wohl berühmtesten archäologischen Funden der Welt.
Es gilt also, eine Entscheidung zu treffen: Sollen es die alten Griechen und/oder Römer sein? Oder doch die alten Ägypter? Urzeitmenschen? Mammuts? Saurier? Leider wird es niemandem vergönnt sein, alles gleichzeitig zu studieren, jedoch sind in geringem Ausmaß Kombinationen sinnvoll, ja geradezu erforderlich. Ich persönlich entschied mich zu Beginn meines Studiums für die alten Römer und deren architektonische, künstlerische und kulturelle Hinterlassenschaften, bevorzugt in Pompeji. Dort war ich später sehr intensiv tätig und habe unter anderem gemeinsam mit meiner niederländischen Kollegin Natalie de Haan ein Grabungsprojekt zur Erforschung der »Zentralthermen« geleitet. Da sich am Beispiel der 79 n. Chr. vom Vesuv verschütteten Stadt viele Aspekte der Archäologie – von der grundlegenden Faszination, über das konkrete Arbeiten bis hin zu technisch-konservatorischen Fragen – sehr gut erläutern lassen, werde ich mich in diesem Buch häufiger darauf beziehen.
Pompeji wurde 79 n. Chr. durch einen verheerenden Ausbruch des Vesuvs verschüttet, und im Laufe einiger Jahrzehnte verschwanden dann die noch aus dem Erdreich ragenden Mauerreste vollständig unter der Erde, die Stadt geriet in Vergessenheit. Gleichwohl ist neben wenigen sporadischen Erwähnungen eine überaus detaillierte Schilderung der Katastrophe überliefert. Der Verfasser, Neffe des berühmten römischen Naturforschers Plinius, beschreibt die Ereignisse in zwei Briefen: Wir nennen ihn heute Plinius den Jüngeren. Die Existenz einer Stadt am Fuße des Vulkans war seit Jahrhunderten bekannt, aber ein Zufall führte im späten 18. Jahrhundert zur Entdeckung Herculaneums und schließlich Pompejis. Mehr als 200 Jahre später schließlich konnten die in Pliniusʼ Briefen geschilderten Phänomene vulkanologisch analysiert und als wissenschaftlich korrekt klassifiziert werden. Schäden an Gebäuden und jüngst der Fund zahlloser Skelette in einem Bootsschuppen in Herculaneum vervollständigten das Bild und erlauben heute eine minutiöse Rekonstruktion des Vesuvausbruchs und von dessen Auswirkungen auf die Städte in der Bucht von Neapel. Noch ganz aktuell finden sich in zahlreichen antiken Häusern in Pompeji Spuren einer überhasteten Flucht, Hinweise auf das abrupte Ende von Bauarbeiten sowie Knochenfunde von Menschen und Tieren, die beim Ausbruch starben.
Leider entspricht die oft nüchterne Realität so gar nicht dem Bild, das in Literatur und Filmen gerne von der Archäologie vermittelt wird: Ich kann versichern, dass ich weder mit Peitsche und Pistole (sehr wohl aber mit Hut, dies sei als Trost erwähnt) unterwegs war; auch eine Lara Croft ist mir bisher bei keiner Ausgrabung begegnet. Ein Klischee aber stimmt immerhin: Zur Arbeit eines Archäologen gehört tatsächlich das stundenlange Kauern in einem schmutzigen Erdloch, um mit Pinsel, einer Kelle und womöglich einem Zahnstocher in geduldiger Feinarbeit kleinste Gegenstände, vielleicht eine einzelne Scherbe, aus der Erde zu ziehen. Denn genau dieses so unscheinbar wirkende Stückchen Keramik könnte das entscheidende Glied in einer Indizienkette sein, um ein ganzes Gebäude zu datieren.
»Eine Frau, die mit einem Archäologen verheiratet ist, darf sich glücklich schätzen, denn je älter sie wird, desto interessanter wird sie für ihren Mann.«
Agatha Christie