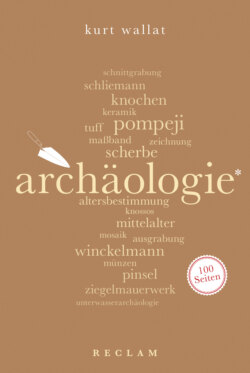Читать книгу Archäologie. 100 Seiten - Kurt Wallat - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Pompeji und Giuseppe Fiorelli
ОглавлениеDie Geschichte der Ausgrabungen in Pompeji war in den letzten Jahrzehnten des 18. und den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts eine überaus traurige, was insbesondere damit zusammenhängt, dass zu der Zeit eine fundierte Grabungswissenschaft noch nicht existierte. So setzte man eine große Anzahl an Arbeitern ein, um in raschem Tempo ausgedehnte Flächen der Stadt freizulegen. Ausgehend von Südwesten wühlten sich diese in Richtung Osten voran. Dutzende Männer trugen die Verschüttungsmassen zügig ab, ohne der Stratigraphie, der Schichtenfolge, große Beachtung zu schenken. Als fatal erwies sich zudem die Methode, zunächst Plätze und vor allem Straßen großflächig auszugraben, um dann von dort seitlich in die Gebäude vorzustoßen. Natürlich geschah dies auch, weil man von der Vielzahl an Funden geradezu überwältigt war.
Relativ früh wurden die Fortschritte in der Grabung und wichtige Fundstücke in einem Tagebuch festgehalten, jedoch gab es noch kein System, das es ermöglicht hätte, die Lage eines Hauses und seiner Räume genau zu adressieren. Aber schon damals bedachte man die freigelegten Gebäude mit Namen: Die Bezeichnung konnte sich aus einem spezifischen Fund, einer Inschrift an der Hauswand, dem Motiv aus einer Wandmalerei ableiten, oder auf den Besuch einer anerkannten Persönlichkeit zurückgehen. So gab und gibt es ein »Haus des Goethe« (zu Ehren seines Besuchs), ein »Haus des Paquius Proculus« (Inschrift an der Hausfassade), ein »Haus des Schiffes Europa« (Ritzzeichnung an der Wand), das »Haus mit den roten Wänden« (aufgrund einer Wandmalerei), das »Haus der Silbernen Hochzeit« (Visite eines adligen Paares). Dieses Verfahren behielt man viele Jahrzehnte bei. Kündigte sich hoher Besuch an, wurden nicht selten soeben entdeckte spektakuläre Stücke erneut vergraben, damit sie dann in Anwesenheit des Gastes wie zufällig ans Tageslicht traten.
In Pompeji fanden sich seit dem Beginn der Ausgrabung zahlreiche Skelette von Menschen und Tieren, häufig in den Räumen, in denen sie zu Tode gekommen waren. Beim Freilegen von Straßen und Plätzen entdeckte man Reste von Opfern, die durch umstürzende Mauern oder Säulen erschlagen worden waren. Gerade diese Stellen erfreuten sich bei Besuchern größter Beliebtheit, konnte man sich doch ein wenig gruseln. Dass die Stadt durch den Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 n. Chr. quasi mitten aus dem täglichen Leben gerissen und in exakt diesem Augenblick konserviert schien, übte eine große Faszination aus: Man stieß auf Theken mit Lebensmitteln, auf Brotlaibe, die in einem Ofen verblieben waren und verkohlten. In Privathäusern lagen Gegenstände des täglichen Lebens auf den Tischen, die offensichtlich bei der überstürzten Flucht zurückgelassen worden waren. In einigen Küchen gab es eindeutige Anzeichen dafür, dass soeben noch der Ofen angefeuert worden war. Durch diese Einzelbefunde und Details erstand das antike Pompeji vor den Augen der Besucher mit einer zuvor nie gekannten Intensität. In all den Jahrzehnten jedoch fehlte ein klares Konzept, um ein bestimmtes Gebiet gezielt freizulegen und dabei gewissenhaft alle damit zusammenhängenden Entdeckungen zu dokumentieren, zu analysieren und in den Gesamtkontext zu stellen.
»Sonntag waren wir in Pompeji. – Es ist viel Unheil in der Welt geschehen, aber wenig, das den Nachkommen so viel Freude gemacht hätte.«
Johann Wolfgang von Goethe
Als wahrer Glücksfall für Pompeji erwies sich die Tatsache, dass ab 1863 mit Giuseppe Fiorelli (1823–1896) ein neuer Grabungsdirektor die Verantwortung übernahm. Er stellte die archäologische Erforschung der antiken Stadt auf eine neue, solide und vor allem wissenschaftliche Basis. Die Freilegung erfolgte nun konsequent von oben nach unten, dabei wurde die Stratigraphie beachtet. Noch während der Ausgrabung eines Gebäudes sicherte man dessen Mauern vor dem Einsturz. Funde in den Verschüttungsmassen wurden dokumentiert und im jeweiligen Forschungsbericht notiert, dabei auch die Höhe über dem Bodenniveau festgehalten. Spätestens jetzt erhielt Pompeji ein bis heute gültiges System, mittels dessen über eine festgelegte Reihenfolge jedes Gebäude genau lokalisiert werden kann: Region, Häuserblock, Eingang.
Und Fiorelli ist eine weitere, atemberaubende Methode zu verdanken: Während der Grabungsarbeiten zeigten sich in einer bestimmten Ascheablagerung immer wieder Hohlräume, die man nun mit Gipsmasse ausgoss. Häufig entstanden dabei Abdrücke von Menschen oder Tieren, die beim Ausbruch des Vesuvs ums Leben gekommen waren. Die organischen Bestandteile waren längst verwest, Knochen, ebenso mitgeführte Gegenstände (Schmuck, Schlüssel) aber noch vorhanden. Selbst Spuren der Kleidung hatten sich in Abdrücken erhalten. Zum ersten Mal bekamen die Opfer der Katastrophe sozusagen ein Gesicht. Viele dieser Körper sind im Moment des Todes konserviert.
Sicherlich kann man darüber streiten, ob es pietätlos ist, die Abgüsse von Opfern einer Naturkatastrophe in Glaskästen auszustellen. Andererseits verdanken wir gerade diesen Abgüssen wertvolle Erkenntnisse zur Anatomie der Bewohner von Pompeji, zur Kleidung und zu ganz alltäglichen Gegenständen.