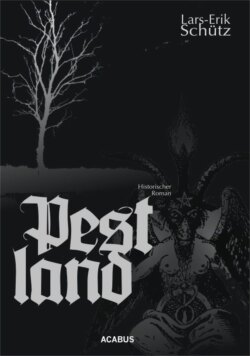Читать книгу Pestland - Lars-Erik Schütz - Страница 14
ОглавлениеTeil Zwei
9.
eichenberge, brennende Hütten, umherstreunende Hunde. Ungeheuer hinter jedem Gesträuch und auf den Wegen der Schnitter selbst, reitend auf seinem fahlen Ross.
All dies hatte ich vom Pestland erwartet.
So erstaunte es mich, dass der Landstrich bisher nicht viel anders aussah als die Gegend um Duisburg. Hügel zogen sich sanft geschwungen über das Land. Einige Vögel flogen von den Feldern auf, ansonsten lagen die Äcker und kleinen Wäldchen unberührt da. Nichtsdestotrotz machte mich die Stille nervös. Immer wieder sah ich über meine Schulter, ließ den Blick über die Hügelkuppen streifen. Erwartete, dass jeden Moment die Hölle losbrach.
„Meinst du, du kannst noch den ganzen Tag über laufen?“, fragte Simon. „Dein Ohr sieht ziemlich schlimm aus.“ Stets war er mir um einige Schritte voraus.
Ich tastete die Wunde ab. Getrocknetes Blut klebte an den Resten meines Ohrläppchens. Sobald ich die Stelle berührte, durchzog mich ein Brennen und ich sog scharf die Luft ein. Aber es war nichts, das mir auf der Wanderschaft hinderlich werden könnte. Zwar fühlte ich mich vom Kampf und meiner Pesterkrankung erschöpft, trotzdem traute ich mir zu, bis in die Dämmerung weiterlaufen zu können. Wenn ich bedachte, dass ich noch am Morgen im tiefsten Fieberwahn gelegen hatte, sollte ich den Heiligen dafür danken, überhaupt schon wieder laufen zu können.
„Es wird gehen“, murmelte ich und machte einige schnelle Schritte, um zu Simon aufzuschließen. „Wir wandern tagsüber. Ich bin in diesen Landen noch nie gewesen, du wirst uns leiten müssen.“
„Ich bin mit meinem Großvater nur einmal in der Burg gewesen. Das war, nachdem er den Dienst bei dem Alchemisten angetreten hatte. Ich kann mich nur noch schlecht erinnern, du solltest dich nicht auf mich verlassen.“
„Viel anderes bleibt mir nicht übrig.“ Ich lachte auf, ohne dass irgendein Humor in meiner Stimme mitschwang. „Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwen nach dem Weg fragen können.“
Der Pfad zog sich ohne Abzweigung zwischen Feldern und kleinen Gehöften entlang. Simon brauchte seine Wegkenntnisse vorerst nicht unter Beweis stellen.
Rinder und eine Schar Hühner waren die einzigen Lebewesen, die wir antrafen. Wenigstens verhungern würden wir hier wohl nicht. Ein Kupferhimmel leuchtete auf uns herab und die Schatten der kahlen Erlen und Kastanien wuchsen an wie meine Furcht.
„Es ist hier zu … gewöhnlich“, sagte ich über das Knirschen unserer Schritte hinweg. „Alles ruhig, das einzig Auffällige ist, dass wir niemandem begegnen.“
„Du beschwerst dich, weil uns bisher noch nichts geschehen ist?“ Simon lächelte verschmitzt. „Ich kann recht gut damit leben.“
„Du weißt schon, was ich meine“, seufzte ich leicht entnervt.
„Tut mir leid.“ Simons Blick rutschte erst hinab auf seine Schuhspitzen und stieg dann wieder zu mir hinauf. „Auf jeden Fall … Ich … ich bin dankbar, dass du mich begleitest. Allein wäre ich noch nicht einmal über die Ruhr gekommen.“
„Das stimmt allerdings.“ Mit einem Anflug von Rührung fuhr ich ihm durch das krause Haar.
„Wie ist es nun mit deinen Verfolgern?“, fragte er. „Sind die Leute des Papstes tatsächlich noch hinter dir her?“
Ich nickte. „Es sind schon viele gewesen. Einige haben aufgegeben, andere sind während der gewaltigen Zeitspanne gestorben oder mit anderen Aufgaben betraut worden. Zurzeit ist es der päpstliche Legat Pietro di Tremante, der mich mit seinen vier Handlangern verfolgt.“
„Ist er gefährlich?“
„Er ist wohl der gefährlichste Kerl, der mich bisher gejagt hat. In Lyon bin ich ihm einmal nur knapp entkommen, als er und seine Männer mich in einem Wirtshaus eingeengt hatten. Di Tremante ist ein sturer Dogmatiker, so überzeugt von der Richtigkeit und Heiligkeit seines Auftrags, dass ihm jedwedes Mittel recht ist, egal ob es nun Folter oder Mord von Unschuldigen ist. Versteh mich nicht falsch, er ist keiner dieser tumben, brutalen Ritter. Er hält sich für einen aufrichtigen Christen, einen militus christi, und das macht ihn gefährlicher als den gottlosesten Heiden.“
„Klingt nicht gerade so, als würde ich ihm begegnen wollen.“ Simon schluckte.
„Nein, mein Sohn, das willst du …“
Alessio, der stets einige Ellen vor uns den Weg entlang strich, stürzte plötzlich laut bellend los. Ich zuckte zusammen. Meine Hand glitt wie von selbst zum Griff meines Schwertes. Der Hund rannte auf einen Handkarren zu, der einige Meter von uns entfernt den Weg versperrte.
„Bleib hinter mir!“, raunte ich Simon zu und näherte mich dem Gefährt. Ein bestialischer Gestank ging von ihm aus. Fliegen schwirrten um mich herum. Ich schlug nach einigen der Insekten, die sich auf meine Wangen setzen wollten, und sah auf die Ladefläche.
„Was ist da?“ Simon stellte sich auf die Zehenspitzen.
Ich starrte auf die tote Frau, zerrissen von einem seltsam fernen Gefühl der Trauer. Ihre Haut bleich, ihr dunkles Haar wirr. Sie trug ein weißes Leinenkleid, in dem sie fast wie ein Geist aussah. Jemand hatte ihre Hände gefaltet und ihr einen Rosenkranz in die erstarrten Finger gedrückt. Um den Hals hatte er ein Tuch gewickelt, wahrscheinlich um die schwarzen Beulen zu verbergen. Ich legte meine Hand auf die ihren. Es fühlte sich an, als würde ich die Glieder einer Statue berühren. Die Augen geschlossen murmelte ich ein Gebet, erschüttert von diesem plötzlichen Vorboten des Todes.
Während ich weiterhin so verharrte, lief Alessio kläffend den Hügel links des Weges hinauf. Simon eilte ihm nach. „Da sind noch mehr Tote! Oben auf der Kuppe!“
Ich löste mich aus meiner Versteinerung, sah noch einmal auf die Frau und folgte ihnen.
Den Hügel krönte eine mächtige Eiche; einer jener Bäume, deren Schatten im Sommer Schutz vor der Hitze und deren Stamm im Winter Schutz vor dem Eiswind bot. Es war ein schöner Ort. Ich stellte mich neben Simon, der bereits auf das grausame Bild sah, das die Pest hier für uns entworfen hatte.
Nicht die Toten erschütterten mich so sehr. Es war allein die Geschichte, die sie uns erzählten.
Unter den Eichenästen waren zwei frisch ausgehobene Gräber. Vor diesen lag der Leichnam eines Mannes, eines vierschrötigen Bauern in grober Kleidung. In seinen Armen hielt er noch den kleinen Körper eines Kindes, eingewickelt in Leinen.
Er hatte seine Frau und sein Kind beerdigen wollen. Aber bevor er sein Werk vollenden konnte, hatte ihn selbst die Seuche geholt. Schwarze Beulen an seinem Hals. Nun lag auch er hier. Unbestattet und ungeweiht. Der Blick verloren im Gezweig der kahlen Baumkrone.
Du hast sie hierher gebracht, dachte ich. Hast sie in diesem Karren zu dem Hügel gezerrt, weil du wusstest, hier würden sie Frieden finden. Du musst schwach gewesen sein, dein Körper ausgezehrt von der Krankheit. Du musst gezittert haben, die Augen starr auf den Weg gerichtet, die Muskeln schlaff. Doch vollbringen konntest du es nicht.
Ich hielt meine Hand auch über das Gesicht des Mannes und sprach ein kurzes Gebet.
Simon nagte an seiner Unterlippe. Alessio hatte sich ins eisstarre Gras gelegt und winselte leise.
Ich wandte mich ab. Rieb die Hände aneinander, um sie zu wärmen.
„Wir können sie nicht einfach so hier liegen lassen“, sagte Simon steif.
Ich nickte. Lief bereits den Hügel hinab, um die Frau zu holen.
„Nein“, hauchte ich. „Nein, das können wir nicht.“