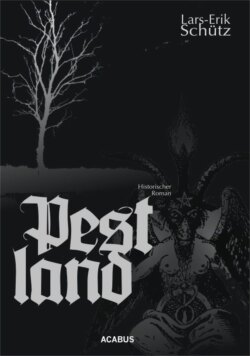Читать книгу Pestland - Lars-Erik Schütz - Страница 8
3.
Оглавлениеus dem Klostertor hinaus taumelte ich in den Schein des Mondes, der wie ein Klumpen Lehm am Himmel klebte.
Rußende Fackeln hingen an der Stadtmauer gegenüber des Minoritenstifts. Die Duisburger glaubten, durch Feuer die Ausdünstungen der Pest vertreiben zu können. Aber wie viele Kerzen und Fackeln sie auch entzündeten, die Leute starben hier ebenso zahlreich wie in den anderen Städten Europas.
Vor zwei Jahren, anno domini 1347, hatten die Bürger noch gespottet, wenn man ihnen von den Gerüchten aus dem Süden erzählte, die von einer Seuche kündeten, die jeden innerhalb von Tagen dahinraffte, egal ob Kaufmann oder Bettler, Fürst oder Bauer.
Jetzt erschrak jeder, sobald er nur den Namen der Plage vernahm. Die Gelehrten disputierten über astrologische Konstellationen, die zu der Katastrophe führten, über die Schuld der Juden und Heiden, über Heilmittel und das bevorstehende Armageddon, das Ende der Welt.
Ich hörte von der Pest das erste Mal in einer Taverne in Marseille. Ein Seemann hatte von den Beulen berichtet, die sich an Hälsen und Leisten der Kranken bildeten.
„Sie sind schwarz wie Kohle – deshalb nennt man die Seuche in Italien auch Morte nera, den Schwarzen Tod“, hatte er verkündet und seinen Weinkrug in einem Zug geleert.
Am nächsten Tag floh ich aus Marseille, wieder einmal vor den Männern des Papstes. Nur eine Woche später traf auch in der Hafenstadt der Schwarze Tod ein und machte die Gerüchte zur Gewissheit, tötete alle anderen Trunkenbolde, die in der Kneipe gewesen waren, nur nicht mich.
Ich reiste gen Norden, der Seuche immer nur knapp voraus. Dennoch hatte mich die Hölle der Pest jetzt in Duisburg eingeholt.
Zitternd hockte ich mich in den Eingang eines Fachwerkhauses. Auch hier musste der Schwarze Tod schon eingekehrt sein. Die Fenster waren vernagelt, Kälte und Leere gingen von der Behausung aus.
Zu meinem Erstaunen fühlte ich mich besser als noch vor wenigen Augenblicken im Kloster. Das Fieber glomm in meinem Inneren nur noch als schwaches Lodern. Auch die Stimme Baphomets, meines ewigen Verfolgers, war verstummt.
Ich befühlte meinen Hals und erstarrte.
Wo im Kloster noch eitrige Beulen geprangt hatten, war nun wieder glatte, gesunde Haut. Ich fuhr mit der Hand unter mein Hemd und strich über meine Leisten. Auch dort spürte ich keine Beulen mehr.
Was war geschehen? Zwar hatte ich immer wieder von wundersamen Heilungen gehört, bei denen die Pestbeulen langsam kleiner wurden und schließlich verschwanden, aber noch nie von einer Genesung in so kurzer Zeit. Ich jauchzte innerlich – so konnte ich schneller vorankommen und Baphomet noch entkommen. Mir würde später noch genügend Zeit bleiben, über dieses Wunder zu grübeln.
Der Novemberwind wehte einige Blattgerippe über den zertretenen Matsch der Straße. Ich fröstelte und zog mir meine Kutte enger um den Körper. Auf meiner immerwährenden Flucht gab ich mich als Bettelmönch des Franziskanerordens aus. Eine Tarnung, die kaum Verdacht schöpfen ließ und mir die Pforten zu Klöstern und Gasthäusern öffnete. Ohne die Kutte hätten die Minoriten mich niemals zur Pflege aufgenommen, als ich auf der Straße zusammengebrochen war.
Unter dem Gewand hatte ich meine wenigen Besitzstücke verborgen, die wohl jedem schnell klar gemacht hätten, dass ich alles andere als ein Bettelmönch war. Ich rang mich zu einem Schmunzeln durch, als ich aufstand. Allein ihr Anblick hatte schon so manchen Strauchdieb in die Flucht geschlagen.
Ich legte den Kopf in den Nacken und sah zum Mond. Die Nacht neigte sich langsam ihrem Ende entgegen. Möglicherweise ließen die Wachen mich bereits durch das Stadttor ziehen.
Das Schwanentor lag nur wenige Steinwürfe vom Kloster entfernt und führte geradewegs zur Ruhr. Dort müsste ich mir einen gottesfürchtigen Fährmann suchen, der ein armes Mönchlein für ein paar Pfennig mit über den Fluss nahm. Dann konnte ich gefahrlos weiter gen Norden reisen, weg von der Pest und meinen Verfolgern.
Je näher ich dem Torhaus kam, desto ärmlicher sahen die Häuser aus. Tod und Chaos hatten Duisburg zum Erliegen gebracht. Die einzige Gestalt, die ich auf meinem Weg antraf, war eine junge Frau, die an einer der Haustüren lehnte. Sie wäre schön gewesen, hätte die Armut sie nicht mit schütteren Haaren und eingefallenen Wangen gestraft.
In ihren Armen wiegte sie einen Säugling, dem sie die Brust gab. Erst nach mehreren Augenblicken fiel mir auf, dass der Mund des Kindes im Angesicht der Brustwarze völlig reglos war. Sein Gesicht blass, der Blick gebrochen. Schließlich sah ich auch die winzigen Beulen an seinem Hals. Ich konnte nicht sagen, wie lang die Mutter schon so dastand und ihr totes Kind säugen wollte. Ihr Bild versetzte meinem Herzen einen Stich.
Ich beschleunigte meine Schritte, um nicht der Versuchung zu erliegen, zu ihr zu gehen. Ihr dieses Relikt zu entziehen und zu helfen.
Seit den Taten, die Baphomet meinen Verrat nannte, war ich darauf bedacht, den Menschen beizustehen – im Namen jener, die ich damals dem sicheren Tod überantwortet hatte.
Natürlich war es für Reue längst zu spät. Aber ich spielte den sanften Helfer nicht deshalb, damit mir einige Jahrhunderte im Eissee des letzten Höllenkreises erspart blieben. Ich tat es einzig für den Frieden meiner Seele. Oder zumindest für das, was von ihr übrig war.
Zwei Geharnischte flankierten das Tor, müde auf ihre Lanzen gestützt. Zwar waren die Torflügel geöffnet, aber die Zugbrücke immer noch hochgezogen.
„He da, Wachmänner! Wollt ihr ein Mönchlein nicht in die Ferne entlassen?“ Mit der üblichen Maskerade des überschwänglichen Kirchendieners trat ich auf die beiden zu.
„Vergiss es, Bruder!“ Der Kerl rechts vom Tor spuckte aus. Sein Vollbart war vom selben Braun wie der Rost auf seinem Brustpanzer, unter dem sich ein gewaltiger Bauch wölbte. „Die Zugbrücke wird erst im Morgengrauen hinabgelassen. Keine Ausnahmen.“
Ich stampfte auf, mehr aus Verzweiflung als aus Wut. So verlor ich wertvolle Zeit. Es erschien mir ohnehin als ein Wunder, dass einige Stadtwachen noch ihrem Tagewerk nachgingen. Ich hatte von Städten gehört, in denen Plündereien und Gemetzel herrschten – aus dem Grund, dass schlicht kein Wächter, kein Richter, kein Ratsherr mehr lebte oder sich aus Angst vor der Pest nicht mehr aus dem Haus traute.
„Ohnehin würde ich es Euch nicht raten, Duisburg in Richtung Norden zu verlassen“, meldete sich der linke Torwächter zu Wort. Er klang deutlich weniger abweisend als sein Kumpane.
Mit zusammengezogenen Augenbrauen sah ich den schlaksigen Jüngling an. „Warum das?“
„Wisst Ihr das nicht?“ Seine Stimme zitterte wie Blech unter den Hammerschlägen eines Schmieds. „Der Landstrich um Kleve, entlang des Rheins – das ist das Pestland.“
„Das Pestland?“
Der Dicke stöhnte und übernahm die Erklärung: „Da lebt keiner mehr, Mönchlein. Entweder alle tot oder geflohen. Die Pest ist da umgegangen wie der Satan, Gott bewahre. Niemand geht mehr dorthin. Die, die es getan haben, sind nicht zurückgekehrt.“
„Und ob Ihr es nun glauben wollt oder nicht, Bruder, man sagt, die vier apokalyptischen Reiter selbst gehen dort um. Höllenhunde. Das Land gehört längst den Toten, nicht den Lebenden.“
Der Rostbart spuckte aus, diesmal in Richtung des jüngeren Wachmanns. „Jetzt piss dir nicht ins Hemd, Jakob! Und Kleve ist der Schlund der Hölle selbst, was?“ Grimmig wandte er sich zu mir. „Was ist jetzt? Du weißt alles, was du wissen musst. Kannst ja jetzt selbst entscheiden, ob du heute dahin willst oder nicht. Meinen Arsch soll’s nicht kratzen.“
Ich verbeugte mich vor den beiden so tief, dass sie mein schiefes Grinsen nicht sehen konnten. „Werte Herren, ich danke für Euren Rat.“
Nach kurzer Unentschlossenheit machte ich kehrt und lief in Richtung Burgplatz. Mein Geld reichte noch für einen Krug Met oder Bier, vorausgesetzt, eines der Gasthäuser hatte überhaupt geöffnet.
Über die Erzählungen der Torwachen machte ich mir keine Gedanken. Ich hatte schon zu viele Schauergeschichten über die Pest gehört, um ihrem Geschwätz noch Glauben schenken zu können.
Der unvollendete Turmbau der Salvatorkirche ragte wie ein Armstumpf in den Nachthimmel, die Gerüststreben ein Kranz aus abgetrennten Knochen und Sehnen. Die Kirche war längst nicht das einzige Bauwerk, dessen Vollendung durch die Pest unmöglich geworden war.
Am Ziehbrunnen auf der Mitte der Straße ließ eine gekrümmte Gestalt einen Eimer in den Schacht hinab. Eine andere lehnte gegen die Mauer des Brunnens und hustete dröhnend. Rufe drangen vom Ende der Straße, wo ein Fuhrwerk vor einem Haus stand. Leichen wurden aus den Fenstern der oberen Stockwerke auf die Ladefläche geworfen. Die meisten Kranken starben in der Nacht. Also zogen die Totengräber bei Tagesanbruch durch die Stadt, um die armen Seelen abzuholen, für die es keinen Morgen gab. Zwischen all diesem Treiben sah ich einen Jungen, der geradewegs auf mich zuhielt.
„Mönch! Bruder!“ Schwer atmend kam er vor mir zum Stehen. Das dunkelblonde Haar hing ihm ins Gesicht. Er mochte vielleicht sechzehn sein, eine Spur zu klein und hager für sein Alter. Der Kittel ebenso dreckverschmiert wie seine Wangen, die von Schrammen überzogen waren. Anscheinend rutschte seinen Eltern öfter einmal die Hand aus. Mitleid regte sich in mir, wie schon beim Anblick der Frau mit dem toten Säugling.
„Was ist los, mein Sohn?“
„Ich …“ Seine Stimme überschlug sich. „Mein Großvater, er liegt im Sterben. Ich habe keinen Priester gefunden. Schnell! Ihr müsst ihm die Beichte abnehmen! Er will unbedingt einen Mann Gottes sprechen. Ich bitte Euch!“
Ohne zu zögern willigte ich ein. „Wo ist er?“
„In der Salvatorkirche! Der Medicus hat dort ein Notlager eingerichtet.“ Der Junge eilte davon. „Folgt mir!“
Ich spurtete ihm nach, aber schon wenige Schritte später zitterten meine Knie und meine Lunge schmerzte bei jedem Atemzug. So schnell hatte ich mich also doch nicht erholt. Der Knabe bemerkte es, als er einen Blick zurück warf, und verlangsamte sein Tempo. Ohnehin hatten wir schon den Burgplatz erreicht.
„Wie heißt du?“, fragte ich, als ich wieder Luft geholt und zu ihm aufgeschlossen hatte.
„Simon Aumann.“
„Das ist ein stolzer Name.“
„Was nützen Namen in Zeiten wie diesen?“
Es lag eine Ernsthaftigkeit in der Stimme des Knaben, die nicht zu seinem Alter passen wollte und die mich tief berührte. Sie erinnerte mich an mein eigenes Verhalten als Junge.
„Ich heiße Lucien de Courogny.“ Ich klopfte ihm auf die Schulter, während wir die Stufen zur Salvatorkirche erklommen. „Wir werden deinem Großvater die Würde zukommen lassen, die er verdient hat.“