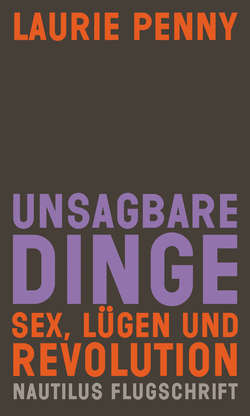Читать книгу Unsagbare Dinge. Sex Lügen und Revolution - Laurie Penny - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Privileg der Rebellion
ОглавлениеGregory Corso, Dichter der Beat Generation, antwortete auf die Frage, warum unter den überkandidelten, umjubelten, bekifften, sexuell experimentierfreudigen Dichtern der 1950er Jahre keine Frauen waren: »Es gab Frauen, sie waren da, ich kannte sie, ihre Familien steckten sie in die Anstalt, und sie bekamen Elektroschocks. In den Fünfzigern konntest du ein Rebell sein, wenn du ein Mann warst, aber wenn du eine Frau warst, hat dich deine Familie einsperren lassen. Es gab Fälle, die kannte ich; eines Tages wird jemand darüber schreiben.«32
Wer geistig gesund ist, entscheidet immer noch die Gesellschaft, und für Mädchen ist Rebellion besonders riskant. Mindestens so wichtig wie die eigenen Gefühle ist das Auftreten. Auch wenn wir innerlich auf dem Zahnfleisch gehen: Alles ist gut, solange wir unser Make-up auflegen und den Chef oder die Lehrerin anlächeln können. Andersherum wird ein etwas versponnenes Mädchen, das im Alltag zwar gut zurechtkommt, dessen Vorlieben aber zufällig nicht der Norm entsprechen, ruckzuck mit Psychopharmaka vollgepumpt, als Gefahr für die Gesellschaft eingestuft oder in die geschlossene Anstalt eingewiesen, je nachdem, wo sie zu Hause ist.
Geistige Gesundheit wird von der Gesellschaft definiert, und für Frauen und Mädchen liegt die Latte der Normalität beängstigend hoch. Wer sie überspringen will, muss trainieren. Das soll nicht heißen, dass kein Leid da wäre. Im Gegenteil: Oft entsteht Leid, eben weil es so anstrengend ist, normal zu wirken, eben weil jede für sich eine so aufreibende existenzielle Leistung erbringen muss, um das perfekte Mädchen zu sein, denn nur dieses, so hören wir es immer wieder, findet Liebe und Glück.
Wir können unser Leben lang ein perfektes Mädchen sein, nie erwachsen, nur nach und nach widerwillig alt werden. Sich für das Erwachsenwerden zu entscheiden, ist mühsam, zumal wir ja wissen, dass ein Mädchen nichts Schlimmeres tun kann, als eine erwachsene Frau zu werden. Werd nicht älter. Widersprich nicht. Denk nicht so viel nach, das macht hässliche Falten auf der Stirn. Bleib hübsch, perfekt, brav, stumm. Du kannst alles haben, was du willst, solange es nicht zu viel ist: Lass die Zeitschriften und die Werbung entscheiden, was du dir wirklich wünschst, füge dich deinem Freund, deinen Lehrern, deinem Chef. Wir wissen besser, was du willst, und wenn du ein Problem damit hast, können wir dir für dein Leiden eine Pille geben.
Gegen alles, was mit dir nicht stimmt, gibt es ein Mittel: dagegen, dass dein Körper dicker und älter wird, dass deine Sexualorgane auslaufen und bluten und an deinem Körper sichtbar werden, dass dein Herz müde wird und vor Angst schreit. Wir können dich konservieren, als perfektes Mädchen, als perfekte Konsumentin, als perfekte Arbeiterin, als Oberfläche, ausgestattet mit dezenten Schlitzen für die leichtgängige Penetration. Das Altern kann und muss mit Pasten und Pillen, mit Spritze und Skalpell bekämpft werden; sämtliche Anzeichen dafür, dass dein Körper bewohnt wurde, lassen sich weghungern oder wegbrennen.
Das perfekte Mädchen ist ein unbeschriebenes Blatt, mit gerade so viel Persönlichkeit, dass einer sie für interessant genug hält, mit ihr ins Bett zu gehen. Seit Generationen behandeln männliche Autoren, Arbeitgeber und Liebhaber die Persönlichkeit eines Mädchens als Schmuck und nicht als Ausdruck ihrer Handlungsfähigkeit. Persönlichkeit ist für das perfekte Mädchen ein gut gewähltes Accessoire, das sie diskret einsetzt, um damit ihre ansprechendsten Eigenschaften herauszustreichen.
Das perfekte Mädchen interessiert sich kaum für die Welt. Sie hat auch kein Innenleben, über das Minimum hinaus, das sie braucht, um das Interesse eines Mannes zwischen einer zufälligen Begegnung und dem Schlafzimmer wachzuhalten. Sie ist weder ein innerliches noch ein äußerliches Wesen; vielmehr besteht das perfekte Mädchen nur aus Oberfläche. Auf die Oberfläche kommt es an.
Natürlich gibt es das perfekte Mädchen gar nicht.
Siebzehn Jahre alt, eingerollt unter dem Krankenhausbett wie ein Komma, wie ein unfertiger Satz, Gestammel. Das nervige Flurlicht, das nie ausgeschaltet wird, erhellt im Dunkel meiner Höhle den rotzfarbenen Teppich. Ich zittere. Ich komme von allem runter. Ich weigere mich immer noch zu essen, aber mein Widerstand wird mürbe. Ich klettere von der Klippe, auf der alles klar und eindeutig war, auf der das Todesversprechen prangte wie das Schulabzeichen auf dem Blazer der Schuluniform, der um mein Skelett hängt. Als mich die Ärztin an diesem Morgen zwingen wollte, ein ekelhaftes Proteingetränk zu schlucken, erklärte ich ihr, dass ich es nicht wollte, und sie fragte mich, was ich denn wollte?
Die Antwort hakt in meinen Zähnen wie ein Schluchzen – ich will nichts. Ich will nichts. Nicht Essen Wasser Luft Aufmerksamkeit eine neue Weltordnung. Ich will nicht fünfzig Jahre alt werden, in denen ich nie genug bin, nie genug tue, nie genug arbeite. Ich will nicht einmal, dass Sie mich zum Sterben allein lassen. Bleiben Sie hier, sehen Sie verdammt nochmal zu, wenn Sie wollen, ist mir doch egal.
Ich will nichts. Ich flüstere es in meine Hände, sage es dann lauter, immer wieder, stundenlang, bis die leidgeprüfte Nachtschwester, die so eine gequirlte Scheiße gewohnt ist, zu mir ins Zimmer kommt und sagt, ich solle den Mund halten und schlafen. Sie findet es gut, dass ich nichts will, aber sie will bitte gern eine ruhige Nacht haben.
Auf der Station bin ich so etwas wie eine Anomalie. Ich kam mit kurz geschorenem Haar, vollgesogen mit Henna und Riot Grrl Rock, gekleidet wie ein Junge, offensichtlich queer. Erst später erfahre ich, dass ein Viertel bis die Hälfte der jungen Leute, die wegen Essstörungen in die Klinik eingewiesen werden, schwul, lesbisch oder genderqueer ist. Die jungen Frauen, die schon hier sind, sehen aus wie kaputte Modepüppchen; wir kommen alle aus derselben grotesken, ausgemergelten Gussform, können kaum aufrecht stehen, haben alle dieselben lila Schnittnarben, eingekerbt wie Barcodes in verborgene Stellen der Haut.
In einer Ecke kauert Ballerina-Barbie, so abgemagert, dass sie für Erwachsenentrikots zu winzig ist. Wir haben Babydoll-Barbie und Hiphop-Barbie und Cheerleader-Barbie und sogar die tiefgläubige Muslima-Barbie, die eine Woche nach mir kommt, im Hidschab, den sie, kaum dass ihre Eltern gegangen sind, abwirft, um den Rest ihres stationären Aufenthaltes im rosa Trainingsanzug ketterauchend auf der Treppe zu sitzen. Ich wäre wohl Punk-Dyke-Barbie, der Lesbenpunk, 2004 die wohl unbeliebteste Barbie, und mein Modus operandi ist Misstrauen. Die anderen auf Station sehen aus wie die Mädels, vor denen ich immer Angst hatte. Ich lebe in ständiger Erwartung, dass eine von ihnen mir Orangensaft in den Rucksack gießt, wenn ich gerade nicht hinsehe. Es ist schlimm genug, in einer geschlossenen Station eingesperrt zu sein, aber musste man mich ausgerechnet mit einem Haufen hohler Modepüppchen zusammenpferchen? Offenbar haben sich diese Mädchen bis zum Zusammenbruch heruntergehungert, weil sie hübsch sein wollen; ich dagegen habe absolut vernünftige, intellektuelle Gründe für mein Verhalten. Wir werden nie Freunde sein. Wir haben nichts gemein.
Diese Sichtweise hat ziemlich genau achtzehn Stunden Bestand, bis zum ersten planmäßigen Nachtessen. Wir kauern alle auf billigen Krankenhaussofas und versuchen, uns zwei mickrige Kekse in den Mund zu schieben, und dabei haben wir das Gefühl, in der eigenen Haut gekocht zu werden. Ich starre in den Fernseher und zwinge mich, nicht zu weinen. Cheerleader-Barbie, die zehn Jahre älter ist als ich und ihre eigene Geschichte hat, rückt näher und legt mir einen knochigen Arm um die Schultern.
»Ist gut«, sagt sie. »Du schaffst das.«
Ich lasse mich festhalten. Ich nehme einen Keks in die Hand. Und etwas verändert sich.
In den Wochen und Monaten meines Klinikaufenthaltes werden diese Mädchen meine besten Freundinnen sein. Ich werde mit siebzehn Jahren lernen, wofür manche Menschen Jahrzehnte brauchen: dass hübsche Mädchen, die dem Patriarchat in die Hände spielen, und hässliche Mädchen, die zu keiner Party eingeladen werden, gleichermaßen leiden. Dass uns allen derselbe böse Streich gespielt wird. Das Perfekte-Mädchen-Spiel kann man nicht gewinnen. Ich weiß das. Wir alle wissen das. Und mit dem Wissen kommt die Wut. Wut darüber, dass wir versucht haben, uns auszuhungern, auszubrennen, auszubluten.
Cindy ritzt sich, wie jedes Mädchen, das von den Menschen verletzt wurde, die sie lieben müssten. Weil sie gern großes Theater macht, weil sie sich im Flur kreischend die Arme aufritzt, weil sie im Laden Make-up und Schmuck klaut und nach dem Essen kotzt, glauben ihr die Krankenschwestern und Ärzte nicht so recht, als sie erzählt, dass ihr Vater sie missbraucht hat. Dass sie nicht mit ihm allein sein will, wenn er zu Besuch kommt. Dass ihre Mutter und die Lehrer davon wussten und nichts unternahmen. Sie ist ein wütendes asiatisches Mädchen mit Akzent: Sie müsste doch Respekt haben vor ihren Eltern, offensichtlich ist sie verrückt, die nimmt man besser nicht ernst. Medikamente und Psychotherapie könnten ihr helfen; von der Justiz ist keine Rede.
Das Ritzen beruhigt Cindy und beunruhigt alle anderen, was meiner Ansicht nach besser ist, als wenn sie still und leise in ihrem Schmerz und Zorn ersticken würde, obwohl es mir lieber wäre, sie würde nicht gerade meine CD kaputt machen. Mir wäre es lieber, sie würde es überhaupt nicht tun. Mir wäre es lieber, sie müsste es nicht tun. Mir wäre es lieber, ich könnte sie in die Arme nehmen und wiegen, bis sie alles Schlimme, das ihr je zugefügt wurde, vergessen hat.
Weil die Hälfte der Mädchen auf Station sich ritzt, gibt es hier weder scharfes oder spitzes Besteck noch zerbrechliches Geschirr. Der Körper muss bestraft und eingesperrt werden, und das geht letztendlich am besten so. Es gibt Wörter, die unaussprechlich sind und stattdessen in die Haut geritzt werden. Man könnte meinen, mir ginge es gut, aber das stimmt nicht. Wenn wir älter werden und merken, dass wir in einem Körper festsitzen, der zur Gewalt offenbar geradezu einlädt, einem Körper, der alles zu sein scheint, wozu wir gut sind, einem Körper, der plötzlich und in alle Ewigkeit das Wichtigste an uns ist, so hat es eine makabre Logik, wenn wir versuchen, uns aus ihm heraus zu schneiden. Ihn zu bestrafen und zu beherrschen. Den Körper, der Schmerzen und Hunger hat und unablässig etwas will. Den Körper, der uns verrät.
Ein braves Mädchen zu sein kann uns umbringen. »Frauen haben nicht nur das Problem, dass sie herausfinden müssen, was im Persönlichen politisch und was im Politischen persönlich ist«, schreibt M. Sandovsky in ihren »Letters to L.«. »Sie müssen vor allem lernen, in einem Widerspruch zu leben.«33 Früher sagte man uns immer, die Welt liege uns zu Füßen, solange wir nur hart arbeiteten, ein bisschen Busen durchblitzen ließen und immer schön lächelten. Wir merkten, dass das eine Lüge war, gerade rechtzeitig, damit einige von uns sich noch fangen konnten, ehe sie abrutschten.
Man gelangt an einen Punkt, an dem man entscheiden muss, was man für das Überleben opfern will. Es ist jetzt zehn Jahre her, und mittlerweile ist so viel passiert, dass ich nicht mehr weiß, wann genau ich beschlossen habe, es mit dem Leben zu versuchen, nur so als Experiment, um zu sehen, ob ich es schaffe. Vielleicht war es nach der langen Nacht, in der ich geheult hatte, dass ich nichts wollte; als ich unter dem Bett hervorkrabbelte, gegen das grelle Licht des Flurs blinzelnd in die kleine Stationsküche schlurfte und zum ersten Mal ohne Widerstand einen Toast aß. Ich erinnere mich nur an den knusprigen gebutterten Toast und die Angst, dass ich, wenn ich die Niederlage meines Hungers zuließ, nie aufhören würde zu essen, dass ich essen und essen würde, bis ich die Welt verschlungen hätte. Der Hunger eines jungen Mädchens ist etwas Fürchterliches.
Vielleicht war es auch Monate später, als ich das Krankenhaus verließ, im neuen Kleid und mit Lippenstift, den ich aufgetragen hatte, um die Stationsschwester davon zu überzeugen, dass ich endlich ein gesundes Mädchen war, das ein gesundes Leben führen wollte. Ich hatte mir den Gesichtsausdruck aufgemalt, den wir Frauen einzusetzen lernen, wenn wir der Welt vorgaukeln wollen, dass wir glücklich sind. Durch das Fenster des Taxis, das mich weiß der Teufel wohin brachte, nur nicht nach Hause, winkte ich meinen Freundinnen zu. Ich wusste, dass ich nie wieder nach Hause zurückkehren würde. Ich wollte das Krankenhaus verlassen und mein Studium fortsetzen, ich wollte die Welt bereisen, mich in schrillen Bars betrinken, jede Menge Jungs vögeln und jede Menge Mädchen küssen, ich wollte in Berlin und New York leben und bei Nacht nur mit Rucksack, Pass und Laptop über den Ozean fliegen. Ich wollte die Nacht barfuß durchtanzen und viele Bücher lesen, und eines Tages wollte ich auch Bücher schreiben.
Ein braves Mädchen, ein perfektes Mädchen zu sein, kann uns schnell umbringen oder auch langsam umbringen und alles Wertvolle in uns, die besten Träume unseres Lebens trist und gleichförmig machen. Mit siebzehn beschloss ich, es mit einem anderen Leben zu probieren, und das war beängstigend, es war zu viel, und das ist es immer noch, aber es war auch nicht schlimmer, als mit einem aufgemalten Lächeln zu Hause zu bleiben. Ich sehe jeden Tag Frauen, die diese Entscheidung treffen, Teenager, Frauen mit zwanzig, sechzig und siebzig, und in dieser schönen neuen Welt, in der Empowerment, Selbstermächtigung, bei Frauen gleichgesetzt wird mit teuren Schuhen und der Frage, ob sie für den Chef die Beine breit machen, in einer solchen Welt ist diese Entscheidung die einzige, die wirklich zählt. Wer sie trifft, wird eine egoistische Schlampe geschimpft, Freak, Nutte, Fotze, Hure, einigen gelten wir auch als rebellisch, entartet, renitent, manchmal sind wir polizeibekannt. Wir sind die, die zu laut lachen und zu viel reden und zu viel wollen und für sich arbeiten und eine neue Welt sehen, die knapp außer Reichweite ist, die am Rand der Sprache darum ringt, ausgesprochen zu werden. Und manchmal, zu später Nachtstunde, nennen wir uns Feministinnen.