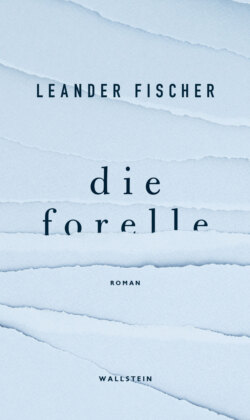Читать книгу Die Forelle - Leander Fischer - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
Schuldige werden gefunden
Оглавление»Wir haben Hunger, Hunger, Hunger«, es war Sonntag und ich gerade zur Haustür herein. »Schön«, sagte Lena, während die Kinder weiter skandierten, »haben Hunger, Hunger, Hunger, haben Durst«. Aus dem brodelnden Wasser im Topf fischte Lena die letzten Erdäpfel, tischte mir auf, »teilt sich durch vier eh besser«, und öffnete das Ofenrohr. Heraus kamen eine Wolke Kräuterbutterbrutzeln, vermischt mit einem Stich Gas, »für jeden eine halbe«, und zwei Regenbogenforellen. Auf der dunkelknusprig gebackenen Haut war der typische rosa Streifen nicht mehr zu erkennen. Lena kratzte die Basilikumkruste ab, filetierte, zitronierte. Das Fleisch schmeckte wie Brittens Mittsommernachtstraum. Ich aß mit Begierde. »Sind sie gelungen?«, fragte Lena, und weil niemand wusste, an wen die Frage gerichtet war, gab sie Antworten auf Fragen, die niemand gestellt hatte. »Die hat mir der Volki gebracht«, ich hustete den Bissen über die Tischplatte: »Wer?« – »Es ist voll eklig, Papa«, sagte Johannes. Lukas tippte mit dem Zeigefinger, ohne hinzusehen, einen Rosmarinstachel auf und steckte ihn in den Mund. Seine Pupillen waren stoisch auf mich gerichtet. Meine wiederum auf das an der Tischkante kleben gebliebene Stückchen Fleisch. Ich konnte meine Zahnabdrücke daran ablesen. »Ein Arbeitskollege. Ein netter Mann. Der fischt auch. Ein Wunder, dass du den nicht kennst, komisch«, mit verzückten Zügen schob Lena eine Filetspitze in ihren Mund. Ich aß kein bisschen mehr. Lena legte die Kinder nieder. Ich, am Küchentisch verblieben, nahm den Löffel, mit dem Lena geschmolzene Butter auf unsere Teller geschöpft hatte, schmiegte die Krümmung an den eingespeichelten Eiweißklumpen, nahm ihn auf, schleuderte ihn weg. Er klatschte gegen das Fenster, blieb an der Glasscheibe kleben, auf der Spiegelung des Türrahmens, an dem sich Lena rieb. Sie ging in die Hocke, streifte mit dem Rücken den Reißverschluss ihres weißen Kleides entlang das Holz hinab, verschwand auf der Fensterscheibe, richtete sich wieder auf, reckte den Kopf in den Nacken, dass ihr blondes Haar noch etwas tiefer unter ihre Schulterblätter fiel, warf mir mit halbgesenkten Lidern einen Schlafzimmerblick zu und ging wieder, während sie einen ihrer Fingernägel zwischen die Zähne nahm, in die Knie. Das Letzte, was ich davon sah, war ihr Scheitel, den ich auch als Erstes wieder erblickte, dann ihre Augen, ihre Nase, Mund. Lenas Kniebeugen ähnelten eher einem steten Auf- und Abtauchen, was mich mehr faszinierte als ihre Erscheinung. Während des Essens hatte sie kein Kleid getragen. Die Haare auch eben erst drapiert. Parfum, das über den Fischgeruch an meine Nasenflügel schwebte, Lippenstift, gut aufgelegt. Elf zwei-und-zwanzig, eins, beiß an! »Wer nicht will«, sagte Lena und ich, »du, passt schon.«
Es dauerte eine Ewigkeit, bis ich aufstand, um das Küchenfenster zu öffnen. Zuvor starrte ich völlig versunken auf mein eigenes Gesicht. Ich besah die Geheimratsecken, die gefurchte Stirn, die verunsichert zuckenden Nüstern, die lustlosen Augen, das eine daumenlange Haar, das über meinem linken Auge wuchs und von meinem Antlitz abstand wie ein Fühler, ein Bastard aus Wimper und Braue. Immer wieder musste ich mir Volki vorstellen, der weniger eine reale Person als das genaue Gegenteil von mir wurde, nett, adrett, charmant, charismatisch. Teils, weil ich meinen eigenen Anblick nicht mehr ertrug, teils, weil ich Volkis Geist aus dem Zimmer vertreiben wollte, teils, weil sich Lenas phantastische Gestalt immer wieder lasziv zwischen meinem ausgelaugten und Volkis kraftstrotzenden Körper rekelte, hauptsächlich aber, weil mich die Noten des Fisches, der Kräuter und Lenas Parfum in dem sauerstoffarmen Raum bedrängten wie eine infernalische Symphonie, richtete ich mich dann auf. Erhoben wirkte meine gespiegelte Gestalt gleich etwas wohltuender. Ich lüftete. Alles Böse entließ ich in die versöhnliche Finsternis der Nacht. Die Kühle schlug mir derart frisch um den Kopf, dass ich mich in voller Kenntnis aller Folgen sofort nochmals mit Lena, der Frau aus der Stadt, dazu entschlossen hätte, in die Provinz zu ziehen. Ich warf die Regenbogenforellenreste in den Mülleimer, spülte die Teller unter warmem Wasser vor, räumte den Geschirrspüler ein. Ich schrubbte das Tablett und die Küchenmesser. Dabei wurde mir immer wohler. Im Rumoren des Geschirrspülers und dem Abflussstrudel im Spülbecken verschwanden mit den Fettspritzern und Zitronenflecken die letzten stummen Spuren. Ich besah mein Gesicht wesentlich milder auf dem blankpolierten Tablett, auf dem Schliff des Messers und stapelte alles auf das Abtropfgestell. Etwas traurig, mich jetzt, nach Verrichtung meiner Pflichten, nicht auf der Scheibe beschauen zu können, setzte ich mich wieder auf meinen Posten und sog Luft ein. Ich schloss die Augen. Es roch nach Nadelwald, nach nasser Erde, einem Gewitter, das gleich aufziehen würde, als ob der Boden es schon nicht mehr erwarten könnte. Ich dachte daran, wie meine Geige einsam in ihrem Koffer lag, dem ich sie morgen entnehmen würde wie einen Fisch dem Fluss, um Kindern zu zeigen, wie sie die Legatobögen zu führen hatten, wie die Pizzicatostellen zu zupfen, die Marcato zu donnern. Ich überlegte, ob das Fliegenfischen langsam zum Ersatz wurde für die fahrengelassene Konzertviolinistenkarriere, ob es die Form einer unterschwelligen Rache an den Menschen annahm, für die da zu sein letztlich so viel wichtiger gewesen war, als ein wirklicher Virtuose zu werden. In Salzburg, noch Starschüler des letzten Studienjahres am Mozarteum, schon von einem Vorspielen für die großen Bühnen und Orchester zum nächsten hetzend, zwischen den beiden, auf Vormittag und Nachmittag verteilten Qualifikationsrunden, es ging um eine freie Stelle als zweite Geige der städtischen Philharmonie, in einem Gastgarten dann, wo ich gedachte, ein Mittagessen einzunehmen, da lernte ich Lena kennen. Sie saß am Tisch gegenüber, ich rief ihr zu, ein so weißes Kleid könne doch nur eine Ärztin tragen. Sie sprang auf von der Bierbank, kam an den Tisch, wo ich ganz allein vor meinem Schnitzel saß, und fragte völlig ungläubig, woher ich das wisse. Ich versuchte es mir zu verkneifen, doch das Schmunzeln sowie schließlich das Lachen schlichen sich ein und brachen aus mir aus. Obwohl sich die Komik in erster Linie aus dem Funktionieren der offensichtlichsten Schmeichelei speiste, die man sich überhaupt ausdenken konnte, stimmte Lena augenblicklich gellend ein. Zusammen klangen wir harmonischer und trillerten unsere Melodien ausgelassener als jede Komposition dieser Welt von welchem Orchester auch immer intoniert. Was wäre mir anderes übriggeblieben, als die zweite Hälfte des Vorspielens, für die ich mich qualifiziert hatte, in einem lustigen Operettenton in den Wind zu pfeifen, der im ersten Aufzug darin bestand, Lena zuzunicken, als sie fragte, ob sie sich zu mir setzen dürfte, im zweiten, als sie sagte, ich überfalle wohl eine Bank, zu antworten, nur die in diesem Gastgarten hier, und als sie den offensichtlich verwirrt mit ihrem Backhenderl herumstehenden Kellner an unseren Tisch winkte, zum grande finale schelmisch zu lamentieren, wie unverschämt groß und für einen gar nicht zu schaffen in diesem Gastgarten die Dessertportionen seien. Sie helfe mir gerne, sagte Lena. Zur Nachspeise gab es erst Kaiserschmarren und dann Sex. Ihre goldenen Haare und die blonde Süßigkeit vermengten sich zu einem köstlichen Vorschein auf unser beider gemeinsame Zukunft. Es ging auch schon gar nicht mehr anders, sehr bald war Lukas unterwegs. Nach Oberösterreich verschlug es uns dann, weil dort gerade ein neues, von skandinavischen Nationen abgekupfertes Musikschulsystem installiert wurde. Die Subventionen wurden an eine alle paar Jahre von den Schülern landesweit abzulegende sogenannte Übertrittsprüfung gekoppelt. Je mehr sehr gute Noten es regnete, umso unverhohlener fiel vom Ministeriumshimmel für Bildung, Kunst und Kultur das Gold, was eine regelrechte Sturzflut sich in Oberösterreich niederlassender Musikschullehrer aus ganz Österreich zur Folge hatte. Wir unterrichteten nicht gerade auf Stradivaris, aber zumindest nicht wie andernorts in diesem Land auf den aus Kirchenorchestern aussortierten Kniegeigen.
Dank meiner erstklassigen Ausbildung und meiner Jugend wurde ich nicht auf die Warteliste für freie Stellen im Landesmusikschulverband Oberösterreich gesetzt. Man wies mir direkt einen Posten in jenem Provinzkaff zu, in diesem Provinzkaff, in dem ich mich immer noch befand. Die Stelle auszuschlagen hätte bedeutet, zuallerletzt auf der Warteliste zu landen. Ich bezeichnete es immer als ein großes Glück, denn wir brauchten mein Gehalt dringend, Lena, Lukas, Johannes und ich. Sie hingegen, die abgesehen von ihrem Medizinstudium in München ihr Leben in Salzburg verbracht hatte, stauchte den Beamten am anderen Ende der Leitung zusammen, was ihm denn einfalle, einen Mozarteumsabgänger wie ihren Mann, statt ihm den rötesten Teppich der Landeshauptstadt Linz auszurollen, ins gottvergessenste Nest zu entsenden, wo das Musikalischste, was von den im Katholizismus ihrer Elternhäuser feststeckenden Kindern zu erwarten war, ein fehlerfrei gesungenes Vaterunser sei. Der Beamte habe vernehmbar unbeeindruckt geantwortet, man sei gerade Konservatoriumsabsolventen gegenüber misstrauisch eingestellt inzwischen, man habe schlechte Erfahrungen gemacht, gerade hervorragende, ihre Karriere aber nicht verfolgende, verkappte, gescheiterte, schiffbrüchige, auf der Strecke gebliebene, et cetera et cetera, sie wisse ja, Möchtegern-Solisten in einem Wort, verlören oft die Geduld gegenüber den mindertalentierten Schülern, ja würden an regelrechten Wutausbrüchen leiden, und mit Verlaub, nichts gegen ihren Mann, so etwas mache eben das Konservatorium aus Menschen, sobald man drin stecke, im Konservativen, man gehe gelassen hinein in die Leistungsdruckpresse und komme als Choleriker heraus, und im Gegensatz zu den verzogenen Stadtschnöseln seien die oberösterreichischen Bauernkinder die ruppigen Rügen dann wenigstens von Haus aus schon gewöhnt. Mit höflicher Verabschiedung habe der Beamte eingehängt, wie mir Lena erzählte, als ich die erste Abmahnung von Seiten der Musikschuldirektion nach Hause brachte, da ich ein Kind angeblich angeschrien hatte.
Wir saßen uns gegenüber, ich öffnete die dritte Flasche Wein, sie taxierte mich, misstrauisch, und über ihre Lippen kam kein Sag-mir-dass-das-nicht-stimmt, nur ein weiterer Schluck aus dem wieder aufgefüllten Achterlglas schwappte in ihren Mund, ein Erfunden-und-erlogen-eine-Intrige-stimmts hätte ich mir gewünscht. Das Wort wäre vielleicht an mir gewesen, womöglich hätte es an mir gelegen. Doch Lenas in Bewegung geratene Kiefer lieferten schon bloß diese Geschichte vom Telefonat mit dem Beamten statt einem Da-muss-eine-Verwechslung-vorliegen-eine-Supplierung-bestimmt. Sie stellte das Glas wieder auf den Tisch, ließ ihren Kopf etwas sinken, dass die Haare fielen vor ihren Blick, kicherte und lachte dann in sich hinein, oder lachte über mich, wer weiß. Sie hob ihren Schopf und nahm mich in Augenschein, ihren inzwischen verstummten Kinderanschreier, kein Nein-nein-das-muss-ein-anderer-gewesen-sein. Schon damals kam sie mir mit einem anderen Mann, den sie angeblich angeschrien hatte, einem vor weiß der Teufel wie langer Zeit stattgefundenen Gespräch, einer Geschichte aus der Vergangenheit, von der ich zwar nicht sagen kann, ob sie je stattgefunden hat, aber sie hat etwas mit mir gemacht. Wenn ich darüber nachdenke, hat mir Lena gesagt, der Beamte habe gelogen, die Kinder vertrügen weder Schläge noch Rüge, sie hätte den Kopf schütteln und schimpfen können auf die Jugend von heute. Sie hätte sagen können, der Beamte habe eben recht behalten, ich könne nichts dafür, dass diese Kinder Welten schlechter spielten als ich in ihrem Alter und alles andere als Ambitionen im Beherrschen welches Instruments auch immer hegten, ich solle sie in Zukunft einfach ein bisschen pianissimo schelten. Stattdessen formten Lenas gellende Stimmbänder eine nahezu hysterische Schimpftirade. Ihre rotweinverkrusteten Lippen bebten, ihre Hände warfen an die Wände dieser Küche in wildem Fuchteln ekstatisch zuckende Fingerschatten, die innerhalb weniger Sekunden in jede mögliche Richtung, nur nicht in meine wiesen, auf alle Punkte im Raum, bloß nicht auf mich zeigten. Mindestens so schnell, wie ihre Arme gestikulierten, feuerten ihre Hirnwindungen. Die Stimmbänder kamen beinahe nicht hinterher und klirrten in den höchsten Tönen, noch heller als das Weinglas, das Laut gab, wenn Lena zwischendurch mit der Faust auf die Tischplatte hieb, über die ihre Zunge Spucke schleuderte mit jedem Satz weiter bis in mein Achterl hinein.
Dieses Scheißkind hätte offensichtlich einen guten Draht zu seinen Eltern, die wiederum einen guten Draht zur gottvermaledeiten Musikschulobrigkeit hätten, die im Übrigen die verfluchten Nachbarn der – Teufel noch eins – Cousine dritten Grades der kreuzkruziverfickten Eltern des Kindes wären in diesem inzestigen »Scheißoberösterreich!«. Als hätten wir ihn nie weggelegt, griff Lena den Tabak vom Fensterbrett. Die hauchdünnen Blättchen waren noch darin. Ihre Finger schmiegten raschelnd eins davon um das dunkle, trocken gewordene Zeug zusammen. Zum Zigarettenmachen brauchte sie keinen Blick. Während der ganzen Prozedur schaute sie mich an, wie mechanisch arbeiteten ihre feingliederigen Hände, als wären sie kein Teil von ihr. Sie leckte den Klebestreifen ab. Ihre Augen blieben bei mir. Keine einzige vertrocknete Fluse fiel auf die Tischplatte, obwohl der Tabak schon seit Jahren zu Krümeln zerfiel und mitnichten noch in Strähnen zusammenhielt. Ja, sie könne auch ganz schön wütend werden, sagte sie, und es wäre kein Wunder gewesen, hätte sie Feuer gespien, um die Zigarettenspitze in Glut zu verwandeln. Der Funke hätte überspringen können bei der ersten Berührung mit Lenas heißgeredeten und rotgetrunkenen Lippen. Die Zigarette im Mund hielt sie nun Daumen und Zeigefinger aneinander und ich wartete auf ein Schnipsen und das Auftanzen einer Flamme in Verlängerung ihres Nagels. Doch sie riss bloß an der Tischkante den Streichholzkopf an wie eine Filmschauspielerin und warf mir ihr schönstes Hollywoodlächeln zu. Ein Drehbuchskript ersehnte ich, dessen eingelernter Text jetzt nur zu wiederholen wäre, ein Satz, eine Bemerkung nur, vielleicht bloß ein Wort, das angebracht war und mich in seinem Widerschein erstrahlen ließ, mir einen Nimbus der Rechtschaffenheit verlieh und mich in einen unglaublich netten, adretten, charmanten und charismatischen Leinwandhelden verwandelte, getaucht in Scheinwerferlicht.
Doch das einzige Leuchten ging schummrig von einer krepppapierumwickelten Stehlampe und Lenas glühenden Zügen aus, bis sie das Rotweinglas senkte aus ihrem Gesichtsfeld, womit auch der rosa Hauch von ihren Wangen wanderte. Ihre Wut war verraucht und ihre Haut vielmehr blass, als käme sie gerade aus der Maske eines Fünfzigerjahre-Schwarz-Weiß-Studios. Mit jedem Heben und Senken des Rotweinglases an ihren Mund wanderte dann das Purpur wieder in ihr Gesicht, ein Farbgemisch in sattem Pastell, das zu ihren Lippen passte wie zu ihren Wangen, nur für meinen Augenblick. Zwischen den Schlucken zischte dann die Zigarette auf, das Zepter in der linken, den Pokal in der rechten. Einen Arm hielt sie lässig hinter die Sessellehne geklemmt, den anderen den übergeschlagenen Oberschenkel parallel entlang bis zum Knie, weswegen sie bloß in den Ellenbeugen zu knicksen brauchte, um abwechselnd zu trinken und zu rauchen. Zwischen den Schlucken und Zügen ließ Lena weder mich aus den Augen noch aus den Fingern Zigarette und Glas. Sie gingen Mal für Mal hintereinander an Lenas unverändert leicht geöffneten Mund, bis sie die Lippen schürzte und mir einen Rauchring entgegenblies, der sich ausbreitete, zuletzt nur von meinem Hals zersetzt in meinem Rücken weiterschwebte Richtung Wand. Ein Knistern lag in der Luft, doch als mein Blick Lenas aufgeladen zitterndem Haar ihre Gestalt hinabfolgte bis auf das Achterl, war es doch nur der in den letzten Tropfen fallen gelassene Zigarettenstummel. Auf die Tischplatte knallte Lena das Glas und fasste stattdessen den Korkenzieher. Auf dem Drillbohrer steckte noch immer der durchstoßene Korken. In der einen Hand drehte sie das Gerät nach oben und noch etwas weiter in meine Richtung. Jetzt, über den Tisch gebeugt, huschten Lenas Pupillen abwechselnd auf mich und auf den Korkenzieher, dessen Schenkel sie gerade nach hinten legte und umfasste, quälend langsam, woraufhin der gewundene Dorn samt Kork sich sachten Klackens auf mich zu bewegte. Ein feiner Riss zog sich durch den Mantel und Lena legte Hand daran und schaute mich an. »Drecksland!«, sagte sie, nahm den Korken zwischen die Fingerkuppen und in den Blick. Langsam drehte sie ihn, ihre Sehnen pulsierten, es quietschte. Dann hielt sie inne. »Dreckskinder!« und das Hochschießen ihrer Augen trafen mich gleichzeitig. Dann duckte sich der Blick wieder. Ein Drehen am Korkenzieher, der Verschluss wanderte die Spirale hinauf wie Lenas Pupillen meinen Hals. »Drecksau!«, zischte sie und nahm den Korken vom Korkenzieher und ließ sich in den Sessel zurückfallen. Dann knickste sie nochmals in der Ellenbeuge, und ehe ich mich fragte, woher sie denn jetzt Kippe oder Achterl griff, knallte mir der Korken gegen die Stirn. Lenas Hand lag in der Luft, noch im Wurf begriffen sah ich sie. Ein Klonken am Boden erwartete ich. Doch der Schuss war nur ein Stups, der Aufprall nicht hart gewesen. Sacht lag der Kork in meinem Schoß. Ich musste schmunzeln. Sie: »Herr Konzertmeister«, sprachs, stand auf, ich sagte darauf, »wer ist am wütendsten im ganzen Land?«, Lena trat Schritt um Schritt, in Richtung Bad, wie ich hörte, weil ihr weißes Kleid am Boden schleifte, »Herr und Frau Doktor, ihr seid das«, zerborsten einerseits der Mantel des Korkens in meinem Schoß, wie ich sah, ein gebrochener Ring, Spleiße standen davon ab. »Aber der Herr Musikschulprofessor hinter Tunnel und See bei den Oberlander Blagen ist noch tausendmal wütender«, Parfum schweifte hinter ihrem Hals, als sie über mich herfiel, Haar drapierte um meinen Kopf, »scheiß Zigarettenrauch«, lippenstiftig schaute ihr Mund aus, schmeckte rotweinerlich, mein Reißverschluss zirpte. »Spiel mit mir«, wisperte sie. »Schlag mich«, flüsterte sie. »Beiß mich, kratz mich«, sagte sie. »Zieh an meinen Haaren, zieh dran, zieh«, befahl sie, schrie, »schrei mich an, schrei mich an, schrei mich an, schrei mich an!« Wahrscheinlich wollte sie wenigstens einmal zumindest irgendeine Reaktion.
In Wirklichkeit hatte es dieses Kind wie den Beamten natürlich nie gegeben. Wie die meisten meiner unfähigen Kollegen, die sich darüber freuten, wenn die Bälger zu Hause nicht übten und keine aufkeimende Konkurrenz die ohnehin schon rar gesäten freien Stellen befiel, hatte der Musikschuldirektor lediglich eine Musikpädagogische Hochschule besucht. Der Schrei, den er angeblich aus meinem Unterrichtszimmer gehört haben mochte, war wohl in der Wartezeit erklungen, die stets entstand, wenn ein Schüler die Stunde verfrüht verließ und der nächste sich verspätete. Dann nämlich pflegte ich, damit mir die Finger bis zum nächsten Kind nicht kalt wurden, das Tschaikowskyviolinkonzert einzustudieren und zu üben. Die Melodien, Läufe und Verzierungen, die den Raum erfüllten und jede Sekunde von der Virtuosität kündeten, die sie ihrem Interpreten abverlangten, mussten in den Ohren des Herrn Musikschuldirektors geklungen haben wie Kampfschreie, Fechthiebe gegen ihn persönlich, die er nur mühsam parieren konnte, gegen seinen lausigen Posten, den ich nie wollte, und seine angeblich absolute, lächerliche Autorität. Es war weder meine Absicht noch mein Interesse, den Herrn Direktor herauszufordern. Allein, was hätte ich anderes tun sollen. Die Position, einen Schüler zu unterweisen, muss man sich tagtäglich erarbeiten, und wann hätte ich üben sollen, bestanden die Unterrichtsstunden doch darin, dass die Schüler spielten. Wären meine Schultern eingerostet und meine Finger nach und nach verklemmt, ich hätte meinen Beruf aufgeben müssen. Der Musikschuldirektor sah es anders, er sah den Affront gegen seine Person und gegen seine Funktion, gegen den ursprünglich aus Oberösterreich stammenden Oberösterreicher und gegen den gesamten oberösterreichischen Musikschulverband, dessen Unterrichtssystem aus Skandinavien stammte und dessen Lehrer aus ganz Österreich, die mit dem Musikschuldirektor nur darin eine Einheit bildeten, dass sie allesamt Nebochanten waren. Und dass sie keine Ahnung von ihrer eigenen Ahnungslosigkeit hatten. Und dann kam ich. Unzählige Male stellte ich mir vor, wie der Musikschuldirektor vor meinem Unterrichtszimmer stand, an der Tür lauschte, der Schüler, den ich erwartete, neben ihm. Auch er trat nicht ein, weil er lieber mir durch die Tür zuhörte, als selbst zu üben. Immerhin ist eine Konzertkarte ja auch teurer als eine Stunde Geigenunterricht. Beide schmiegten sie ihre Ohren sehnsüchtig an die angeblich schalldichte Doppeltür. Was für ein heruntergekommener Laden. Wie oft fragte ich mich, wo die verheißenden Subventionen denn hinflössen? Aber all die Schmiergeldaffären und Scheinanstellungen und Misswirtschaften vergebens und vergessen, hinweggespielt von mir und Tschaikowsky, obwohl ich doch nur meine Finger warm halten wollte. Und schön war es doch. Wer weiß, wie vielen meiner Stümperkollegen ich in den Jahren meiner Anstellung unwissentlich das Leben gerettet habe, wenn sie während einer meiner Tschaikowskypausen gerade den Gang hinunterschritten auf dem Weg zum Dach, da sie sich entschlossen hatten, den eine Oktav tiefer gelegenen Schlussakkord ihres Daseins zu setzen. Sie hörten mich und kehrten um. Sie wandten sich ab vom Musikschuldirektor. Sie fanden wieder Freude an ihrem Beruf. Es wäre sogar durchaus möglich, dass ich die Abmahnungen statt der Kündigung und die Unterrichtszimmer die Doppeltüren statt wirklich schalldämpfender Beschichtungen bekamen. Die zu erbauende Belegschaft und das zu unterrichtende Kind lauschten weiterhin meinem privaten Kleinod. Der Schüler wusste, wer er werden könnte, wenn er nur immer brav in die Stunde kam. Und der falsche Meister trat hinzu, bekam mit, wer er hätte werden können, hätte er seinen Arsch aus diesem Oberösterreich hinausbewegt. Vergangenheit und Zukunft, Gram und Verheißung verdichteten sich in den Köpfen dieser beiden Zuhörer zu einem einzigen Moment, und in der schönsten Passage des Konzerts, mitten in die improvisierte Kadenz hinein, fragte der Musikschuldirektor das Kind, warum es denn nicht hineinwolle zum Herrn Geigenlehrer. Und dann hieß es natürlich, verschüchterte Opfer sagten nicht aus. Das braucht es auch gar nicht. Verängstigte Kinder stammeln nur irgendetwas daher. Verantwortungsvolle Erwachsene besorgen den Rest. Sie behüten die Jugend. Das Trauma wird nicht reaktiviert. Das reimen die Alten alleine fertig. Das wird dann besprochen im Kollegium. Sie bauen den Missbrauch zusammen. Sie dichten es jemandem an. Sie mahnen ihn ab. Da redet sich keiner raus. Das wird den Eltern versprochen im Konferenzzimmer. Und einen Lehrerwechsel gibt es selbstverständlich auch. Ein Schuss vor den Bug tue bloß gut. Das ficht niemand mehr an. Fortan feinden sie ihn an. Tue nur Buße. Zur nächsten Lehrerversammlung kam ich in Schwarz.
Ich trat gespielt demutsvoll ein in das Rektorenstübchen. Und schon erschienen mir die Bierdümpel beim Wirten als die Wiedergänger meiner Stümperkollegen und Volkis Fratze fräste sich als die des Musikschuldirektors in meinen Kopf. An die Schläfe fasste ich mir, schlagartig, ein Hieb, den nur das reflexhafte Wegspreizen von Zeigefinger und Mittelfinger abfederte. Das Strecken kein bisschen bemerkt, knallten anstelle von Handballen oder Faust die beiden Fingerkuppen an meinen Schädel, an jene Stelle, die damals schon so kahl war. Das Haareraufen verwehrt, blieb mir nur, den Daumen gen Decke abzudrücken beim Begreifen von Lena und Volki hinter meiner Stirnplatte, der Vorstellung, die mich durchzuckte im Hirn. Fest drückte und presste ich ersten und zweiten Finger gegen das Jochbein, dass sie verschwindet, die Szenerie dahinter. Heute wie damals, hier, an diesem meinem Schreibtisch, dort, an jenem unserem Küchentisch, im Lichtkegel der zur Leselampe umfunktionierten Fliegenbindelampe, im cremefarbenen Schein der krepppapierumwickelten Stehlampe, beim Bedenken dieser fremden Regenbogenforellen, mit dem Verfassen meiner eigenen Geschichte befasst, an die Schläfe, während die rechte Hand weiterschreibt, haltlos ohne die linke am Blatt, in krakeelender Schrift statt zu schreien, zu wütend zu brüllen, auf diesem Blatt, die Begegnung der beiden beschrieben, auf Linoleum, in Spitalsschlapfen, die sogenannten OP-Latschen, Offizien der Herren und Frauen Doktoren, einander gegenüber in sterilem Kleid, weiß wie Hochzeit, keimfreigrün und abgeschützt der Mund, salmonidenschwarz vor den zweien zwei Teller, ein Forellenskalpell: »So was, die zerteilen Sie aber gut.« – »So was.« – »’tschuldigen, sezieren heißt das ja.« – »Danke, aber ich anästhesiere.« – »Fische vielleicht?« – »Derweil ess ich so was so selten.« – »So was, warum denn das?« – »Zwar Angler oder so was mein Mann, aber was weiß ich.« – »So was, schade.« – »Ja, wie gut so was schmeckt. Da arbeitet man gern, freitags.« – frisch aus der Tiefkühltruhe gefischt, jede Woche in die Rachen der Industriebacköfen geworfen, in den Großkantinenküchen katholischer Lande angesprungen, als röchelte, als hechelte, als holte diese gottverdammte und verheißungsvolle Fliegenfischergegend Atem.
So zog ein Luftstoß das Küchenfenster zu und so schwenkte der Landschaftsodem das Scheibenspiegelbild in meinen Augenschein. Vom Stoß gegen den Kopf noch gehoben die Linke, zum Revolver geformt, am pulsierenden Joch, die Mündung drückend, um irgendwie dieses geblickte Bild zu variieren, umzumodellieren, als wäre es aus Ton. Fast bereit abzusetzen, glitten die Finger weiter, in mein Gesicht hinein, über den Augenbrauenansatz hinaus, die pechigen Borsten entlang, knetend, gegen den Strich bürstend, bis zu jenem schmerzhaften Punkt über dem Augenwinkel an der Stirn, migränemassierend wie bei Wetterumschwung, mit der Mündung aus Zeigefinger und Mittelfinger, dass kein Glied mehr verblieb am Abzug, akkupressierend den Bastard aus Wimper und Braue, das eine daumenlange Haar, das den Schatten eines Haarrisses auf meine Wange warf, wohin mein Ringfinger geriet, schlaff herabhängend, aus der Revolvertrommel gefallen, genau an den Tränensack hinabgewandert, wo die vertrocknete, salzige, butterverfettete, eiweißene Spur begann auf der Scheibe, wo der Speichelschleim einen Finger lang feinweiß, cremefarben schillernd meine Wange teilte, wo der zerkaute, hinabgeglittene Bissen Regenbogenforellenfleisch voran meine Haut entzweite, ihr einen Strich vernarbenden, metastasierenden, totlebhaften Gewebes beibrachte, einen Schmiss einzeichnete, einen Schnitt einschrieb ewiglich. Doch makellos hob sich anno dazumal Volkis Kopf, schauend aus stahlgraublauen Augen.