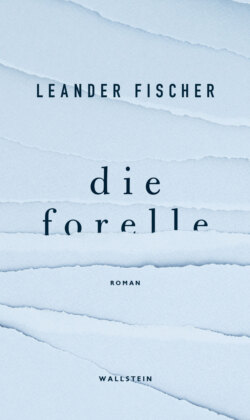Читать книгу Die Forelle - Leander Fischer - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
10 Siegi hört eine Radiosendung über
Kleinstarbeit am Rasterteil
ОглавлениеErst unlängst hörte ich auf dem Kulturradiosender, der mir meine handkrampfigen finalen Tage versüßt, einen Beitrag über den französischen Maler Cézanne. Man weiß es ja eigentlich, es ist dann immer die Rede von der Kubisteninspiration, vom Aufstoßen der Türen, durch die Avantgarden stürmen, von Picassos fortwährenden Interpretationen der Cézanne’schen Motive und auch vom Porträt des Kunstsammlers Ambroise Vollard, eines seiner ersten und einzigen Förderer. Mit einer Stimme, dass man das Schmunzeln fast hören konnte, sagte der Radiomoderator, Vollard hätte nicht gewusst, worauf er sich einlasse beim Einwilligen, Cézannes Modell zu werden. Normalerweise nahm ein Gemälde damals ein paar Stunden in Anspruch, wiewohl der Künstler sodann ohne das Modell für unbestimmte Zeit an der vorerst hingehauchten Studie weiterarbeitete. Aber Paul Cézanne habe die Palette bereitgemacht, die Pigmente vermischt, die Grundierung aufgetragen, während Ambroise Vollard schon dasaß, womöglich ungeduldiger Miene, stutzend, wann es losginge. Aber Cézanne habe die ganze Leinwand gerastert, habe sie vorzeichnerisch in winzige, daumennagelgroße Dreiecke unterteilt. Vollard habe wahrscheinlich gefragt, ob er etwas trinken könne, schielend schon nach der Dienstmagd, sie bringe ihm doch sicher einen Kaffee, vielleicht auch einen Weißwein, je nach Tageszeit. Aber Cézanne habe das untersagt, habe gesagt, er trage jetzt erst die zweite Grundierung auf, er modelliere das Licht, zerteile es, wie es eben falle hier herein um diese Tageszeit, er strukturiere das Bild. Ach Paul, dann maltest du zwei Dreiecke aus und schicktest Ambroise weg. Morgen um dieselbe Zeit. Sage und schreibe zweihundertsiebzehn Sitzungen lang. Vierhundertvierunddreißig daumennagelgroße, Stunden auszumalen dauernde Dreiecke weit. Im Vorrücken des Minutenzeigers vernichtet die Tageszeit, den Blick geheftet nur auf das Modell, aber nicht auf Ambroise, sondern seinen Schatten, auf den Schein, ihn einzufangen bereit, keineswegs die Figur dahinter, finster aus dem Atelier herausgerissen, das dann dalag, bar des Lichts, fern der Sonne, vorbeigeschwommen im Verstrich des Tages, auf die andere Hausseite, woher kein Licht mehr fiel auf die dunkle, ebenholzige Kommode, auf Stores voller Stickereien vor den Fenstern, auf die Muster, von feuchten, runzlig gewordenen Tapeten auf die Wände geprägt, die fingerabdruckfettvolle Türklinke, den Teppich, der Atelier und Vorraum verbindet, es ist so weit, das Licht ist fort, und schickte Vollard wieder weg, der die Reihe durchgelaufener Schuhe entlangschritt, wohl dachte, ach, was könne er alles malen. Warum ausgerechnet mois. Morgen um dieselbe Zeit. Ja. Und dann wieder, und dann wieder, und dann wieder, ach Ambroise, armer Mann, aber wer hat dabei schon an Cézanne gedacht. Der saß da, in seinem Atelier, geschieden vom Licht, das die anderen Impressionisten suchten an feuchten Flussuferwiesen, bei Frühstücken im Grünen, auf der hauchigen, fast venendurchsichtigen Milchhaut von Frauen, blauunterlaufen, auf rauschenden Tanzvergnügen unter venezianischen Lampions, Männer in Fracks mit Seidenaufschlägen. Währenddessen darbte Vollards Porträt dahin, Dreieck für Dreieck, Splitter für Splitter, Farbfleck und Pinselstrich, Stunde für Stunde, Jahr für Jahr, als Paul dann sagte, aha, so sieht er also aus, dieser Ambroise Vollard, in seine zerschlissenen Schuhe schlüpfte, das Modell einfach sitzen ließ, jedes Leben von ihm abgezogen, und sich aufmachte ins Gebirg, immer wieder hinging, sich in diese Hütte einquartieren ließ, um Lichtquanten vom rauen Fels mit Pinselpalette und Pigmentstafette zu fangen und sich selbst vor die Augen zu stellen, wie ein Insektenforscher vielleicht Schmetterlinge mit einem zarten Kescher aus der Luft fischte und sich selbst auf den Handrücken setzte extralanger Haxen. Weberknechtartig stakste das riesige Insekt dann den Finger entlang, gelangte über den Nagel hinaus, schon braun und nicht mehr schwarz, krabbelte von Kurti weg und die Thermoskannenkappe hinauf und strampelte dann in kaltem Kaffee. Sobald ich ihn an der Flügelscheide schnappte zwischen Daumen und Zeigefinger, sogleich schabten Geweih und Fühler über mein Nagelbett. Wie winzige Haken, die an mir zupften, das Rucken kleiner Beinchen, fast liebköstlich. Wie Maikäfer, wie Junischwärmer, wie das hingehauchte Licht der Glühwürmchen, so die Berührung dieses kleinen Kerlchens. Ich setzte das süße Ding ab. Es bewegte sich weg, langsamer jetzt, zu einem dämmernden Grashalm hin. Er stellte sich auf die imposanten Hinterbeine und trank den Tropfen Tau zwischen seinem Geweih. Muschelmundartig öffneten und schlossen sich seine beiden Scheren, Schaufeln oder was auch immer. Wie die meisten Menschen hatte ich noch nie einen gesehen, geschweige denn berührt. Doch nun war die Existenz des Riesenkäfers bewiesen. Ich nahm den finalen Schluck Kaffee. So gut hatte der noch nie geschmeckt. Kein Krümelchen Satz darin. Ich war verzückt. Kurti steckte sich den letzten Tschick ins schwarze Gesicht. Er schaute zu der Eiche auf, die uns beschattete, zum Rohrdickicht hinaus, hinter dem der Wildwechsel in der Dämmerung lag, nickte und nuschelte.
»Also nochmal.«
»Ja?«
»Warum kommst du nicht mehr zu mir?«
»Ich hab einfach keine Zeit mehr.«
»Seit du bei Ernstl lernst?«
Und dann begannen hinter der Lichtung die Gipfel zu glühen. Das Strahlen strich von den Graten einher und legte sich auf die Wipfel. Zu allen Seiten wuchsen und blühten Linden gen Himmel. Ihre Blätter siebten zunehmend das Licht. Das Gestirn schwang sich als zinnoberroter Feuerball empor. Die Luft war erfüllt von Flieder, Märzenbechern und Hyazinthen. Bis an die Füße der Alpen lief die Straße über die Brücke schnurgerade hinweg. Der Asphalt bildete eine Einflugschneise für den Sonnenschein. Der Strom floss majestätisch mächtig darunter. Der rauschende Flusslauf lag vor uns in Herzblutrot, unterbrochen nur durch die Lindenblattschatten. Es waren bloß kleine Schwachstellen ganz normalen Wassers in unserer Sage voller Unbesiegbarkeit. »Die Allerallerwichtigsten …« – »Jaja, die Weibchen, wegen der Eier«, gab ich wieder, was ich zum zirka tausendsten Mal vernahm, »die kapitalen Weibchen. Die sorgen für Nachwuchs«, verbesserte mich Ernstl, aber zum ersten Mal sah ich, was mehr als jede Lehre war, dieses infernalische Bild. Der sich bis zum Kalkalpenfelsansatz windende Styx, die Höllensymphonie des plätschernden, murmelnden, singenden Wassers. Wo es gegen Steine stieß, warf es in die Luft Perlen, die das schräg einfallende Frühlingssonnenaufgangslicht regenbogengleich brachen, jedoch die Farbpalette satt ins Rote gestrichen. Und Ernstl sprach: »Das letzte Ziel ist eigentlich ein Fluss, in dem nichts mehr zu fangen ist. Alle Fische so oft gehakt, dass man sie nie wieder dranzukriegen vermag. Aber bis dahin«, erstens nahm er die Ritz D zwischen Zeigefinger und Daumen der linken Hand, zweitens hakte er die Fliege aus der untersten Öse der Stange, die er rechtens hielt. Drittens trat er so weit von der Brüstung zurück, dass sie den wachsamen Forellenaugen seine Armbewegungen verdeckte. Viertens stellte er sich anders hin, setzte den linken Fuß voran, im Knie leicht gebeugt, den rechten gestreckt zurück, wie ein Skispringer den Telemark. Fünftens ließ Ernstl die Ritz D mit beiden Fingern gleichzeitig los, weniger eine Handbewegung als das plötzliche Auseinandergehen zweier Zangenschenkel. Bevor die Fliege noch der Schwerkraft nachkam, in dem einen Augenblick, da sie schon schwebte, aber noch nicht fiel, begann Ernstl sechstens zu werfen flussabwärts. »Schau ihn dir an, den Volki, so ein Sepp, wie der so gut fängt«, Ernstl wies mit einem Nicken in Richtung der nächsten Brücke. Ihre Silhouette zeichnete sich Dutzende Meter tallängs schräg zum Sonnenaufgang ab, »es muss mit dem Teufel zugehen.« Ein hoch aufgeschossenes V von einem Oberkörper war zu erkennen, ein schmaler, flimmernder, vertikaler Strich markierte die Rute, ein beschattetes Gesicht, eine Krempe hineingezogen, im Hutband eine Hahnenfeder, »seine jämmerlichen Versuche, flussaufwärts den Strömungsschatten eines Steins anzufischen«, ein Vorfach schimmerte diesseits der unteren Brücke orangefarben in den Lavastrom, denn erstens wollen Forellen kaltes Wasser. Zweitens erwärmt sich Wasser, wo es steht, am schnellsten. Drittens wollen Forellen also rasendes Wasser. Viertens wollen Forellen aber nicht gegen die Stromschnellen schwimmen. Fünftens wollen Forellen also stehende Stellen im rennenden Fluss. Sechstens brauchen Forellen sauerstoffreiches Wasser. Siebtens können die H2O-Moleküle umso besser O binden, je größer ihre Oberfläche ist. Achtens lässt sich eine Oberfläche auffächern, indem sie gefaltet wird. Neuntens wirft Wasser die meisten Falten, wird am weitflächigsten aufgespalten, wenn es auf Hindernisse trifft. Zehntens wollen Forellen also kühle Moleküle, die über Steine rinnen und Schottergründe hinab in Flüssen Kaskaden bilden, aufgewühlten Sprudel, aber so, dass sich hinter einem Stein, wenn das Wasser wieder sauerstoffgesättigt weiterrinnt, ein Strömungsschatten ergibt. Da stehen also diese Forellen. Und elftens lieben sie den Schatten, da ist das Nass dann noch etwas kälter. Zwölftens fallen von Ästen Insekten ins Wasser. Dreizehntens fressen Forellen Käfer. Stehen also vierzehntens unter astbeschirmten Stellen hinter Steinen im Schatten ausgesetzter Strömung flussabwärts der Kaskaden. Fragt sich nur fünfzehntens, wie fischt man die an? Wie komm ich an die kapitale Forelle ran?